Gemeinn Tzige Bl Tter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Scholarly Editing and German Literature: Revision, Revaluation, Edition
Scholarly Editing and German Literature: Revision, Revaluation, Edition <UN> Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik Die Reihe wurde 1972 gegründet von Gerd Labroisse Herausgegeben von William Collins Donahue Norbert Otto Eke Martha B. Helfer Sven Kramer VOLUME 86 The titles published in this series are listed at brill.com/abng <UN> Scholarly Editing and German Literature: Revision, Revaluation, Edition Edited by Lydia Jones Bodo Plachta Gaby Pailer Catherine Karen Roy LEIDEN | BOSTON <UN> Cover illustration: Korrekturbögen des “Deutschen Wörterbuchs” aus dem Besitz von Wilhelm Grimm; Biblioteka Jagiellońska, Libr. impr. c. not. ms. Fol. 34. Wilhelm Grimm’s proofs of the “Deutsches Wörterbuch” [German Dictionary]; Biblioteka Jagiellońska, Libr. impr. c. not. ms. Fol. 34. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Jones, Lydia, 1982- editor. | Plachta, Bodo, editor. | Pailer, Gaby, editor. Title: Scholarly editing and German literature : revision, revaluation, edition / edited by Lydia Jones, Bodo Plachta, Gaby Pailer, Catherine Karen Roy. Description: Leiden ; Boston : Brill, 2015. | Series: Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik ; volume 86 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2015032933 | ISBN 9789004305441 (hardback : alk. paper) Subjects: LCSH: German literature--Criticism, Textual. | Editing--History--20th century. Classification: LCC PT74 .S365 2015 | DDC 808.02/7--dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2015032933 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. issn 0304-6257 isbn 978-90-04-30544-1 (hardback) isbn 978-90-04-30547-2 (e-book) Copyright 2016 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. -

Lessing's Aesthetica in Nuce
Lessing’s Aesthetica in Nuce From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Lessing’s Aesthetica in Nuce An Analysis of the May 26, 1769, Letter to Nicolai victor anthony rudowski UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 69 Copyright © 1971 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Rudowski, Victor Anthony. Lessing’s Aesthetica in Nuce: An Analysis of the May 26, 1769, Letter to Nicolai. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1971. doi: https://doi.org/ 10.5149/9781469658278_Rudowski Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Rudowski, Victor Anthony. Title: Lessing’s aesthetica in nuce : An analysis of the May 26, 1769, letter to Nicolai / by Victor Anthony Rudowski. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 69. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1971] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. | Includes bibliographical references. -

Edinburgh Research Explorer
Edinburgh Research Explorer ‘An old friend in a foreign land’ Citation for published version: Wood, M 2018, '‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and drama between cultures', Oxford German Studies, vol. 47, no. 1, pp. 5-16. https://doi.org/10.1080/00787191.2018.1409504 Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/00787191.2018.1409504 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Oxford German Studies Publisher Rights Statement: This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Oxford German Studies on [date of publication], available online: http://wwww.tandfonline.com/10.1080/00787191.2018.1409504 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 ‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and Drama Between Cultures Michael Wood, University of Edinburgh Walter Scott’s translations of German plays are largely seen as expressing his interest in medieval themes and the historical individual, and as linguistically deficient works that aided the young man in his artistic development. -

Richard Wagner;
CORNELL UNIVERSITY LIBRARY MUSIC .. ,^_ .9<"'"*" ''nlveralty Library ML 410.W1C44 1897 .Richard Wagner 3 1924 022 322 212 Cornell University Library The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924022322212 Richard Wagner All Rights Reserved l:\fuLi HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN ^K Richard Wasner TRANSLATED FROM THE GERMAN By G. AINSLIE HIGHT AND REVISED BY THE AUTHOR WITH PHOTOGRAVURES AND COLLOTYPES, FACSIMILES AND ENGRAVINGS Munich Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G. London Philadelphia B. Lippincott J. M. Dent & Company J. Company 1897 ; Preface to the German Edition my little treatise " Das Drama " ^ IN Richard Wagner s I announced my intention of writing a larger work on the Bayreuth Meister. Just at the moment when my preliminary studies had advanced so far that I could think of attempting the execution of my plan, the publishers, Messrs Friedrich Bruckmann, proposed that I should write the text for an illustrated Life of Wagner. Honourable as this commission was, it had little attraction for me at first. In Carl Friedrich Glasenapp's Life of Richard Wagner the world possesses a classical biography of the great word-tone-poet ; a voluminous autobiography will moreover some day be published; several excellent little popular accounts of his life have been written by various authors. A new biography therefore seemed to me scarcely calculated to meet any real requirement. The publishers however agreed to my proposal to compose, not a biography in the narrower sense of the word, but so to speak a picture; not a chronological enumeration of all the events of his life in proper order, but rather a sketch of the entire thought and work of the great man, and so I felt it my duty to postpone the execution of my first design, and to carry out the present work to the best of my abilities. -

1 1 “Ich Bin Und Bleibe Bloȕ Poet Und Als Poet Werde Ich
“Ich bin ud bleibe bloß Poet und als Poet werde ich auch sterben.” Friedrich Schiller’s Sense of Poetic Calling and the Role of the Poetic Idea in his Emerging Professional Identity as a Dramaturge Item Type text; Electronic Dissertation Authors Cser, Agnes Judit Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 25/09/2021 13:31:04 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/627671 1 “ICH BIN UND BLEIBE BLOȕ POET UND ALS POET WERDE ICH AUCH STERBEN.“ FRIEDRICH SCHILLER’S SENSE OF POETIC CALLING AND THE ROLE OF THE POETIC IDEA IN HIS EMERGING PROFESSIONAL IDENTITY AS A DRAMATURGE By Agnes J. Cser __________________________ Copyright © Agnes J. Cser 2018 Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF GERMAN STUDIES In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2018 1 3 STATEMENT BY AUTHOR This dissertation has been submitted in partial fulfillment of the requirements for an advanced degree at the University of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this dissertation are allowable without special permission, provided that an accurate acknowledgement of the source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be granted by the copyright holder. -

Goethe and Rousseau: Resonances of the Mind
University of Kentucky UKnowledge German Literature European Languages and Literatures 1973 Goethe and Rousseau: Resonances of the Mind Carl Hammer Jr. Texas Tech University Click here to let us know how access to this document benefits ou.y Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Recommended Citation Hammer, Carl Jr., "Goethe and Rousseau: Resonances of the Mind" (1973). German Literature. 3. https://uknowledge.uky.edu/upk_german_literature/3 GOETHE AND ROUSSEAU This page intentionally left blank Carl Hammer,Jr. GOETHE AND ROUSSEAU Resonances of the Mind THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY To my wife, Mae ISBN 978-0-8131-5260-8 Library of Congress Catalog Card Number: 72--91665 Copyright© 1973 by The University Press of Kentucky A statewide cooperative scholarly publishing agency serving Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky State College, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and Western Kentucky University. Editorial and Sales Offices: Lexington, Kentucky 40506 Contents Foreword vn Explanation of Page References vm Introduction 1 I The Cultural Background 10 II Jean-Jacques according to Goethe 32 III Literary Echoes from Four Decades 57 IV Memories and Memoirs 81 V Of Love and Marriage 107 VI Ideals of Culture 122 VII Utopian Visions 137 VIII God, Man, and Cosmos 151 Abbreviations of Titles Used in Notes and Bibliography 171 Notes 173 Selected Bibliography 191 Index 217 This page intentionally left blank Foreword The initial plan of the following study proposed a comparison of Die Wahlverwandtschaften with La Nouveiie Heloise. -
Richard Wagner's Jesus Von Nazareth
Virginia Commonwealth University VCU Scholars Compass Theses and Dissertations Graduate School 2013 Richard Wagner's Jesus von Nazareth Matthew Giessel Virginia Commonwealth University Follow this and additional works at: https://scholarscompass.vcu.edu/etd Part of the History Commons © The Author Downloaded from https://scholarscompass.vcu.edu/etd/3284 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at VCU Scholars Compass. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of VCU Scholars Compass. For more information, please contact [email protected]. © Matthew J. Giessel 2013 All Rights Reserved Richard Wagner’s Jesus von Nazareth A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts at Virginia Commonwealth University by Matthew J. Giessel B.A., Virginia Commonwealth University, 2009 Director: Joseph Bendersky, Ph.D. Professor, Department of History, Virginia Commonwealth University Thesis Committee: Second Reader: John Powers, Ph.D. Assistant to the Chair, Department of History, Virginia Commonwealth University Third Reader: Paul Dvorak, Ph.D. Professor Emeritus, School of World Studies, Virginia Commonwealth University Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia December 2013 ii Acknowledgment τῇ Καλλίστῃ: ὁ ἔρως ἡμῶν ἦν ἀληθινός. “Jede Trennung giebt einen Vorschmack des Todes, — und jedes Wiedersehn einen Vorschmack der Auferstehung.” iii Table of Contents Abstract…………………………………………………………………………………………....v Introduction………………………………………………………………………………………..1 -

Blog Posts Videos Online Appendices
To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/650 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. Exploring the Interior Essays on Literary and Cultural History KARL S. GUTHKE EXPLORING THE INTERIOR Exploring the Interior Essays on Literary and Cultural History Karl S. Guthke https://www.openbookpublishers.com © 2018 Karl S. Guthke. Copyright on the translations of chapters one, seven and eight are held by the translators. The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International license (CC BY-NC-ND 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the work for non-commercial purposes, providing attribution is made to the author (but not in any way that suggests that he endorses you or your use of the work). Attribution should include the following information: Karl S. Guthke, Exploring the Interior: Essays on Literary and Cultural History. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2018. https://doi.org/10.11647/OBP.0126 In order to access detailed and updated information on the license, please visit https:// www.openbookpublishers.com/product/650#copyright Further details about CC BY-NC-ND licenses are available at https://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://www.openbookpublishers.com/product/650#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. -
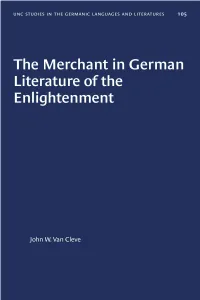
9781469656878 WEB.Pdf
The Merchant in German Literature of the Enlightenment COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ImUNCI Germanic and Slavic Languages and Literatures From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. The Merchant in German Literature of the Enlightenment john w. van cleve UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 105 Copyright © 1986 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Van Cleve, John W. The Merchant in German Liter- ature of the Enlightenment. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986. doi: https://doi.org/10.5149/9781469656878_Cleve Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Van Cleve, John W. Title: The merchant in German literature of the Enlightenment / by John W. Van Cleve. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 105. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1986] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. | Includes bibliographical references and index. -

Edinburgh Research Explorer
Edinburgh Research Explorer ‘An old friend in a foreign land’ Citation for published version: Wood, M 2018, '‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and drama between cultures', Oxford German Studies, vol. 47, no. 1, pp. 5-16. https://doi.org/10.1080/00787191.2018.1409504 Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/00787191.2018.1409504 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Oxford German Studies Publisher Rights Statement: This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Oxford German Studies on [date of publication], available online: http://wwww.tandfonline.com/10.1080/00787191.2018.1409504 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 24. Sep. 2021 ‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and Drama Between Cultures Michael Wood, University of Edinburgh Walter Scott’s translations of German plays are largely seen as expressing his interest in medieval themes and the historical individual, and as linguistically deficient works that aided the young man in his artistic development. -
Modernity, Nation, and the Baroque
Benjamin’s Library Series editor: Peter Uwe Hohendahl, Cornell University Signale: Modern German Letters, Cultures, and Thought publishes new English- language books in literary studies, criticism, cultural studies, and intellectual history pertaining to the German-speaking world, as well as translations of im- portant German-language works. Signale construes “modern” in the broadest terms: the series covers topics ranging from the early modern period to the present. Signale books are published under a joint imprint of Cornell University Press and Cornell University Library in electronic and print formats. Please see http://signale.cornell.edu/. Benjamin’s Library Modernity, Nation, and the Baroque Jane O. Newman A Signale Book Cornell University Press and Cornell University Library Ithaca, New York Cornell University Press and Cornell University Library gratefully acknowledge the support of The Andrew W. Mellon Foundation for the publication of this volume. Copyright © 2011 by Cornell University All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or parts thereof, must not be reproduced in any form without permission in writing from the publisher. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York 14850. First published 2011 by Cornell University Press and Cornell University Library Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Newman, Jane O. Benjamin’s library : modernity, nation, and the Baroque / Jane O. Newman. p. cm. — (Signale : modern German letters, cultures, and thought) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8014-7659-4 (pbk. : alk. paper) 1. Benjamin, Walter, 1892–1940—Criticism and interpretation. -

Klopstock-Rezeption Im Frühen 19
Stefanie Steiner „... längst fremd, zum Teil sogar ungenießbar und unverständlich ...“ Zur (musikalischen) Klopstock-Rezeption im frühen 19. Jahrhundert „Ich dichte für die Zeit, | Und lasse für die Ewigkeit | Klopstocke dichten.“1 Mit diesem Motto überschrieb Johann Wilhelm Ludwig Gleim eine neue Sammlung von Zeitgedich- ten, die er am 4. Januar 1802 seinem verehrten Dichterfreund schickte – ein wahrlich ambitionierter Anspruch für die Rezeption des Klopstock'schen Œuvres! Dass bereits um 1800, also noch zu Lebzeiten Klopstocks und noch mehr „in den ersten fünfzig Jahren nach seinem Tode“ „Klopstocks lebendige Wirkung […] fast ganz zu verlöschen [schien], in umgekehrtem Verhältnis zum erhofften Ruhm und zum weihe- vollen Pathos, mit dem sein Name gelegentlich noch zitiert wurde“,2 gilt längst als Gemeinplatz der Klopstock-Forschung. Spätestens seit Johann Wolfgang von Goethes auf den ersten Blick schmeichelhafter Würdigung im zehnten Buch von Dichtung und Wahrheit (1812), Klopstock sei der Begründer einer neuen Epoche, in der „das Dichter- genie sich selbst gewahr würde, sich seine eignen Verhältnisse selbst schüfe und den Grund zu einer unabhängigen Würde zu legen verstünde“,3 war Klopstock nicht mehr unumstritten – Goethes vermeintlich positive Wertung schlug rasch in vorsichtig erho- bene Kritik um: Nach den ersten zehn Gesängen des Messias habe Klopstock die an ihn gestellte Forderung nach einer „fortruckenden Bildung“4 nicht mehr einlösen können, und obwohl auf sein Œuvre unbestreitbar grundlegende Neuerungen in der deutschen Dichtung zurückgingen, sei es ihm doch nicht bestimmt gewesen, diese auch selbst zur Vollendung zu führen – eine Aufgabe, die (wie Goethe zwischen den Zeilen andeutet) erst ihm als „wahrem“ Dichtergenie vorbehalten blieb.5 In einer teleologisch ausgerich- teten Literaturgeschichtsschreibung nimmt Klopstock seither die undankbare Rolle eines Vorläufers Goethes ein.