Kleist-Jahrbuch 2001
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Variants of Warburg's Manuscripts on His Indian
The Epistemic Advantage of Self-Analysis for Cultural-Historical Insights: The variants of Warburg’s manuscripts on his Indian Journey A vantagem epistêmica da autoanálise para insights histórico-culturais: as variantes dos manuscritos de Warburg em sua jornada indígena Dra. Sigrid Weigel Como citar: WEIGEL, S. The Epistemic Advantage of Self-Analysis for Cultural- Historical Insights: The variants of Warburg’s manuscripts on his Indian Journey. MODOS. Revista de História da Arte. Campinas, v. 4, n.3, p.386-404, set. 2020. Disponível em: ˂https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/view/4 794˃; DOI: https://doi.org/10.24978/mod.v4i3.4794. Imagem: The Diptych Oraibi (GUIDI; MANN, 1998). The Epistemic Advantage of Self-Analysis for Cultural-Historical Insights: The variants of Warburg’s manuscripts on his Indian Journey A vantagem epistêmica da autoanálise para insights histórico-culturais: as variantes dos manuscritos de Warburg em sua jornada indígena Dra. Sigrid Weigel* Abstract The article is devoted to analyze different versions and drafts of the 1923 Warburg’s Lecture, held in Kreuzlingen in 1923, on his travel to the United States in 1895/96, at the end of his long convalescence in the sanatorium of Ludwig Binswanger, as well as the respective lectures of 1897. This essay focuses on how the dispersion of these texts, their different dates and interferences in publications over decades had epistemological implications in the interpretation of his famous Conference. Thus, the contrast between fundamental points of these texts, both in their forms and contents – including deliberate terminological fluctuations –, raises theoretical questions that interfere with the understanding of Warburg’s work in its methodological specificity. -

Bachmann's Feminist Reception
CHAPTER 2 Bachmann’s Feminist Reception One must in general be able to read a book in different ways and to read it differently today than tomorrow. (Ingeborg Bachmann, Wir müssen wahre Sätze finden) Every reader, when he reads, is in reality a reader of himself. —Ingeborg Bachmann, Werke, quoting Proust Since the late 1970s, the enthusiastic response of feminist readers, critics, and scholars to the writing of Ingeborg Bachmann has produced a radical reassessment of her work. As I explained in chapter 1, she owed her reputation during her lifetime to the two highly accomplished volumes of lyric poetry she published in the 1950s, Die gestundete Zeit and Anrufung des Großen Bären. Her critics responded more negatively to her subsequent attempts at prose fiction, The Thirtieth Year (1961) and the first finished volumes of her “Ways of Death” cycle, Malina (1971) and Three Paths to the Lake (1972). But after her death in 1973, feminist readers rediscovered her fiction, now focusing their attention on representations of femininity in the “Ways of Death,” augmented in 1978 by the posthumous publication of two novel fragments, The Franza Case (now called The Book of Franza) and Requiem for Fanny Goldmann. By the 1980s “the other Ingeborg Bachmann,” as Sigrid Weigel termed her (“Andere” 5), had achieved the status of cult figure within German feminism; feminist literary scholars’ spirited and subtle reinterpretations of her writing had produced a renaissance in Bachmann scholarship; and Bachmann’s texts had become central to the Ger- man feminist literary canon. In a study of Bachmann’s reception before 1973, Constance Hotz argues that 1950s journalists constructed an image of her that met the political needs of their era, turning Bachmann into an “exemplum for [Germany’s] reconstruction, its reattainment of international standards, its reachievement of recognition in the world” (72). -

The Schmittian Messiah in Agamben's the Time That Remains Author(S): by Brian Britt Source: Critical Inquiry, Vol
The Schmittian Messiah in Agamben's The Time That Remains Author(s): By Brian Britt Source: Critical Inquiry, Vol. 36, No. 2 (Winter 2010), pp. 262-287 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/648526 . Accessed: 05/02/2014 10:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Critical Inquiry. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.173.127.143 on Wed, 5 Feb 2014 10:38:34 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions The Schmittian Messiah in Agamben’s The Time That Remains Brian Britt For Giorgio Agamben, Alain Badiou, and Slavoj Zˇ izˇek the New Testa- ment writings attributed to Paul have much to say on contemporary de- bates over politics and religious tradition.1 Unlike other thinkers who have turned to Paul at moments of crisis and innovation, Badiou, Zˇ izˇek, and Agamben neither write as theologians nor profess Christianity. In what some have called our postsecular present, religious tradition has become a serious category of analysis in circles of political and cultural theory for the first time. -

Scholarly Editing and German Literature: Revision, Revaluation, Edition
Scholarly Editing and German Literature: Revision, Revaluation, Edition <UN> Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik Die Reihe wurde 1972 gegründet von Gerd Labroisse Herausgegeben von William Collins Donahue Norbert Otto Eke Martha B. Helfer Sven Kramer VOLUME 86 The titles published in this series are listed at brill.com/abng <UN> Scholarly Editing and German Literature: Revision, Revaluation, Edition Edited by Lydia Jones Bodo Plachta Gaby Pailer Catherine Karen Roy LEIDEN | BOSTON <UN> Cover illustration: Korrekturbögen des “Deutschen Wörterbuchs” aus dem Besitz von Wilhelm Grimm; Biblioteka Jagiellońska, Libr. impr. c. not. ms. Fol. 34. Wilhelm Grimm’s proofs of the “Deutsches Wörterbuch” [German Dictionary]; Biblioteka Jagiellońska, Libr. impr. c. not. ms. Fol. 34. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Jones, Lydia, 1982- editor. | Plachta, Bodo, editor. | Pailer, Gaby, editor. Title: Scholarly editing and German literature : revision, revaluation, edition / edited by Lydia Jones, Bodo Plachta, Gaby Pailer, Catherine Karen Roy. Description: Leiden ; Boston : Brill, 2015. | Series: Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik ; volume 86 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2015032933 | ISBN 9789004305441 (hardback : alk. paper) Subjects: LCSH: German literature--Criticism, Textual. | Editing--History--20th century. Classification: LCC PT74 .S365 2015 | DDC 808.02/7--dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2015032933 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. issn 0304-6257 isbn 978-90-04-30544-1 (hardback) isbn 978-90-04-30547-2 (e-book) Copyright 2016 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. -

Lessing's Aesthetica in Nuce
Lessing’s Aesthetica in Nuce From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Lessing’s Aesthetica in Nuce An Analysis of the May 26, 1769, Letter to Nicolai victor anthony rudowski UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 69 Copyright © 1971 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Rudowski, Victor Anthony. Lessing’s Aesthetica in Nuce: An Analysis of the May 26, 1769, Letter to Nicolai. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1971. doi: https://doi.org/ 10.5149/9781469658278_Rudowski Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Rudowski, Victor Anthony. Title: Lessing’s aesthetica in nuce : An analysis of the May 26, 1769, letter to Nicolai / by Victor Anthony Rudowski. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 69. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1971] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. | Includes bibliographical references. -

Edinburgh Research Explorer
Edinburgh Research Explorer ‘An old friend in a foreign land’ Citation for published version: Wood, M 2018, '‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and drama between cultures', Oxford German Studies, vol. 47, no. 1, pp. 5-16. https://doi.org/10.1080/00787191.2018.1409504 Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/00787191.2018.1409504 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Oxford German Studies Publisher Rights Statement: This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Oxford German Studies on [date of publication], available online: http://wwww.tandfonline.com/10.1080/00787191.2018.1409504 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 ‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and Drama Between Cultures Michael Wood, University of Edinburgh Walter Scott’s translations of German plays are largely seen as expressing his interest in medieval themes and the historical individual, and as linguistically deficient works that aided the young man in his artistic development. -
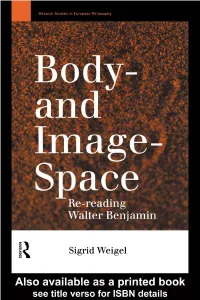
Body-And Image-Space: Re-Reading Walter Benjamin
Body-and image-space The last decade has seen renewed interest among philosophers and theorists in the writings of Walter Benjamin. In Body-and Image-Space Sigrid Weigel, one of Germany's leading feminist theorists and a renowned commentator on the work of Walter Benjamin, argues that the reception of his work has so far overlooked a crucial aspect of his thought Ðhis use of images. Weigel argues that it is precisely his practice of thinking in images that holds the key to understanding the full complexity and topicality of Benjamin's theory. Bilddenken, or thinking in images, and its relation to the body are central to Benjamin's work. Weigel illuminates points of contact between this approach and psychoanalytical modes of observation and suggests that there also are affinities between Benjamin's thought and contemporary French theory, notably the work of Foucault and Kristeva. Focusing on those parallels, the author demonstrates the productivity of Benjamin's theoretical approach for contemporary gender studies, cultural theory and philosophy. At the same time, her reading reestablishes the buried links between early Critical Theory and post- structuralism, between German high modernism and French post- modernist theory. Body- and Image-Space will be invaluable to anyone interested in gender theory, post-structuralism, cultural anthropology and philosophy. Sigrid Weigel is Professor of German Literature at the University of Zurich. Warwick Studies in European Philosophy Edited by Andrew Benjamin Senior Lecturer in Philosophy, University of Warwick This series presents the best and most original work being done within the European philosophical tradition. The books included in the series seek not merely to reflect what is taking place within European philosophy, rather they will contribute to the growth and development of that plural tradition. -
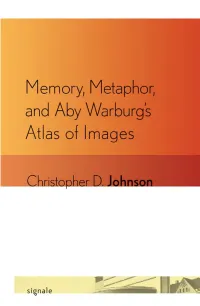
Memory, Metaphor, and Aby Warburg's Atlas of Images
Memory, Metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of Images Series editor: Peter Uwe Hohendahl, Cornell University Signale: Modern German Letters, Cultures, and Thought publishes new English- language books in literary studies, criticism, cultural studies, and intellectual history pertaining to the German-speaking world, as well as translations of im- portant German-language works. Signale construes “modern” in the broadest terms: the series covers topics ranging from the early modern period to the present. Signale books are published under a joint imprint of Cornell University Press and Cornell University Library in electronic and print formats. Please see http://signale.cornell.edu/. Memory, Metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of Images Christopher D. Johnson A Signale Book Cornell University Press and Cornell University Library Ithaca, New York Cornell University Press and Cornell University Library gratefully acknowledge the support of The Andrew W. Mellon Foundation for the publication of this volume. Copyright © 2012 by Cornell University All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or parts thereof, must not be reproduced in any form without permission in writing from the publisher. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York 14850. First published 2012 by Cornell University Press and Cornell University Library Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Johnson, Christopher D., 1964– Memory, metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of images / Christopher D. Johnson. p. cm. — (Signale : modern German letters, cultures, and thought) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8014-7742-3 (pbk. -

Panofsky in Munich, 1967 Christopher S
Panofsky in Munich, 1967 Christopher S. Wood MLN, Volume 131, Number 5, December 2016 (Comparative Literature Issue) , pp. 1236-1257 (Article) Published by Johns Hopkins University Press DOI: https://doi.org/10.1353/mln.2016.0088 For additional information about this article https://muse.jhu.edu/article/650016 Access provided by New York University (19 Apr 2017 23:08 GMT) Panofsky in Munich, 1967 � Christopher S. Wood A prize is supposed to honor the recipient. But often the recipient, just by accepting the prize, honors the prize-bestowing institution. Especially a damaged or disgraced institution, for example the Ger- man university in the twentieth century. Many German professors who had stayed at their posts right through the Nazi years and on into the 1950s and 60s craved personal reconciliation with the Jewish colleagues who had been expelled in 1933. Others sought a more abstract, shared exculpation. It occurred to some that prizes and hon- ors might balm wounds and hasten atonement. Gert von der Osten, General Director of the Museums of the City of Cologne, wrote to the architect Rudolf Hillebrecht on June 20, 1966, about the possibility of electing the eminent art historian Erwin Panofsky to the Order Pour le mérite. “The election,” he remarked presumptuously, “would have wide resonance among unreconciled refugees in all intellectual and artistic fields” (“Die Wahl hätte weite Resonanz bei unversöhnten Refugees auf allen geistigen und künstlerischen Gebieten”; Korrespondenz 5: no. 3304). The unforgiven, when speaking of the unreconciled, always manage to strike just the wrong note, as for example when von der Osten asserts in the same letter that Panofsky had not yet returned to Germany, “like so many of the sensitive emigrants, for fear of the shock” (“wie so viele der feinfühligen Emigranten, aus Furcht vor dem Schock”). -

Literatures of Migration in the Berlin Republic
HOLEY BERLIN: LITERATURES OF MIGRATION IN THE BERLIN REPUBLIC (Spine title: Holey Berlin) (Thesis format: Monograph) by Maria Mayr Graduate Program in Comparative Literature A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western Ontario London, Ontario, Canada © Maria Mayr 2010 Library and Archives Bibliotheque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-89497-2 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-89497-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distrbute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Richard Wagner;
CORNELL UNIVERSITY LIBRARY MUSIC .. ,^_ .9<"'"*" ''nlveralty Library ML 410.W1C44 1897 .Richard Wagner 3 1924 022 322 212 Cornell University Library The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924022322212 Richard Wagner All Rights Reserved l:\fuLi HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN ^K Richard Wasner TRANSLATED FROM THE GERMAN By G. AINSLIE HIGHT AND REVISED BY THE AUTHOR WITH PHOTOGRAVURES AND COLLOTYPES, FACSIMILES AND ENGRAVINGS Munich Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G. London Philadelphia B. Lippincott J. M. Dent & Company J. Company 1897 ; Preface to the German Edition my little treatise " Das Drama " ^ IN Richard Wagner s I announced my intention of writing a larger work on the Bayreuth Meister. Just at the moment when my preliminary studies had advanced so far that I could think of attempting the execution of my plan, the publishers, Messrs Friedrich Bruckmann, proposed that I should write the text for an illustrated Life of Wagner. Honourable as this commission was, it had little attraction for me at first. In Carl Friedrich Glasenapp's Life of Richard Wagner the world possesses a classical biography of the great word-tone-poet ; a voluminous autobiography will moreover some day be published; several excellent little popular accounts of his life have been written by various authors. A new biography therefore seemed to me scarcely calculated to meet any real requirement. The publishers however agreed to my proposal to compose, not a biography in the narrower sense of the word, but so to speak a picture; not a chronological enumeration of all the events of his life in proper order, but rather a sketch of the entire thought and work of the great man, and so I felt it my duty to postpone the execution of my first design, and to carry out the present work to the best of my abilities. -

1 1 “Ich Bin Und Bleibe Bloȕ Poet Und Als Poet Werde Ich
“Ich bin ud bleibe bloß Poet und als Poet werde ich auch sterben.” Friedrich Schiller’s Sense of Poetic Calling and the Role of the Poetic Idea in his Emerging Professional Identity as a Dramaturge Item Type text; Electronic Dissertation Authors Cser, Agnes Judit Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 25/09/2021 13:31:04 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/627671 1 “ICH BIN UND BLEIBE BLOȕ POET UND ALS POET WERDE ICH AUCH STERBEN.“ FRIEDRICH SCHILLER’S SENSE OF POETIC CALLING AND THE ROLE OF THE POETIC IDEA IN HIS EMERGING PROFESSIONAL IDENTITY AS A DRAMATURGE By Agnes J. Cser __________________________ Copyright © Agnes J. Cser 2018 Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF GERMAN STUDIES In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2018 1 3 STATEMENT BY AUTHOR This dissertation has been submitted in partial fulfillment of the requirements for an advanced degree at the University of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this dissertation are allowable without special permission, provided that an accurate acknowledgement of the source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be granted by the copyright holder.