Studie Als PDF Herunterladen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Volební Geografie CDU/CSU – Situace Za Vlády Angely Merkelové
MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Obor Politologie Volební geografie CDU/CSU – situace za vlády Angely Merkelové Bakalářská práce Monika Bělašková Vedoucí práce: Mgr. Michal Pink, Ph.D. UČO: 397600 Obor: Politologie Imatrikulační ročník: 2011 Brno, 29. 4. 2014 1 Prohlášení o autorství práce Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Volební geografie CDU/CSU – situace za vlády Angely Merkelové vypracovala samostatně a použila jen zdroje uvedené v seznamu literatury. V Brně, 29. 4. 2014 Podpis:............................................ 2 Poděkování Ráda bych zde poděkovala za užitečné rady a odborné připomínky vedoucímu práce Mgr. Michalu Pinkovi, Ph.D. 3 Anotace Tato práce se zabývá volebními výsledky Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie ve Spolkové republice Německo od nástupu Angely Merkelové do kancléřského úřadu. Cílem je zjištění vývoje volební podpory křesťanských stran v průběhu vlády první ženské kancléřky, tedy od r. 2005 do posledních spolkových voleb r. 2013. Práce vychází ze zjišťování volební podpory strany na úrovni volebních obvodů pomocí volební geografie. Závěrečným výstupem je analýza volební podpory strany a nárůstu volebních zisků v průběhu vlády. Annotation This work deals with the election results of the Christian-Democratic Union and Christian-Social Union in the Federal Republic of Germany since Angela Merkel started in the Chanccellor´s Office. Primary aim is detection of the development of electoral support of Christian parties during the government of the first female Chancellor, so from year 2005 until the last Federal votes in the year 2013. The work is based on detection of the election support of the party at the degree of the electoral district using the electoral geography. -

Karte Der Wahlkreise Für Die Wahl Zum 18. Deutschen Bundestag
Karte der Wahlkreise für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag gemäß Anlage zu § 2 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 518) geändert worden ist Nordfriesland Flensburg Schleswig- 2 Flensburg zu 2 1 zu 9 Grenze der Bundesrepublik Deutschland zu 15 Rendsburg- Kiel Eckernförde Landesgrenze 5 15 6 (auch Wahlkreisgrenze) zu 7 Plön 9 Dithmarschen 4 Rostock Vorpommern- Rügen Ostholstein Kreisgrenze Neu- münster 14 zu 3 Wahlkreisgrenze Vorpommern- zu 16 (auch Kreisgrenze) 3 Greifswald Segeberg Steinburg Lübeck Nordwestmecklenburg 8 Rostock Wahlkreisgrenze Stormarn 7 11 Pinneberg 17 Wittmund Schwerin 16 29 zu 25 Wilhelms- 10 haven 13 26 Bremerhaven 18 - 23 Saalekreis Kreisname zu 55 Herzogtum Aurich Stade Hamburg Lauenburg Mecklenburgische 24 Seenplatte Cuxhaven 12 Halle (Saale) Kreisfreie Stadt Emden Friesland 30 Wesermarsch Harburg 36 Ludwigslust- Rotenburg Parchim Lüneburg 72 Wahlkreisnummer Leer Osterholz (Wümme) Uckermark Ammerland 37 27 Oldenburg 57 (Oldenburg) 56 Bremen Prignitz Gebietsstand der Verwaltungsgrenzen: 30.09.2011 55 Rheinland-Pfalz: 01.01.2012 Delmen- horst 54 Ostprignitz- 35 28 Lüchow- Ruppin Verden Emsland 32 Oldenburg Uelzen Dannenberg Oberhavel 34 Barnim 25 Cloppenburg 58 33 Heidekreis Diepholz 44 66 Altmarkkreis Stendal Märkisch- Vechta 45 Salzwedel Oderland Nienburg Celle Havelland (Weser) 59 31 Gifhorn Berlin Grafschaft 38 75 - 86 Bentheim 40 43 Region Hannover 61 Brandenburg Osnabrück 134 Wolfsburg Potsdam an der Frankfurt 41 - 42 Havel (Oder) Minden- -
Bautzen – Geschichte Entdecken Budyšin – Stawizny Wotkrywać
Bautzen – Geschichte entdecken Budyšin – stawizny wotkrywać Viele Türme. Gute Aussicht. DIE Stadtverführer Mˇeš´canscyzawjednicy Stadtführungen und Reiseleitungen Abendliche r Stadtführungtembe Mai – Sep 0 Uhr um 19.0 Hauptmarkt 4 | 02625 Bautzen Telefon 0 35 91-48 66 18 | Telefax 0 35 91-48 66 20 www.stadtverfuehrer-bautzen.de [email protected] 365 Tage im Jahr in Bautzen für Sie erreichbar! Gruppenführung, Stadtverführung, Reiseleitung... z.B. »Bautzen is(s)t scharf« Stadtführung durch die Stadt des Senfes, allerlei wissens- wertes rund um das kleine Korn mit der großen Wirkung beim Rundgang durch das Senfmuseum… Fleischmarkt 5 · 02625 Bautzen · Telefon: 03591 597118 · www.bautzner.de …daran anschließend kulinarische Gaumenfreuden in der Schloßstraße 3 · 02625 Bautzen · Tel. 03591 598015 · www.senf-stube.de Die über 1.000-jährige Stadt der Türme und der Sorben lädt ein „Märchenhaft“ nennen Bewunderer die alte Stadt Bautzen, mit ihren vielen Türmen, den Bastionen, Toren und Mauern. Bischof Thietmar von Merseburg war es, der 1002 in seiner Chronik erst- malig die „Civitas Budusin“ erwähnte. Denn gerade kämpfte das frühe deutsche Reich mit dem polnischen Herzog Boleslaw um diesen fruchtbaren Landstrich und die Burg hoch auf dem Granitfelsen. Lange zuvor schon lebten hier Menschen, reiche Funde aus der Ur- und Früh- geschichte belegen dies für Bautzen und die Oberlausitz. Alte Handelsstraßen, allen voran die via regia, brachten Fortschritt und Wohlstand, nicht selten auch Not und Verderben. Als Jahrhunderte lang „Nebenland der böhmischen Krone“ wechselten hier die Herrscher, ließen Bautzen und die Lausitz zu Brandenburg, Meißen, Polen und zu Böhmen gehören. Von einer Zugehörigkeit gar zu Ungarn kündet noch heute das König-Matthias-Denkmal am Burgturm. -

Driven Into Suicide by the Communist Regime of the German Democratic
Central European History 0 (2019), 1–23. © Central European History Society of the American Historical Association, 2019 doi:10.1017/S0008938919000165 1 2 3 Driven into Suicide by the Communist Regime of the 4 German Democratic Republic? On the Persistence 5 6 of a Distorted Perspective 7 8 Q1 Udo Grashoff 9 10 ABSTRACT. The assumption that the Communist dictatorship in the German Democratic Republic 11 (GDR) drove many people to suicide has persisted for decades, and it is still evident in academic 12 and public discourse. Yet, high suicide rates in eastern Germany, which can be traced back to the 13 nineteenth century, cannot be a result of a particular political system. Be it monarchy, 14 democracy, fascism, or socialism, the frequency of suicide there did not change significantly. In 15 fact, the share of politically motivated suicides in the GDR amounts to only 1–2 per cent of the 16 total. Political, economic, or socio-cultural factors did not have a significant impact on suicide 17 rates. An analysis of two subsets of GDR society that were more likely to be affected by 18 repression—prisoners and army recruits—further corroborates this: there is no evidence of a 19 higher suicide rate in either case. Complimentary to a quantitative approach “from above,” a qualitative analysis “from below” not only underlines the limited importance of repression, but 20 also points to a regional pattern of behavior linked to cultural influences and to the role of 21 religion—specifically, to Protestantism. Several factors nevertheless fostered the persistence of 22 an overly politicized interpretation of suicide in the GDR: the bereaved in the East, the media in 23 the West, and a few victims of suicide themselves blamed the regime and downplayed important 24 individual and pathological aspects. -

Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate
Freistaat Sachsen State Chancellery Message and Greeting ................................................................................................................................................. 2 State and People Delightful Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate ......................................................................................... 5 The Saxons – A people unto themselves: Spatial distribution/Population structure/Religion .......................... 7 The Sorbs – Much more than folklore ............................................................................................................ 11 Then and Now Saxony makes history: From early days to the modern era ..................................................................................... 13 Tabular Overview ........................................................................................................................................................ 17 Constitution and Legislature Saxony in fine constitutional shape: Saxony as Free State/Constitution/Coat of arms/Flag/Anthem ....................... 21 Saxony’s strong forces: State assembly/Political parties/Associations/Civic commitment ..................................... 23 Administrations and Politics Saxony’s lean administration: Prime minister, ministries/State administration/ State budget/Local government/E-government/Simplification of the law ............................................................................... 29 Saxony in Europe and in the world: Federalism/Europe/International -

F.1. Wahl- Und Aufstellungsverfahren Für Die Bundestagswahl 2021
DIE LINKE. Sachsen 3. Tagung des 15. Landesparteitages 10. Oktober 2020 F. Parteiinterna F.1. Wahl- und Aufstellungsverfahren für die Bundestagswahl 2021 Einreicher*innen: Landesvorstand Der Landesparteitag der LINKEN Sachsen möge folgendes beschließen: Wahl- und Aufstellungsverfahren zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2021 I. Grundlage Gesetzliche Grundlage ist das Bundeswahlgesetz (BWahlG), weitere Grundlagen sind die Bundessatzung der Partei DIE LINKE und die Satzung des Landesverbandes Sachsen sowie die Wahlordnung der Partei (WO). II. Kreiswahlversammlungen 1. In den Kreisverbänden der LINKEN Sachsen werden im Zeitraum vom 12. Oktober 2020 bis 31. März 2021 zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2021 Kreiswahlversammlungen zur Aufstellung von Wahlkreisbewerber*innen und zur Wahl der Vertreter*innen für die Landesvertreter*innenversammlung zur Aufstellung der Landesliste durchgeführt. Die Kreiswahlversammlungen werden als Versammlungen aller zur Bundestagswahl wahlberechtigten Parteimitglieder durchgeführt. An dieser Versammlung haben alle Parteimitglieder Stimmrecht, die ihren Hauptwohnsitz im Tätigkeitsgebiet des Kreisverbandes (Landkreis oder kreisfreie Stadt) haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben und deutsche Staatsangehörige sind. 2. Die Kreiswahlversammlungen werden durch den Landesvorstand in Abstimmung mit den Kreisvorständen spätestens vier Kalenderwochen vor ihrem Stattfinden einberufen. Die Erstellung der Listen für die einzuladenden Mitglieder erfolgt über die Landesgeschäftsstelle. Die Einladung der Mitglieder erfolgt -

Qualitative Changes in Ethno-Linguistic Status : a Case Study of the Sorbs in Germany
Qualitative Changes in Ethno-linguistic Status: A Case Study of the Sorbs in Germany by Ted Cicholi RN (Psych.), MA. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Political Science School of Government 22 September 2004 Disclaimer Although every effort has been taken to ensure that all Hyperlinks to the Internet Web sites cited in this dissertation are correct at the time of writing, no responsibility can be taken for any changes to these URL addresses. This may change the format as being either underlined, or without underlining. Due to the fickle nature of the Internet at times, some addresses may not be found after the initial publication of an article. For instance, some confusion may arise when an article address changes from "front page", such as in newspaper sites, to an archive listing. This dissertation has employed the Australian English version of spelling but, where other works have been cited, the original spelling has been maintained. It should be borne in mind that there are a number of peculiarities found in United States English and Australian English, particular in the spelling of a number of words. Interestingly, not all errors or irregularities are corrected by software such as Word 'Spelling and Grammar Check' programme. Finally, it was not possible to insert all the accents found in other languages and some formatting irregularities were beyond the control of the author. Declaration This dissertation does not contain any material which has been accepted for the award of any other higher degree or graduate diploma in any tertiary institution. -

Cause Or Consequence? the Alternative for Germany and Attitudes Toward Migration Policy
Cause or Consequence? The Alternative for Germany and Attitudes toward Migration Policy Hannah M. Alarian Political Science, University of Florida Abstract: Does a far-right electoral victory change mainstream support for migration policy? Although we know how migration can shape support for the far-right, we know little about the inverse. This article addresses this ques- tion, exploring whether an Alternative for Germany (AfD) candidate’s election changes non-far-right voter attitudes toward migration policies. In combining the German Longitudinal Election Study Short-Term Campaign panel with fed- eral electoral returns, I find the AfD’s 2017 success significantly altered migra- tion attitudes. Specifically, policy support for immigration and asylum declined precipitously where an AfD candidate won the plurality of first votes. Yet these voters were also more likely to support multicultural policies for current immi- grants. Successful AfD candidates therefore appear to enable both an endorse- ment of xenophobic rhetoric and a rejection of cultural assimilation. Keywords: elections, far-right populism, Germany, migration, public opinion Few policies are as connected to the rise of the far right as migration. Even in Germany where nationalistic politics are highly stigmatized, the far-right, Alternative for Germany (AfD) has proven successful in linking itself with nativist migration policies. This change in focus for the AfD from Euroscepti- cism to nationalism came at the height of the 2015 refugee crisis, a message that resonated with traditional mainstream and, perhaps surprisingly, immigrant voters.1 For many of these voters, the 2017 election provided a direct referen- dum on Chancellor Angela Merkel’s stance on refugee resettlement,2 espe- cially within eastern districts where demonstrations against immigrants and asylum seekers continued to erupt.3 Thus, by stoking mass anxiety over migra- tion and leaving its Eurosceptic roots behind, the AfD sought a new strategy to secure its place on the national stage in the 2017 Bundestag election. -

Contributions to the Measurement of Public Opinion in Subpopulations
Contributions to the Measurement of Public Opinion in Subpopulations Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Sozialwissenschaen vorgelegt von Simon Munzert an der Sektion Politik – Recht – Wirtscha Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenscha Tag der mundlichen¨ Prufung:¨ þÉ. Juli óþÕ¢ Õ. Referent: Prof. Dr. Susumu Shikano, Universitat¨ Konstanz ó. Referent: Prof. Dr. Peter Selb, Universitat¨ Konstanz ì. Referent: Prof. Michael D. Ward, PhD, Duke University Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-0-296799 To Stefanie Acknowledgments I would not have been able to write and nish this dissertation without the help and support of many people. First of all, I want to thank my collaborators, Peter Selb and Paul Bauer, for their great work and support. eir contributions to the research presented in this thesis are of no small concern. e single papers received manifold and invaluable feedback over the course of their cre- ation. In particular, Peter Selb and I are grateful to Michael Herrmann, omas Hinz, Winfried Pohlmeier, Susumu Shikano as well as the editors and reviewers of Political Analysis for helpful comments and support. is work was also supported by the Center for Quantitative Methods and Survey Research at the University of Konstanz. e second paper that I wrote together with Paul Bauer also got valuable support. We are grateful to Delia Baldassarri for providing materials of her and Andrew Gelman’s analysis to us. We give the raters of the ALLBUS survey items our most sincere thanks for their contribution. Furthermore, we thank Klaus Armingeon, Matthias Fatke, Markus Freitag, Birte Gundelach, Daniel Stegmuller,¨ Richard Traunmuller¨ and Eva Zeglovits for helpful comments on previ- ous versions of this paper. -
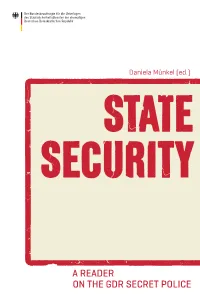
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -

Zweitstimmenanteile in Den Wahlkreisen Nach Parteien
Arbeitstabellen für die Bundestagswahl 2017 7 Endgültige Zweitstimmenanteile in den Wahlkreisen nach Parteien Stimmen- Lfd. Nr. Wkr. Nr. Wahlkreisbezeichnung Land anteil CDU 1 032 Cloppenburg – Vechta NI 53,1 2 031 Mittelems NI 49,4 3 126 Borken II NW 47,0 4 202 Bitburg RP 44,5 5 127 Coesfeld – Steinfurt II NW 44,0 6 124 Steinfurt I – Borken I NW 43,9 7 292 Biberach BW 43,1 8 025 Unterems NI 42,4 9 147 Hochsauerlandkreis NW 41,7 10 112 Kleve NW 41,6 11 200 Mosel/Rhein-Hunsrück RP 41,6 12 137 Paderborn – Gütersloh III NW 40,7 13 149 Olpe – Märkischer Kreis I NW 40,6 14 198 Ahrweiler RP 40,6 15 038 Osnabrück-Land NI 40,4 16 130 Warendorf NW 40,3 17 276 Odenwald – Tauber BW 39,8 18 089 Heinsberg NW 39,5 19 288 Waldshut BW 39,3 20 174 Fulda HE 39,0 21 030 Stade I – Rotenburg II NI 38,9 22 294 Ravensburg BW 38,9 23 029 Cuxhaven – Stade II NI 38,5 24 131 Gütersloh I NW 38,4 25 002 Nordfriesland – Dithmarschen Nord SH 38,3 26 197 Neuwied RP 38,2 27 270 Aalen – Heidenheim BW 38,2 28 111 Viersen NW 38,1 29 285 Rottweil – Tuttlingen BW 38,0 30 295 Zollernalb – Sigmaringen BW 38,0 31 033 Diepholz – Nienburg I NI 37,9 32 273 Rastatt BW 37,9 33 128 Steinfurt III NW 37,8 34 199 Koblenz RP 37,8 35 286 Schwarzwald-Baar BW 37,8 36 035 Rotenburg I – Heidekreis NI 37,7 37 204 Montabaur RP 37,5 38 136 Höxter – Lippe II NW 37,3 39 203 Trier RP 37,3 40 280 Calw BW 37,2 41 284 Offenburg BW 37,1 42 293 Bodensee BW 37,1 43 291 Ulm BW 37,0 44 044 Celle – Uelzen NI 36,6 45 099 Oberbergischer Kreis NW 36,5 46 298 St. -

Flurbereinigungsverfahren Dreiweibern Hdys a Hdys
AMTSBLATT HAMTSKE ŁOPJENO WOKRJESA BUDYŠIN FlurbereinigungsverfahrenERFOLGREICHER ABSCHLUSS Dreiweibern AUSGABE 4. AUGUST 2017 Am 20. Juni wurde das Flurbereinigungs verfahren Dreiweibern im Rahmen eines offiziellen Termins vor Ort abgeschlossen. - Von Zeit zu Zeit - Hdys a hdys - Es beinhaltete die Neugestaltung der Braun kohlefolgelandschaft um den Dreiweiberner See und ist das dritte abgeschlossene Verfahren im Landkreis. - v.l.n.r. Bodo Sauermann, Fachreferent Flächenmanagement Lausitz bei der LMBV, Thomas Leberecht, Bürgermeister Lohsa, Katrin Thiem, Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Dreiweibern, Im Zuge derBirgit Braunkohletagebausanierung Weber, Beigeordnete des Landkreises Bautzen und Gotthard Kowark, stellv. Vorstandsmitglied der müssen zunächstTeilnehmergemeinschaft immer die jeweiligen Grund Dreiweibern. Die Figuren stammen vom Bildhauer Aloysius Scholze aus Säuritz voraussetzungen geschaffen werden, um die Flächen wieder nutzbar zu machen. Die Basis für jegliche Investition sind dabei stets geregelte - Eigentumsverhältnisse bzw. die Wiederher stellung der Verfügbarkeit des Eigentums. Die ...kommt mir ein Zitat in den Sinn. Ein et LMBV schafft dafür die neuen öffentlichen eigentumsrechtlichen Voraussetzungen und was resignierender Ausspruch der inzwischen Nutzungsstrukturen (Gewässer, Kanäle, Wege). - ermöglicht damit die Vermarktung von Grund verstorbenen Bürgerrechtlerin und Malerin Die Flurbereinigungsbehörde des Landkreises stücken der privaten und öffentlichen Hand. Bärbel Bohley: „Wir wollten Gerechtigkeit