Derricks Härtester Fall
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gesamtkunstwerk-Film
SPIELFILMPRODUKTIONEN BENDESTORF Unterstrichene Titel sind einsehbar 1947 BIS 1952 FILMTITEL JAHR REGIE PRODUKTION DARSTELLER Menschen in Gottes Hand 1947 Rolf Meyer Junge Film-Union Paul Dahlke, Marie Angerpointner Wege im Zwielicht 1947 Gustav Fröhlich Junge Film-Union Gustav Fröhlich, Sonja Ziemann Die Söhne des Herrn Gaspary 1948 Rolf Meyer Junge Film-Union Lil Dagover, Hans Stüwe Diese Nacht vergess' ich nie 1948 Johannes Meyer Junge Film-Union Winnie Markus, Gustav Fröhlich Das Fräulein und der Vagabund 1949 Albert Benitz Junge Film-Union Eva Ingebg. Scholz, Dietmar Schönherr Der Bagnosträfling 1949 Gustav Fröhlich Junge Film-Union Paul Dahlke, Käthe Dorsch Dreizehn unter einem Hut 1949 Johannes Meyer Junge Film-Union Ruth Leuwerik, Inge Landgut Dieser Mann gehört mir 1949 Paul Verhoeven Junge Film-Union Heidemarie Hatheyer, Gustav Fröhlich Die wunderschöne Galathee 1949 Rolf Meyer Junge Film-Union Hannelore Schroth, Victor de Kowa Die Lüge 1950 Gustav Fröhlich Junge Film-Union Sybille Schmitz, Will Quadflieg Der Fall Rabanser 1950 Kurt Hoffmann Junge Film-Union Hans Söhnker, Inge Landgut Melodie des Schicksals 1950 Hans Schweikart Junge Film-Union Brigitte Horney, Victor de Kowa Taxi-Kitty 1950 Kurt Hoffmann Junge Film-Union Hannelore Schroth, Carl Raddatz Die Sünderin 1950 Willi Forst Styria-Film GmbH & Hildegard Knef, Gustav Fröhlich Junge Film-Union Professesor Nachtfalter 1950 Rolf Meyer Junge Film-Union Johannes Heesters, Maria Litto Hilfe, ich bin unsichtbar 1951 E. W. Emo Junge Film-Union Theo Lingen, Fita Benkhoff Sensation in San Remo 1951 Georg Jacoby Junge Film-Union Marika Rökk, Peter Pasetti Es geschehen noch Wunder 1951 Willi Forst Junge Film-Union Hildegard Knef, Willi Forst Die Csardasfürstin 1951 Georg Jacoby Styria-Film GmbH & Marika Rökk, Johannes Heesters Junge Film-Union Königin der Arena 1952 Rolf Meyer Corona Film Maria Litto, Hans Söhnker SPIELFILMPRODUKTIONEN BENDESTORF 1952 BIS 1959 FILMTITEL JAHR REGIE PRODUKTION DARSTELLER Der Verlorene 1951 Peter Lorre A. -
Zeughauskino: Reineckers Geschichte
REINECKERS GESCHICHTE Der 1914 geborene und vor vier Jahren verstorbene Herbert Reinecker war einer der einflussreichsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahr- hunderts. Als Autor erfolgreicher Kriminalserien wie Der Kommissar und Derrick prägte er nicht nur maßgeblich das bundesrepublikani- sche Unterhaltungsfernsehen. Seine Geschichten halten auch Indizien für die Verarbeitungsprozesse parat, die eine durch den National- sozialismus entscheidend geprägte Generation leistete. Bis 1939 war Herbert Reinecker für Propagandaschriften der Reichsjugend- führung verantwortlich, in den 1940er Jahren verfasst er dann als Kriegsberichterstatter der Waffen-SS Feuilletons. Parallel dazu reüs- sierte Reinecker als Drehbuchautor beim Film und machte eine beachtliche Karriere als Nachwuchsdramatiker. Sein »Gegenwarts- drama« und nationalsozialistisches Musterschauspiel Das Dorf bei Odessa wurde ab 1942 zum Massenerfolg. Nach Kriegsende wusste Reinecker die eigene Profession und Verantwortung durch Pseudo- nyme im Dunkel zu halten. Erfahrene Medienkollegen eröffneten ihm ab 1950 bei Hörspiel und Kurzfilm Chancen, die Reinecker zu nutzen wusste. Spätestens seit seinen Spielfilmstoffen Canaris (1954) und Kinder, Mütter und ein General (1955) setzten die Versu- che ein, die Zeit des Nationalsozialismus und damit auch die eigene Biografie ins rechte Licht zu setzen. Rolf Aurich, Niels Beckenbach und Wolfgang Jacobsen haben in ihrem Buch Reineckerland die Erzählwelten von Herbert Reinecker untersucht, wiederkehrende Motive und Verarbeitungsmuster entdeckt und produktive Ansätze zu einer Entschlüsselung des Verhältnisses von Zeitgeschichte, persön- licher Biografie und Werkgeschichte gefunden. Die Reihe REINECKERS GESCHICHTE, die den Spuren von Reineckerland folgt und Kino- und Fernseharbeiten aus vier Jahrzehnten vorstellt, offeriert die Chance, Reineckers Geschichtsarbeit nun auch im Kinosaal zu studieren. Spion für Deutschland REINECKERS GESCHICHTE 35 REINECKERS GESCHICHTE Junges Europa. Filmschau der Hitlerjugend. -

Titel Kino 1 2000, Endversion
EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 1/2000 GERMAN MASTERS Schlöndorff, Thome and Wenders in Competition at the Berlin International Film Festival Special Report SELLING GERMAN FILMS Spotlight on GERMAN TV-MARKETS Kino Scene from:“THE MILLION DOLLAR HOTEL” Thanks to our national and international customers subtitling film video dvd 10 years of Film und Video Untertitelung dubbing post-production 10 years of high-quality subtitles editing telecine 10% reduction on our regular prices standard conversion video transfer inspection of material during 10 celebratory months graphic design from 10 July 1999 to 10 May 2000 dvd mastering you will see the difference www.untertitelung.de [email protected] tel.: +49-2205/9211-0 fax: +49-2205/9211-99 www. german- cinema. de/ INFORMATION ON GERMAN FILMS. now with links to international festivals! Export-Union des Deutschen Films GmbH Tuerkenstrasse 93 · D-80799 München · phone +49-89-39 00 95 · fax +49-89-39 52 23 · email: [email protected] KINO 1/2000 6 Selling German Films 25 In Competition at Berlin Special Report 25 The Million Dollar Hotel 10 Opening Reality OPENING FILM Wim Wenders For Illusions 26 Paradiso – Sieben Tage mit Portrait of Director Sherry Hormann sieben Frauen PARADISO 11 ”I Sold My Soul To Rudolf Thome The Cinema“ 27 Die Stille nach dem Schuss Portrait of Director Tom Tykwer RITA’S LEGENDS Volker Schlöndorff 12 Purveyors Of Excellence Cologne Conference 13 German TV Fare Going Like Hot Cakes German Screenings 15 A Winning Combination Hager Moss Film 16 KINO news 28 German -

Jourdan La Boîte À Pandore
CATALOG FOREIGN RIGHTS jourdan la boîte à Pandore Editions LA BOÎTE À Jourdan PANDORE Russia 1812 : Napoleon’s blindness Bernard Coppens Bernard Coppens tackles the myth of Napeolon, the great strategist, to shed a new light on this campaign and the disaster it was, by denouncing the numerous errors of the Emperor. He shows that this disaster could have been avoided with someone else than Napoleon. The author : Bernard Coppens, specialized in the 1789-1815 period, has pu- blished historical documents and many studies on the Battle of Waterloo. Researcher and History illustrator, his work leads him to have another look on the events. Believing that history is never neutral, he is convinced of the necessity to get rid of the XIXth and XXteh century deformations. CONTACT : SERVICE DE PRESSE Original title : L’ aveuglement de Napoléon Pages : 320 [email protected] ISBN : 978-2-87466-230-0 PHOne : 0032 2 626 06 70 Prix : 19,90 € 2 My diary under the occupation Jeanne Lefebvre While her husband is away fighting, Jeanne stays with her mother and her three children in Saint André lez Lille, a French village very quickly occupied by the Germans and where her house becomes the office of high ranking ene- my soldiers. She puts pen to paper in order to relate accu- rately the events that left their mark on these four years and four days of occupation. She makes us feel the intense and constant fear the civilians lived with to the sound of bombs, shells and machine guns. She describes the mere citizens’ life and daily difficulties such as malnutrition and treason, but also the great mutual aid that occurred. -

DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung Des Filmmuseums Berlin 29. April
DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung des Filmmuseums Berlin 29. April – 15. August 2004 Filmreihe im Kino Arsenal 29. April – 26. Mai 2004 Ruth Leuwerik, Hamburg 1961 © Peter Nürnberg Ort: Filmmuseum Berlin im Filmhaus am Potsdamer Platz (Sony Center) Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin Info: Tel. + 49 - (30) - 300 903 -0 Geöffnet: Di – So 10 bis 18 Uhr Do 10 bis 20 Uhr Pfingsten geöffnet Eintritt: 3 € Ermäßigt: 2 € Kombiticket: 7 € (mit Besuch der Ständigen Ausstellung) Ermäßigt: 5 € Katalog: 16,90 € Info: www.henschel-verlag.de Filmreihe: Programm: www.fdk-berlin.de www.filmmuseum-berlin.de DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung des Filmmuseums Berlin 29. April – 15. August 2004 Biografie und Zeitleiste Kindheit und Jugend 1924 – 1946 Am 23. April 1924 wird Ruth Leeuwerik als einzige Tochter von Luise und Julius Martin Leeuwerik in Essen geboren. Das zweite „e“ in ihrem Nachnamen wird Ruth Leuwerik mit dem Beginn ihrer Filmkarriere streichen. Die Familie zieht 1938 nach Münster in Westfalen, wo Ruth nach dem Abschluss der Höheren Handelsschule als Sekretärin des Verkehrsvereins arbeitet und in ihrer Freizeit Schauspielunterricht nimmt. Nach der Prüfung an der Reichstheaterkammer erhält Ruth Leuwerik in der Spielzeit 1942/43 am Westfälischen Landestheater Paderborn ihren ersten Vertrag und tourt mit Gastspielen durch das Sauerland und das Ruhrgebiet. Das folgende Engagement an den Städtischen Bühnen Münster währt nur bis zum Frühling 1944, als das Theater infolge des Krieges schließen muss. Ruth Leuwerik zieht mit ihrer Mutter ins Sauerland und wird zum Arbeitsdienst in der Rüstungsindustrie abkommandiert. -

Derricks Hirtester Fall
25 Andreas Quetsch Der Mensch und die Moral: Oberinspektor Derricks hirtester Fall Ein Mensch wird ermordet. Oberinspektor Stephan Derrick und sein Assistent Harry Klein übernehmen den Fall, suchen den Mörder und melden nach rund sechzig Minuten Vollzug. Ein bißchen Schrecken, ein bißchen Action, ein biß chen Spannung. Derrick – ein ganz normaler Krimi im ZDF, einfach nur nette Unterhaltung? Derrick-Autor Herbert Reinecker sieht das anders: Auf meinem Felde, das begrenzt ist, versuche ich mitzuhelfen, ein paar Dinge und Begriffe zu entwirren, Moral von Unmoral zu scheiden, Defekte aufzuzei gen, ebenso wie Intaktes. Gewiß keine erste Stelle im allgemeinen Kunstbetrieb, aber vielleicht werden auch die geringen Verdienste am Ende zusammenge zählt.1 Tatsächlich steht die Fernsehserie Derrick nicht an der „erste[n] Stelle im all gemeinen Kunstbetrieb“. Aber das muß kein Nachteil sein, denn noch immer gilt das Fernsehen als Leitmedium der Gesellschaft. Dort lief die Krimiserie von 1974 bis 1998 zur prime-time, seit 1978 am schönen Freitagabend, „wo Millionen die Beine hochlegen, an der Fernbedienung den ZDF-Knopf drücken und sich im Lieblingssessel wohlige kleine Schauer über den Rücken jagen las sen“2. Zur Zeit werden die alten Folgen als Zuschauermagnet im werberele vanten Vorabendprogramm ausgestrahlt. Dabei geht es in den Derrick- Geschichten jedoch nur oberflächlich um die Erzeugung der wohligen kleinen Krimi-Schauer. Vielmehr nutzt Herbert Reinecker seine Arbeit, wie im obigen Zitat angedeutet, zu einer moralischen Auseinandersetzung. Wie er das macht und warum das oftmals durchaus fragwürdig ist, sollen die folgenden Seiten zeigen. 1 Herbert Reinecker in Pöttker, Horst / Seubert, Rolf: Glückseliger Dämmerzustand. Herbert Reinecker über ‚Junge Adler‘ und seine Vergangenheit im Nationalsozialismus. -

Titel Kino 1/2003
EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 1/2003 AT BERLIN in Competition DER ALTE AFFE ANGST by Oskar Roehler GOOD BYE, LENIN! by Wolfgang Becker LICHTER by Hans-Christian Schmid RESISTANCE & PROVOCATION Directors’ Portraits of Helga Reidemeister & Rosa von Praunheim SHOOTING STAR Daniel Bruehl SPECIAL REPORT Children’s Film in Germany Kino (photo © Prokino) “ Distant Lights ” Zbigniew Zamachowski Zbigniew in GERMAN CINEMA KINO1/2003 4 focus on CHILDREN’S FILM IN GERMANY directors’ portraits 14 RESISTANCE IS THE ’SECRET OF JOY’... A portrait of Helga Reidemeister 15 THE IMPORTANCE OF BEING PROVOCATIVE A portrait of Rosa von Praunheim producer’s portrait 18 UBIQUITOUS IS HIS MIDDLE NAME A portrait of Peter Rommel Productions actor’s portrait 20 SHOOTING STAR A portrait of Daniel Bruehl 22 KINO news in production 26 BLINDGAENGER Bernd Sahling 26 FARLAND Michael Klier 27 HERR LEHMANN Leander Haussmann 28 HITLERS JUEDISCHE SOLDATEN Heike Mundzeck 28 LAUTLOS Mennan Yapo 29 NORTHERN STAR Felix Randau 30 PFARRER BRAUN Martin Gies 30 SCHATTEN DER ZEIT Florian Gallenberger 31 SCHUSSANGST Dito Tsintsadze 32 SECRETS OF SIBERIA Frank Mueller 32 SUPERTEX – EINE STUNDE IM PARADIES Jan Schuette 33 TAL DER AHNUNGSLOSEN Branwen Okpako the 100 most significant german films (part 8) 34 DER LETZTE MANN THE LAST LAUGH AT BERLIN F.W. MURNAU Friedrich Wilhelm Murnau RETROSPECTIVE 35 ROTATION Wolfgang Staudte 36 WIR WUNDERKINDER AREN’T WE WONDERFUL? Kurt Hoffmann 37 DAS WACHSFIGURENKABINETT WAXWORKS Paul Leni 38 MAEDCHEN IN UNIFORM GIRLS IN UNIFORM Leontine Sagan new german films 40 DER ALTE AFFE ANGST AT BERLIN ANGST IN COMPETITION Oskar Roehler 41 DEVOT AT BERLIN DEVOTED PANORAMA Igor Zaritzki 42 EPSTEINS NACHT EPSTEIN’S NIGHT Urs Egger 43 EROTIC TALES: NR. -

Policing 'Wayward' Youth
Policing ‘wayward’ youth: law, society and youth criminality in Berlin, 1939 - 1953 David Meeres Thesis presented for the award of Doctor of Philosophy Supervised by Prof. Anthony McElligott Submitted to the University of Limerick in November 2014 Declaration The work presented in this thesis is my original. Due reference has been made when the work of others has been used. 2014 David Meeres I Acknowledgements There are many, many people to thank for tolerating my waywardness during the writing of the thesis. It has been a long, arduous journey. First of all, thank you to my long-suffering supervisor Anthony McElligott. He has not only had to put up with me as a post-graduate at the University of Limerick, but also as an under-graduate at St. Andrews University in Scotland. We have therefore known each other quite a long time. Thank you for your inspiration and your long-standing support. Thank you to my doctoral siblings Dr. Nadine Rossol and Dr. Tina Dingel (who have long since flown the nest). Nadine also helped me learn German, which was quite possibly not always that fun for her. To both of you: your support was really much appreciated! To the German Historical Institute in London, my thanks for providing both moral and financial support, the former through a research scholarship that they generously awarded me in 2004. Frau Welzing provided me with much needed advice during my prolonged stint at the Landesarchiv in Berlin. The staff of the Bundesarchiv Berlin also proved to be tolerant and patient helpers, particulary given my lack of grace in using the microfilm readers. -

Wuppertal – Traces of a Glorious Textile Past by Dorothea Nicolai
Wuppertal Traces of a glorious textile past Dorothea Nicolai Costume and Set Designer, Zurich, Switzerland Fig. 1: Old Wuppertal postcard, probably early 1970s. Photo: D. Nicolai. Abstract: Wuppertal today is a town of 350,000 inhabitants in the densely populated land of North Rhine-Westphalia / Bergisches Land in Germany and merged from six cities, Elberfeld and Barmen being the most important ones, in 1929. The name derives from the river, Wupper, along which textile handicraft developed since medivial times, and, starting in the mid-18th century, transformed into a wealthy innovative textile industry centre, known as the German Manchester. Famous quality products like Goldzack elastic or Bemberg lining came from there, it’s the birthplace of Aspirin by Bayer, the Rauhfasertapete (a popular ingrain wallpaper), but also Friedrich Engels, co-author of the Communist Manifest, and the poet Else Lasker-Schüler were born here. In 1900 the Schwebebahn (suspension railway) was inaugurated, then and still a symbol for technical innovation, connecting the city following the Wupper. Beautiful villas and industrial architecture manifest the textile past. Today the Pina Bausch dance company and the sculptor Tony Cragg found their home in Wuppertal. This paper tries to explore this intriguing place via its textile context. Content: Introduction / City history / Religious diversity and social / Famous companies and their products / Textile museums / People from Wuppertal / Wuppertal today / Selected Bibliography / Links and addresses 1 Fig. 2: Illustration found in an old tourist brochure, probably late 1950s. Photo: D. Nicolai. Introduction I came to Wuppertal for the first time in spring 2016, while I was working as a costume designer in nearby Cologne. -

Derrick» Wird Ausgestrahlt
Media Relations Tel direkt +41 44 305 50 87 e-mail [email protected] Internet www.medienportal.sf.tv 13. Oktober 1998: Letzte Folge von «Derrick» wird ausgestrahlt SF DRS strahlt an diesem Dienstag die letzte neue Folge der Krimiserie «Derrick» aus. Sie trägt den Titel «Das Abschiedsgeschenk» (Ausstrahlung auf dem Produktionssender ZDF am 16. Oktober 1998). Nachfolge-Serien am Dienstagabend-Krimitermin von SF DRS sind «Siska» und «Mordkommission». In der letzten Folge gerät Oberinspektor Derrick (Horst Tappert) selber in Gefahr: Ein verurteilter Mörder, stösst eine Morddrohung aus. Obwohl der Mann im Gefängnis sitzt, nehmen die Mitarbeiter Derricks die Drohung ernst: Sie bieten dem Oberinspektor Polizeischutz an. Doch Derrick hat einen andern Plan – er besucht die Familienmitglieder des Verurteilten und hofft, dass er so den Namen der auf ihn angesetzten Auftragskiller herausfindet. Maria Becker spielt die Mutter des Mörders. Im Vorfeld ist der Ausgang dieser Krimifolge nicht verraten worden: Wird Derrick sterben? Am Schluss der Folge wissen die Derrick-Fans und das Publikum: Oberinspektor Derrick wird nach Brüssel befördert und dort Vorsitzender der Koordinierungskommission des Europäischen Kriminalamts. Gerührt nimmt er von seinen Leuten Abschied, vor allem von seinem getreuen Assistenten Harry Klein (Fritz Wepper), aber auch vom «Alten» und seiner Crew, die plötzlich am Abschiedsfest auftauchen. Im Bund schreibt Catherine Aeschbacher unter anderem: «Anlässlich des Festakts benutzt Derrick noch einmal die Gelegenheit, der Menschheit ins Gewissen zu reden. Er spricht von veränderten Wertvorstellungen. Die Welt sei zu einem Schauplatz verkommen, auf dem nur noch das Recht des Stärkeren zähle. Mord und Totschlag seien alltäglich geworden und hätten Unterhaltungswert gewonnen. Der unbeteiligte Mensch geniesse die eigene Ohnmacht und spreche sich von jeder Mitschuld frei.» «Derrick» ist die bisher erfolgreichste deutsche Krimi-Serie. -
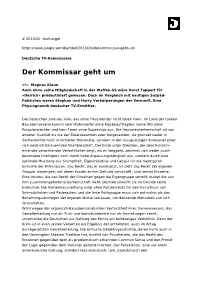
Der Kommissar Geht Um
# 2013/20 dschungel https://www.jungle.world/artikel/2013/20/der-kommissar-geht-um Deutsche TV-Kommissare Der Kommissar geht um Von Magnus Klaue Auch ohne seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS wäre Horst Tappert für »Derrick« prädestiniert gewesen. Doch im Vergleich mit heutigen Sozpäd- Polizisten waren Stephan und Harry Verkörperungen der Vernunft. Eine Physiognomik deutscher TV-Ermittler. Die Deutschen sind das Volk, das ohne Hausmeister nicht leben kann. Im Land der totalen Basisdemokratie kommt kein Wohnviertel ohne Kiezbeauftragten, keine WG ohne Putzplanwächter und kein Team ohne Supervisor aus. Die Hausmeisterherrschaft ist von anderer Qualität als die der Staatsbeamten oder Vorgesetzten, sie gründet weder in Sachautorität noch in formeller Hierarchie, sondern in der missgünstigen Kumpanei einer sich neidisch belauernden Nachbarschaft. Der Erste unter Gleichen, der dem Kollektiv einander verachtender Verächtlicher zeigt, wo es langgeht, zeichnet sich weder durch besondere Intelligenz noch durch hohe Anpassungsfähigkeit aus, sondern durch eine optimale Mischung aus Stumpfheit, Eigeninitiative und Gespür für die niedrigsten Instinkte der Mitinsassen. Das Recht, das er durchsetzt, ist stets das Recht der eigenen Gruppe, diejenigen, auf deren Kosten er ihm Geltung verschafft, sind immer Einzelne. Eine Instanz, die das Recht der Einzelnen gegen die Eigengruppe vertritt, duldet die von ihm zusammengehaltene Gemeinschaft nicht. Deshalb braucht sie im Grunde keine Exekutive: Die Reihenhaussiedlung sorgt ohne Polizeischutz für den Ausschluss von Schmutzfinken und Päderasten, und die linke Politgruppe muss sich auf nichts als das Beharrungsvermögen der eigenen Idiotie verlassen, um denkende Menschen von sich fernzuhalten. Wohl wegen der organisch-basisdemokratischen Verfasstheit ihres Gemeinwesens, das Gewaltenteilung nur als Trick und Individualrechte nur als Anmaßungen kennt, unterhalten die Deutschen zur Gattung des Krimis ein feindseliges Verhältnis. -

Fiktionen Staatlicher Exekutive. Die ZDF-Kommissare in Ihrer Zeit 1999
Repositorium für die Medienwissenschaft Markus Burbach Fiktionen staatlicher Exekutive. Die ZDF-Kommissare in ihrer Zeit 1999 https://doi.org/10.25969/mediarep/1385 Veröffentlichungsversion / published version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Burbach, Markus: Fiktionen staatlicher Exekutive. Die ZDF-Kommissare in ihrer Zeit. In: Augen-Blick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft. Heft 30: Gesetz und Moral. Öffentlich-rechtliche Kommissare (1999), S. 7– 24. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/1385. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under a Deposit License (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, non-transferable, individual, and limited right for using this persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses document. This document is solely intended for your personal, Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für non-commercial use. All copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute, or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the conditions of vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder use stated above. anderweitig nutzen.