IV. Die Landeskirche in Bayern
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wilhelm Lütgert and His Studies of the Apostles' Opponents
ProMundis Texte • 03/2019 Wilhelm Lütgert and his Studies of the Apostles’ Opponents: Aspiring to a better Understanding of the New Testament Letters Thomas Schirrmacher An abridged German version was published in Jahrbuch für evangelikale Theologie (The Yearbook for Evangelical Theology) 19 (2005): 139–166. An abridged and edited English version was published in Evanelical Review of Theology 43 (2019) 1: 40–52. “The Freedom which Jesus gives is not a heathen lawlessness.” (Wilhelm Lütgert in his 1919 Commentary on Galatians) ProMundis Texte • 03/2019 Summary There is no good reason why the life’s work of the Greifswald Professor for New Testament and Systematic Theology, Wilhelm Lütgert (1867–1938), has been forgotten. His central topics were 1. the critique of idealism, 2. the recovery of the doctrine of creation for epistemology and the recov- ery of ‘nature’ for the doctrine of God, and 3. the recovery of the significance of love in ethics. In the area of exegetics, his investigations of numerous New Testament books were ground-breaking. It was through this effort that Lütgert successfully broke with Christian Baur’s reigning tradition that James and Peter represent a legalistic and Paul an antinomian Christianity. Above all, and de- pending on the letter one examines, Lütgert viewed Paul as being caught between two fronts that had formed, one front of Jewish-Christian legalists and the other front of Gentile, enthusiastic an- tinomians. Against the legalists, Paul emphasized freedom from the law and life in the Spirit, and against the antinomians Paul emphasized that God’s Spirit never endorses sin and that the Old Tes- tament continues to be God’s word. -

Entwicklung Der CSU 1945/1946 1
II. Der programmierte Konflikt? Gründung und Entwicklung der CSU 1945/1946 1. Konfliktpotentiale und Gemeinsamkeiten a) „An der Wiege der CSU"'. Die Gründung der Union in Würzburg, Bamberg, Nürnberg und Regensburg Mit der Besetzung durch amerikanische Truppen ging im April 1945 auch in Bayern der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die Militärmaschinerie des Dritten Reiches war unter den alliierten Offensiven ebenso zusammengebrochen wie die Strukturen der staatli- chen Bürokratie oder die noch vor kurzem so mächtig erscheinende NSDAP, deren Würdenträger ihr Heil zumeist in der feigen Flucht gesucht hatten2. Die ersten Nach- kriegswochen boten auch denjenigen nur wenig Raum für politische Betätigung, die das nationalsozialistische Regime bekämpft oder ihm zumindest ablehnend gegenüber- gestanden hatten. Das lag nicht nur daran, daß die Militärregierung alle politischen Aktivitäten zunächst verbot, sondern auch und vor allem an dem unüberschaubaren Chaos, das sechs Jahre Krieg und zwölf Jahre Diktatur hinterlassen hatten. Doch aller Apathie und allen Hindernissen zum Trotz fanden sich schon bald wieder informelle Gesprächszirkel und lokale Initiativen zusammen, die zum Teil in Anknüpfung an Tra- ditionen der Weimarer Republik, aber auch in Erinnerung an vor 1933 gescheiterte Konzepte oder an Überlegungen, die während der NS-Zeit in Oppositionskreisen an- gestellt worden waren, über die politische Neuordnung diskutierten3. Der Gedanke, katholische und evangelische Christen in einer Partei zusammenzu- führen, stand dabei vielfach im Vordergrund. Er ging auf Vorstellungen aus der Zeit des Kaiserreiches und der ersten deutschen Demokratie zurück, war aber in dem stark milieugebundenen und hochgradig fragmentierten Parteiensystem der Weimarer Repu- blik nicht zu realisieren gewesen. Versuche, das Zentrum und die neu gegründete BVP nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Korsett konfessioneller Zwänge zu befreien und zu christlichen Volksparteien umzubauen, waren bereits in den Ansätzen gescheitert4. -

Backen Unterm Hakenkreuz
Backen unterm Hakenkreuz Die Aschaffenburger Bäcker-Innung und der Nationalsozialismus: Eine Quellenedition Ediert und herausgegeben von Klaus Hench, Georg Hench und Frank Jacob Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg Beiheft 7 herausgegeben von Joachim Kemper BACKEN unterm Hakenkreuz Die Aschaffenburger Bäcker-Innung und der Nationalsozialismus: Eine Quellenedition Ediert und herausgegeben von Klaus Hench, Georg Hench und Frank Jacob STADT- UND STIFTSARCHIV ASCHAFFENBURG Aschaffenburg 2020 herausgegeben durch das Stadt- und Stiftsarchiv im Auftrag der Stadt Aschaffenburg Der Druck dieses Buches wurde unterstützt durch Zuwendungen der Bäckerinnung Aschaffenburg-Alzenau Layout: Manuela Reich ISBN: 978-3-922355-37-3 Gesamtherstellung: VDS VERLAGSDRUCKEREI SCHMIDT 91413 Neustadt an der Aisch Inhalt Inhaltsverzeichnis ............................................... 5 Danksagung ................................................... 6 1. Einleitung ................................................. 7 Quelle 1: Das Jubiläumsbuch ................................... 9 Quelle 2: Das Protokollbuch .................................. 13 Schlussbetrachtung . .18 2. Editorische Notiz ........................................... 21 3. Quelle 1: „Jubiläumsbuch“ der Aschaffenburger Bäcker-Innung 1930, derselben zum 40-jährigen Bestehen gewidmet ..................... 23 Protokoll.................................................. 29 4. Quelle 2: Protokollbuch der Bäcker-Innung, 8. März 1932 bis 14. März 1963 ....... 59 5. Quellen- und Literaturverzeichnis -
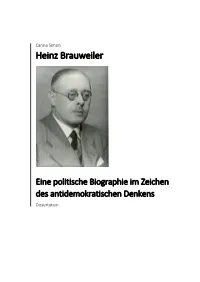
Dissertationcarinasimon.Pdf (3.051Mb)
Carina Simon Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades der Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) eingereicht im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel vorgelegt von Carina Simon 2016 Disputation am 22.5.2017 Danksagung Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, einigen Menschen meinen Dank auszusprechen, ohne deren Hilfe die Abgabe meiner Doktorarbeit nur schwer vorstellbar gewesen wäre. An erster Stelle danke ich meinen Betreuern Professor Dr. Winfried Speitkamp und Professor Dr. Jens Flemming. Letzterer hat mich von Beginn meines Studiums an begleitet. Ohne Professor Dr. Flemming wäre meine Begeisterung für das Studium der Geschichte und die Entscheidung für eine Dissertation nie in dem Maße vorstellbar gewesen. Er hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mir geholfen, auch wenn es einmal schwerere Phasen gab. Darüber hinaus danke ich Herrn Professor Dr. Dietmar Hüser und Herrn Professor Dr. Friedhelm Boll sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Geschichte der Universität Kassel, hier ganz besonders Silke Stoklossa-Metz. Darüber hinaus möchte ich mich bei Dr. Christian Wolfsberger (✝) und Gerd Lamers vom Stadtarchiv Mönchengladbach für ihre Hilfe bedanken; sowie bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Archive und Bibliotheken, die ich zu Recherchezwecken aufgesucht habe. Weiterhin danken möchte ich der B. Braun Melsungen AG für ihre finanzielle Unterstützung im Rahmen meines Stipendiums, was mir über einen langen Zeitraum ein sorgenfreies Arbeiten ermöglichte. Danken möchte ich vor allem meiner Familie, hier vor allem meinen Eltern, Hella und Alexander Simon und meinem Bruder Christopher Simon. -
Pfarrer Bernhard Wiebel
Archiv der Ev. Kirche im Rheinland Bestand Nachlass Pfarrer Bernhard Wiebel 7 NL 017 bearbeitet von Manfred Jung 1997 INHALTSVERZEICHNIS I. Vorwort ................................................................................................................................. 6 1. Zur Geschichte des Nachlasses und seiner Verzeichnung ....................................... 6 2. Beschreibung des Nachlaßbestandes ....................................................................... 6 3. Zeitliche Zuordnung und Gewichtung ..................................................................... 7 4. Vorträge, Aufsätze und Sammlungen Wiebels ........................................................ 7 4.1. Allgemeine Erläuterungen ................................................................................ 7 4.2. Zur Predigtsammlung ....................................................................................... 8 4.3. Zur Sammlung von Zeitungen und Illustrierten ............................................... 8 5. Der Lebenslauf Bernhard Wiebels ........................................................................... 8 5.1. Kindheit und Jugend ......................................................................................... 9 5.2. Studium und Vikariat ....................................................................................... 9 5.3. Erste Amtsjahre in Krofdorf ........................................................................... 10 5.4. Ernennung zum Pfarrer in Gerolstein ............................................................ -

Mennonitische Geschichtsblätter
Mennonitische Geschichtsblätter 1. bis 73. Jahrgang (1936 – 1940 und 1949 – 2016) Gesamtregister 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage (korrigierte Fassung von April 2019) erarbeitet von Helmut Foth Mennonitische Geschichtsblätter herausgegeben vom Mennonitischen Geschichtsverein e.V. Bolanden – Weierhof ISSN 0342-1171 Mennonitische Geschichtsblätter 1936 – 2016 Gesamtregister Gesamtregister Mennonitische Geschichtsblätter 1. – 73. Jahrgang (1936 – 1940 und 1949 – 2016) Inhalt: Vorwort zur zweiten Auflage ...................................................... 3 Vorwort ........................................................................................ 3 Praktische Hinweise ..................................................................... 5 Stichwortverzeichnis ................................................................... 7 Titelseite von Jahrgang 1936 ....................................................... 10 Titelseite von Jahrgang 2010 ....................................................... 11 I. Autorinnen und Autoren ........................................................... 12 II. Sachregister ........................................................................... 47 III. Rezensionen ........................................................................... 195 IV. Festschriften .......................................................................... 225 V. Laudationes ............................................................................. 227 VI. Nachrufe ............................................................................... -

Avhandling for Dr.Philos-Graden
1 AVHANDLING FOR DR.PHILOS-GRADEN Konfesjonsbetingede faktorer i oppslutningen om og resistensen mot høyreradikalisme og nasjonalsosialisme i Tyskland INGVAR KOLDEN Bonifacius feller Torseiken i 723/724 Bernhard Rode, 1781 commons.wikimedia.org 2 Til takk I og med at jeg under hele prosessen ved utarbeidelsen av denne avhandlingen har vært fulltidsansatt som lektor ved en videregående skole, har jeg ikke hatt anledning til å bli bistått av offisiell veileder. Imidlertid har jeg hatt den glede å bli bistått av flere på ulike måter gjennom den lange prosessen. Disse er det på sin plass å takke. Jeg vil først og fremst takke førsteamanuensis Lars Gaute Jøssang, NLA Høgskolen, og professor og leder av AHKR-instituttet UiB, Christhard Hoffmann, som begge har bidratt med metodisk hjelp, sistnevnte også henvist til litteratur og lånt meg litteratur. Mine gode kollegaer fra Danielsen videregående skole, lektor Torstein Sætre og lektor Rikard Exelby, har hhv. foretatt språklig revisjon og bidratt med hjelp til digital bearbeiding. Disse fortjener en spesiell takk. Ellers har en rekke andre personer ydet med sine bidrag. Av fagpersoner gjelder dette Prof. Dr. Jürgen W. Falter, Johannes Gutenberg Universität Mainz, professor Anders G. Kjøstvedt, AKH-instituttet UiO, professor Svein Rise, NLA Høgskolen, professor (em.) Asbjørn Tveiten, NLA Høgskolen og professor Hans M. Bringeland, NLA Høgskolen. Mine tidligere kollegaer, Berit Ingebrigtsen og rektor (em.) Lars Johan Danielsen, nåværende kollega, adjunkt Reidulf Ørjavik, og mine tidligere kandidater fra IPP, lektor Synnøve Didriksen og Bjørn Warland, har forært eller lånt meg litteratur. En lang rekke personer blant familie og venner, har oppmuntret meg i arbeidet. -

I. Who Was Adolf Schlatter? Biography and Theology 20 1
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Union with Christ Adolf Schlatter’s Relational Christology Michael Braeutigam Doctor of Philosophy University of Edinburgh 2014 Declaration I declare that this thesis has been composed by me, that it represents my own research and that it has not been submitted for any other degree or professional qualification. Edinburgh, April 22, 2014 i Abstract The present study is considered to be the first extensive work on the Christology of Swiss theologian Adolf Schlatter (1852–1938). As the title of this study suggests, we argue that Schlatter’s Christology reveals a distinctly relational trajectory. From this claim emerge two hypotheses to be probed, namely, first, whether the aspect of ‘relationality’ (Beziehung) is a correct reading of Schlatter and, if so, one has to demonstrate, secondly, to what extent Schlatter’s relational approach offers a sustainable Christology that adequately describes and explains the person and work of Jesus Christ in relation to God and to humanity. -

The Persecution of Christians Concerns Us All “In This Situation I Can Highly Recommend Dr
Thomas Schirrmacher The Persecution of Christians Concerns Us All Us Concerns Christians of The Persecution Schirrmacher Thomas “In this situation I can highly recommend Dr. Thomas Schirrmacher’s new book. It gives a clear and logical insight in many of the questions even people who consider themselves non- Thomas Schirrmacher religious people now ask. It can best be read with an open Bible and some open daily news- paper. It will give a surprisingly new insight into what it means to live in ‘a time like this’.” (From the preface by the Very Rev. Johan Candelin, Director of the Religious Liberty Commission of the World Evangelical Alliance) “Suffering comes in many forms, but the one that Scripture tells all Christians to expect is persecution for one’s faith. As Thomas Schirrmacher’s theological study will demonstrate, The Persecution the Bible has a tremendous amount to teach us about persecution. Without a Biblical un- derstanding, we are unlikely to fully grasp the nature of the spiritual battle. I am delighted, therefore, that his book puts the Bible’s teaching on persecution centre stage.” of Christians (Preface by Julia Doxat-Purser. Socio-PoliticalRepresentative & Religious Liberty Coordinator for the European Evangelical Alliance) Concerns Us All Prof. Dr. theol. Dr. phil. Thomas Schirrmacher, PhD, ThD, DD, is professor of the sociology of religion at the State University of the West in Timisoara (Romania), Distinguished Professor of Global Ethics and International Development at William Carey University in Shillong (Meghalaya, India), as well as president and professor of ethics at Martin Bucer European Theological Seminary and Research Institutes with branches in Bonn, Ber- lin, Zurich, Innsbruck, Prague, Istanbul and Sao Paolo. -

Finding the Words of God: the Contest for Moral Authority in Germany's Believing Protestant Community, 1888—1919
FINDING THE WORDS OF GOD: THE CONTEST FOR MORAL AUTHORITY IN GERMANY’S BELIEVING PROTESTANT COMMUNITY, 1888—1919 By MARK RYAN CORRELL A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2006 Copyright 2006 by Mark Ryan Correll To Ina ACKNOWLEDGMENTS This dissertation is the culmination of a work of passion and soul-searching. I have struggled with its findings and wrestled with its content in a way that has shaped my innermost beliefs. I feel privileged and thankful that I was able to work on a subject that lies so close to my beliefs. I look at this dissertation as merely the first step in a life-long project to grasp the nature of conflict and the Scriptures as they were understood in the nineteenth century. I feel grateful to everybody who has offered me support and encouragement. There are many who deserve my thanks. Gary Burge and Mark Noll, my professors at Wheaton, have my enduring thanks for introducing me to the subject of Biblical criticism and to the personal work of Adolf Schlatter and Christoph Blumhardt. Professor Noll has also graciously accepted to read parts of the dissertation and to serve on the reading committee. The University of Florida has provided me with a wonderful learning environment. Frederick Gregory has been the ideal dissertation advisor over the past five years, leaving me a free hand to delve into the subject of my choice but offering poignant advice and criticism when they were most useful. -

Buchbesprechung Im Politischen Kontext Des Nationalsozialismus
Buchbesprechung im politischen Kontext des Nationalsozialismus Entwicklungslinien im Rezensionswesen in Deutschland vor und nach 1933 Inauguraldissertation zur Erlangung des Akademischen Grades eines Dr. phil., vorgelegt dem Fachbereich 05 – Philosophie und Philologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz von Dietrich Müller aus Mainz Mainz, 2007 Dekan: gelöscht 1. Gutachter: gelöscht 2. Gutachter: gelöscht Tag der Promotion: gelöscht Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................. 5 1.1 Funktion der Buchbesprechung ................................................................... 5 1.2 Der Rezensent im Spannungsfeld zwischen Autor, Verleger und Leser ..... 8 1.3 Gegenstand der Untersuchung................................................................... 15 1.4 Zur Forschungslage.................................................................................... 19 2. Zur Vorgeschichte: Verbreitung politischer Literatur in der Weimarer Republik im Spiegel der Buchbesprechung.................................. 24 2.1 Die literarischen und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen................... 24 2.2 Presseorgane als Orte der Kommunikation................................................ 29 2.3 Buchbesprechung zweier Weltanschauungsbücher ................................... 33 2.3.1 Adolf Hitlers Doppelbuch Mein Kampf, ein verschlüsseltes Kampfprogramm 1925–1929....................................................................