Athematisch-Physikalischen Class
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
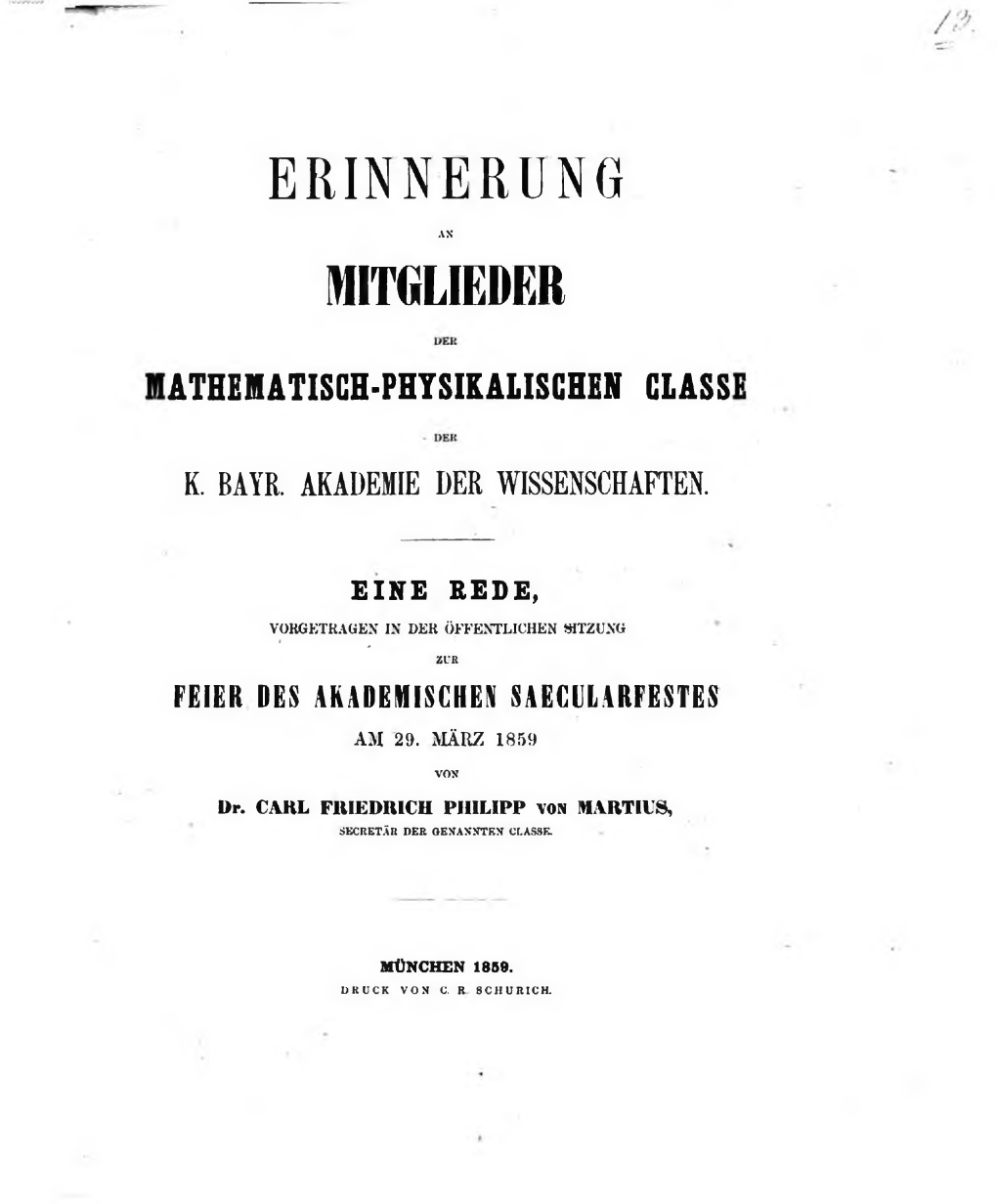
Load more
Recommended publications
-

Jahrbuch 2009
BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN JAHRBUCH 2009 BBADW_Jahrbuch_Buch_2009.indbADW_Jahrbuch_Buch_2009.indb 1 331.05.20101.05.2010 117:23:427:23:42 BBADW_Jahrbuch_Buch_2009.indbADW_Jahrbuch_Buch_2009.indb 2 331.05.20101.05.2010 117:23:427:23:42 Bayerische Akademie der Wissenschaften JAHRBUCH 2009 VERLAG DER BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN KOMMISSION BEIM VERLAG C. H. BECK MÜNCHEN 2010 BBADW_Jahrbuch_Buch_2009.indbADW_Jahrbuch_Buch_2009.indb 3 331.05.20101.05.2010 117:23:427:23:42 Herausgeber Bayerische Akademie der Wissenschaften Alfons-Goppel-Str. 11 80539 München Gesamtredaktion: Eva Regenscheidt-Spies, Generalsekretärin ISSN 0084-6090 ISBN 978 3 7696 7998 4 © Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 2010 Art Direction: Michael Berwanger, Tausendblauwerk, Dachau Lektorat: Dr. Ellen Latzin Layout und Satz: Gisela von Klaudy Bayerische Akademie der Wissenschaften Druck und Bindung: Druckerei C. H. Beck, Nördlingen Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) Printed in Germany BBADW_Jahrbuch_Buch_2009.indbADW_Jahrbuch_Buch_2009.indb 4 331.05.20101.05.2010 117:23:427:23:42 Vorwort Im Allgemeinen wird das Jahrbuch der Akademie nicht von einem Vorwort eingeleitet. Wie das bisher wohl einzige Vorwort im Jahrbuch 1950, das 1951 erstmals in der bis zuletzt gültigen Gestalt erschien, will auch dieses Vorwort auf einige bedeutsame Änderungen hinweisen. Die Akademie hat das Jubiläum ihres 250-jährigen Bestehens zum Anlass genommen, verschiedene Projekte, die auch in diesem Jahr- buch ihren Niederschlag fi nden, zu verwirklichen. So werden künftig Publikationen wie das Jahrbuch, Broschüren, Programme, Einladun- gen, Geschäftspapiere, die Zeitschrift Akademie Aktuell und schließ- lich auch der Internetauftritt durch ein einheitliches graphisches Erscheinungsbild der Akademie zuzuordnen sein. Ein neues Emblem vereint das Siegel mit dem Schriftzug der Akademie. -

Schön Deutsch Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek
Schön deutsch Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Im Buchhandel erhältlich oder direkt beim Verlag. Bestelladresse: TransMIT-Zentrum für Literaturvermittlung in den Medien Kerkrader Straße 3 D-35394 Gießen [email protected] http://www.literaturwissenschaft.de © Verlag LiteraturWissenschaft.de, Marburg (in der TransMIT-GmbH, Gießen) 2021 Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten. Druckvorlage: Verlag LiteraturWissenschaft.de Umschlag: Y2design, Wolfenbüttel Vorlage für Umschlagbild: © iStock Druck und Bindung: Schaltungsdienst Lange, Berlin ISBN 978-3-936134-79-7 Dirk Kaesler Stefanie von Wietersheim Schön deutsch Eine Entdeckungsreise Verlag LiteraturWissenschaft.de Unseren Kindern, die in diese Welt voller Schönheit gehen Für Freda & Otto und Antonia & Leopold Inhalt Einleitung Ein Mann und eine Frau auf der Suche nach Schönheit in ihrem Land 7 Deutsche Männermode Auf Tuchfühlung mit dem inneren Wandersmann 23 Siezen und Duzen Gesprächsbotox in virtuellen Zeiten 41 Hamburg Was ist heute noch Ehre? 57 Das deutsche Essen Plunderteilchen im Tortensarg 75 Achselhaare bei Frauen Die letzten Reservate eines bedrohten Schmucks 91 Das deutsche Schloss Von der Liebe zu echten und falschen Palästen 107 Helene Fischer Deutsche Madonna oder Quäkmadame? 123 Der deutsche Duft Speick-Seife, Badedas -

Communication De Monsieur Maurice Noël Séance Du 19Novembre 2010
COMMUNICATION DE MONSIEUR MAURICE NOËL 263 Communication de Monsieur Maurice Noël Séance du 19 novembre 2010 Les Princes de l’Europe des Lumières vus par les céramistes du 18ème siècle Le 18ème siècle est le siècle d’or de la porcelaine. Dès les premières années du siècle la manufacture de Meissen réussit à percer le secret de « l’or blanc » (Weisses Gold) et à fabriquer des statuettes en porcelaine. Ces figurines délicatement décorées, véritables chefs d’œuvre en miniature sont le reflet de la vie de cette époque et témoignent d’un savoir faire des modeleurs en céramique porté à un niveau inégalé. Elles illustrent aussi bien les activités des classes éclairées, que celles des classes populaires (Les Cris de Paris). Nous nous limiterons toutefois à évoquer celles des Princes. Le cosmopolitisme du siècle des Lumières : l’hégémonie française Nous imaginons difficilement aujourd’hui le rayonnement de la France à cette époque. Le vénitien Casanova déclare : « on ne vit qu’à Paris, on végète ailleurs». Le marquis de Caraccioli, ambassadeur de Naples à Paris, lorsqu’il vient prendre congé auprès de Louis XV, soupire tristement : « Ah, Sire, la plus belle place de l’Europe est la place Vendôme ! » Il rédigera plus tard en 1777 un ouvrage intitulé « Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe Française ». Le prince Henri de Prusse ne se console pas davantage : « J’ai passé la moitié de ma vie à désirer voir Paris ; je passerai l’autre moitié à le regretter». Dès 1734, Marivaux dans la Méprise écrivait : « Paris, c’est le monde ; le reste de la terre n’en est que les faubourgs ». -
News 28 Doc2.Pdf
Antiquariat Rainer Kurz Postanschrift: Watschöd 9 - 83080 Oberaudorf Internet: www.antiquariatkurz.de Bestellungen: Tel. 08033 - 91499 (0049-8033-91499) - Fax 08033-30 98 88 E-Mail: [email protected] Laden-Antiquariat Oberaudorf - Rosenheimer Str. 10 geöffnet: Mi + Do + Fr 10-12 und 15-18 Uhr Sa 9-12 Uhr – und nach Vereinbarung Laden-Tel. 08033-6089818 - Wir freuen uns auf Ihren Besuch 1 Datenschutz Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller sinnvollen und notwen- Literatur - Philologie digen technischen und organisatorischen Möglichkeiten so, dass sie für unbefugte Dritte nicht zugänglich sind. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, a) wenn Sie hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGOV er- 1 Augustinus, Aurelius: Vom Gottesstaat. Buch 1 bis 10. Buch 11 teilt haben; bis 22. 2. Auflage. 2 Bände. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, b) wenn die Weitergabe zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO erforderlich ist; 1985. Ca. 18 x 11 cm. XXXII S., 621 S., (3) Seiten; XXXII S., 1.108 S., c) wenn wir zur Weitergabe der Daten gesetzlich verpflichtet i.S.d. Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) (6) Seiten. Illustrierter orig.-kartonierter Einband. Aus der Reihe: DSGVO sind; Dünndruck-Ausgabe dtv Klassik. 30,-- d) wenn die Weitergabe der Daten im öffentlichen Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO Einbände etwas gebräunt, sonst gutes Exemplar. Taschenbuchausgabe. liegt oder; e) wenn die Weitergabe der Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO zur Wahrung unserer 2 Bachmann, Ingeborg: "Todesarten"-Projekt. -

Jahrbuch 1994
Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Habilitationsschriften und Dissertationen s. Kapitel 5 Fakultät für Mathematik 109 Fakultät für Physik 117 Fakultät für Chemie, Biologie und Geowissenschaften 154 Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 195 Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen 208 Fakultät für Architektur 234 Fakultät für Maschinenwesen 238 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 268 Fakultät für Informatik 298 Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau 311 Fakultät für Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaft 360 Fakultät für Medizin 369 Zentrale Einrichtungen 512 Zentralinstitute 512 Zentralinstitut für Physikalische Grundlagen der Halbleiterelektronik (Walter-Schottky-Institut) 512 Zentralinstitut für Raumplanung und Umweltforschung 520 Zentralinstitut für Sportwissenschaften und Sportzentrum521 Zentralinstitut für Geschichte der Technik 523 Forschungszentrum für Milch und Lebensmittel Weihenstephan 524 Sonstige zentrale Einrichtungen 531 Medienzentrum 531 Sprachenzentrum 531 Verzeichnis der Habilitationsschriften und Dissertationen Fakultät für Mathematik 535 Fakultät für Physik 538 Fakultät für Chemie, Biologie und Geowissenschaften 559 Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 588 Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen 592 Fakultät für Architektur 596 Fakultät für Maschinenwesen 598 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 621 Fakultät für Informatik 633 Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau 636 Fakultät für Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaft 657 Fakultät für Medizin 662 Verfasserregister 705 FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematisches Institut Ordinarien: Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Dr.rer.nat.h.c. R. Bulirsch, Univ.-Prof. Dr.rer.nat. O. Giering, Univ.-Prof. Dr.rer.nat. K.-H. Helwig, Univ.-Prof. Dr.rer.nat. H. Karzel, Univ.-Prof. Dr.rer.nat. K. Königsberger, Univ.-Prof. Dr.phil.nat. E. Thoma Extraordinarien: Univ.-Prof. F. Eckstein, Ph.D., Univ.-Prof. Dr.rer.nat. W. Heise, Univ.- Prof. Dr.rer.nat. -

Hauclschriftliclle 11 Nachlasse L
Aus dem hauclschriftliclle 11 Nachlasse L. 'Vestenriedcrs. Von August Kluckhohn. 1. A bth eil un g. Denkwürdigkeiten und Tagebücher. Abh. d. III. CI. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 1 . I &z r Aus L. lVestenrie<1ers Denlnvürdigkeiten und Tagebüchern. Von August Kluckhohn. Die k. IIof- und Staatsbibliothek bewahrt unter ihren handschrift- lichen Schätzen auch ,,'Vestenrideriana," ",ovon der Catalog der deutschen Handschriften (München 1866) p. 575 und 576 sechs Nummern aufführt. Fünf derselben umfassen Vorarbeiten von mancherlei Art, Collectaneen, Abschriften u. s. w. Eine Abtheilung der Westenrieder'schen Papiere aber, und zwar weitaus die werthvollste, bosteht zur kleineren Hälfte aus Briefen, theils in Originalen, theils in Concepten, zur grässeren Hälfte aus Tage- lJUchsnotizen, die nicht selten den Umfang von Denkwürdigkeiten an- nehmen. Das Handschriftenverzeichniss gibt darüber folgende Auskunft: "Eine nach den Jahren 1 789 (lies statt dessen 1 779) - 1829 geordnete Reihe eigenhändiger Briefe verschiedener Personen an Lorenz von Westen- rieder, auch Briefe und Aufsätze von ihm selbst. - Eigenhändige Auf- zeichnungen desselben über Begegnisse sowohl persönliche als öffentliche jedes Jahres, zum Theil auf Blättern der jeweiligen Calender." Diese Angaben sind insofern nicht ganz zutreffend, als aus den Jahren 1779 und 1827 -29 heute weder Briefe noch andere Aufzeichnungen vorhanden sind; die Umschläge, in denen sich Papiere aus jenen Jahren ,}- finden sollten, sind leer, so dass sich der fragliche Nachlass nur über die Jahre 1780-1826 ausdehnt. Andererseits sind aber nach der Fertig- /l () 0 stellung des Catalogs noch hinzugekommen 8 eigenhändige Briefe Westen- 1* r Aus L. lVestenrie<1ers Denlnvürdigkeiten und Tagebüchern. Von August Kluckhohn. Die k. -

00 Aa2009 02 Gesamt.Pdf
AkademieAktuell ZE I T S CHR I FT DER B AYER I S C HE N AK A DEM I E DER Wiss E N S C H A FTE N Ausgabe 02/2009 ISSN 1436-753X Jubiläum 250 Jahre Bayerische Akademie der Wissenschaften 1759 bis 2009 AKADEMIE EDITORIAL EDITORIAL I N H A LT. A USGAB E 0 2 / 2 0 0 9 . He F T 2 9 GRUSSWORTE Jahre Bayerische Akademie 4 Grußworte zum Jubiläum der Wissenschaften – das 250 Jubiläumsjahr 2009 hat uns AKTUELL schon eine Fülle neuer Einsichten vermittelt, ganz 9 Grenzen überschreiten generell, aber auch spezifisch über unsere eigene RCHIV LEBEN Vergangenheit: vom Darwin-Tag, der uns bereits A im Februar ein immenses Publikumsinteresse be- 1 2 Kleider für Gelehrte scherte, über das Ausstellungsprojekt „Wissenswelten“, das noch bis Ende 1 5 Tendit ad aequum Juni an 13 Orten in München Akademie- und Wissenschaftsgeschichte in 1 8 Aus der Gelehrtengemeinschaft Bayern sichtbar macht, bis zur aktuellen Gesprächsreihe „Wissenschaft im 2 1 Ein Plädoyer für die Kugelung Spiegel der Literatur“ in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Zum großen Festakt am 27. Juni liegt nun die neueste G EISTESWISSENSCHAFTEN Ausgabe von „Akademie Aktuell“ vor. 2 4 Inspirierte Wortklauberey 2 7 Sprache und Literatur im Blick der Forschung 250 Jahre lassen sich schwerlich in eine Ausgabe unseres Periodikums 3 0 Große Denker und Gelehrte zwängen. Dennoch wollen wir den Versuch unternehmen, unseren Lesern 3 4 Rückgrat der historischen Forschung zu diesem besonderen Anlass in kompakter Form einige Eindrücke von 3 6 Erforschung der bayerischen Geschichte der Vergangenheit, aber auch von Gegenwart und Zukunft der Bayerischen 3 9 Arbeit für die Schatzhäuser des Geistes Akademie der Wissenschaften zu verschaffen und zugleich Antworten auf 4 2 Erforschung der älteren Musikgeschichte häufig gestellte Fragen zu geben. -

Katalog Der Gemlde Des Bayerischen National-Museums
niliSNl"*NVIN0SHilWS^S3 1 Ü VH 8 H ""lI B RAR I ES^SMITHS0N1AN"^INSTI 5ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHiIWS SBIM niliSNI^NVINOSHilWS SBIHVaan libraries smithsonian insti W = OT = EX LIBRIS CooPER Union Museum FOR THE ArTS OF DeCORATION GIVEN BY Dr. Eerlincr .niiisNi NVl^ April 194? RAR 1 ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHIIWS S3M niusNi NviNOSHiiws S3iyvaan LIBRARIES SMITHSONIAN INST Z r- 2cn RAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIlfllllSNI NVINOSHIIWS SBH <2 ^. ^ z t/> z w ^5<y^^ b<^ 7 T 5 i I ES^SMITHSOnWiNS lini!iSNi;::;NVIN0SHilWS^S3 1 aVH 8 II^LI B RAR NVINOSHiIWS S3 lES SMITHSONIAN INSTITUTIONJ NOUniliSNII </) z ^ 5» ^<S7S>^ ^ ^ 2 1/ i jns liniiiSNi^NViNOSHiiws'^sa I a vd a n^Li B rar es'^smithsonian r; > </> ^„ 5 ^ aw. z o z BRARIES^SMITHSONIAN"*INSTITUTION^NOlinillSNl''NVINOSHillAiS c z z o o H Z S3 1 ava a n^Li B R AR es smithsonian'~in I z ^z-.. <2 z i'^SMITHSONIAN^ INSTITUTION^^NOlinillSNI NVINOSHilWS^^S: < < CO CO i es^smithsonianj^in oiini!iSNi"'NViNOSHiiws^s3 1 ava a n~'Li b rar NOUniliSNI NVINOSHiIWSJ IBRARIES SMITHSONIANI INSTITUTION •- </> ^. z ^ ^ z ^ ^ g KATALOGE DES BAYERISCHEN j NATIONAL-MUSEUMS. BAND VIII j KATALOGE DES BAYERISCHEN NATIONALMUSEUMS IN MÜNCHEN ACHTER BAND GEMÄLDE- KATALOG MIT 85 ABBILDUNGEN AUF 75 TAFELN MÜNCHEN 1908 KATALOG DER GEMÄLDE DES BAYERISCHEN NATIONAL- MUSEUMS VERFASST VON KARL VOLL, HEINZ BRAUNE UND HANS BUCHHEIT VERLAG DES BAYERISCHEN NATIONAL-MUSEUMS MÜNCHEN 1908 N Vorwort. Als mir Mitte März 1907 die Leitung des Bayerischen Nationalmuseums übertragen wurde, stellte ich mir die Auf- gabe, vor allem^ die reichen Sammlungen dem Verständnis des Publikums näher zu bringen und zugleich der Forschung mehr als bisher zugänglich zu machen.