Mitteilungen Freiberger Altertumsvereins
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Political and Economic News in the Age of Multinationals
Heidi J. S. Tworek Political and Economic News in the Age of Multinationals This article compares two media multinationals that supplied different genres of news, political and economic. Most media companies provided both genres, and these categories often overlapped. Still, investigating two firms founded in twenti- eth-century Germany shows how product differentiation affects the organization, geographical orientation, and business models of multinationals. While political news had the greatest impact when it was free and ubiquitous, economic news was most effective when it was expensive and exclusive. ews and information are, in many ways, the lifeblood of globaliza- Ntion. News fosters cross-border trade and can function as a com- modity itself. As a former news agency employee put it in 1910, of all types of commerce and transportation, news “acquired first and most often a global character.”1 But only very specific multinationals—news agencies—collected and disseminated global news from the mid-nine- teenth century. Apart from major publications like the London Times or Vossische Zeitung, most newspapers could not afford foreign corre- spondents or even journalists in their own capital cities. They relied instead upon news agencies for global and national news filtered through the technological conduit of cables and, later, telephones, wire- less, and ticker machines. To express the difference in commercial terms, news agencies were “news wholesalers,” distributing news to their “retail clients” (newspapers).2 Newspapers repackaged the news for their The author is grateful to Walter Friedman, Lilly Evans, Michael Tworek, and the three anonymous referees for their very helpful comments and suggestions. She also wishes to thank the members of the Business, Government, and the International Economy unit at Harvard Business School, where this research was first presented in 2014. -

Quellenangaben Musik
Quellenangaben Musik: Agnus Dei: Capella Gregoriana, Der Gregorianische Kalender, LASERLIGHT CLASSICS, 2009 Alkan, Charles-Valentin: Choral de Luther „Un fort rempart est Notre Dieu“, Op. 69, Coldstone and Clemmow, piano duo, TOCCATA CLASSICS,2011 Altenburg, Michael: Angst der Hellen und Friede der Seelen, Alsfelder Vokalensemble, Wolfgang Helbich, CPO, 1994 Bach, Johann Sebastian: Canonische Veränderungen über „Vom Himmel hoch“, BWV 769, Holm Vogel, Triosonaten, Naxos, 2000 Bach, Johann Sebastian: Choralvorspiel „Ein feste Burg“, BWV 720, Heinz Lohmann, JUBALmusic, 2011 Bach, Johann Sebastian: Christ lag in Todesbanden, Kantate BWV 4, The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Ton Koopman, Cantatas Vol. 1, Challenge Class, 2003 Bach, Johann Sebastian: Ein feste Burg ist unser Gott, Kantate BWV 4, The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner, Bach Cantatas, Harmonia Mundi, 2005 Bach, Johann Sebastian: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, Kantate BWV 126, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, BIS, 2007 Bach, Johann Sebastian: Magnificat BWV 243a: Rheinische Kantorei, Hermann Max, EMI Classics, 2005 Bach, Johann Sebastian: Nun komm der Heiden Heiland, Kantate BWV 61, The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner, Deutsche Grammophon, 2010 Bach, Johann Sebastian: Nun komm der Heiden Heiland, Kantate BWV 62, The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner, Deutsche Grammophon, 2010 Bach, Johann Sebastian: Orgelchoral BWV 686, Hans Fagius, Complete Organ Music, BIS, 2005 Bach, Johann Sebastian: Orgelchoral BWV 687, Hans Fagius, Complete Organ Music, BIS, 2005 Bach, Johann Sebastian: Orgelchoral BWV 734, Jan Kalfus, Alte Choräle, Supraphon, 1997 Bach, Johann Sebastian: Orgelfuge BWV 755, Peter Hurford, The Organ Works, Decca, 1995 Bach, Johann Sebastian: Singet dem Herrn ein neues Lied, Kantate BWV 190, The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Ton Koopman, Cantatas Vol. -
CD-Katalog 2014
CD CATALOGUE 2014 … ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum … F r i e d r i c h N i e t z s c h e 2 Inhalt Orgelmusik ...................................................................................................04 editiON thOmaNerchOr ....................................................................... 10 Orchestermusik ...................................................................................12 FraNz tuNder zum 400. geburtstag ...................................... 14 POsauNeNquartett "OPus4" wird 20 ........................................ 16 kaleidOskop der kammermusik ................................................... 18 weiterhiN erhältlich ............................................................................ 24 3 Sehr geehrte Musikliebhaber, seit nunmehr 20 Jahren veröffentlicht querstand, das Klassiklabel der Verlagsgruppe Kamprad, seine audiophilen Tonproduktionen als eine sinnbildliche Reise, die zu den Orten und Personen der Geschichte und Gegenwart unseres mitteleuropäischen Kulturraums führt. Dabei verschmelzen die uns überlieferte Musik, geschichtsträchtige Stätten und kunstvoll gefertigte Instrumente mit dem musikalischen Wissen und Wirken der im 21. Jahrhundert stehenden Menschen. Ein wiederkehrender spannender Prozess, in dessen Ergebnis jede CD zu einer ganz eigenen Entdeckung wird. Auch im 21. querstand-Jahr stellt dieser Katalog gedankliche Reiserouten vor, die von windigen Kirchturmspitzen im Norden Deutschlands hin zu der im Süden liegenden Bergwelt am Zürichsee reichen und den artifiziellen -

241. Saison Im Gewandhaus Konzerte Im SEP/OKT 2021 Vorverkaufsstart
SEP OKT 2021 Die 241. Saison im Gewandhaus zu Leipzig Die Beraterin, die tickt wie Sie. Silke Eisermann arbeitet als Beraterin total strukturiert. In ihrer Freizeit braucht sie dann aber viel Kreativität und für Mode interessiert sie sich sowieso. Genau wie Sie? Dann könnte es ja passen. Welche Beraterin oder welcher Berater so drauf ist wie Sie, erfahren Sie unter: 2 berater.sparkasse-leipzig.de SEP OKT 2021 Die 241. Saison im Gewandhaus zu Leipzig 3 Welchen Platz dürfen wir Ihnen anbieten? Normalerweise musizieren wir im Gewandhaus, in der Oper und der Thomaskirche, aber auch in Schulen und Kitas, in sozio-kulturellen Zentren der Stadtteile, in der Moritzbastei und auf der Rosental-Wiese. 4 Durch die Corona-Pandemie war dies nicht in normalem Maße möglich. Stattdessen musizierten wir in Hinterhöfen, vor Pflege- sowie Altenheimen und zur Weihnachtszeit auf einem Bus. Denn wir wollten da sein, wo Sie sind und Ihnen mit unserer Musik Freude bereiten. Im Zentrum unseres Schaffens stehen die Großen Concerte des Gewand- hausorchesters. Aber Sie können die Vielseitigkeit, Kreativität und Experimentierfreude unserer Musiker auch bei Kammermusikabenden, Chor-, Orgel- und Salonmusikkonzerte, Musikvermittlungs- oder Crossover-Projekten mit Künstlern der freien Szene erleben. Den Leipziger Bürgern ist es zu verdanken, dass es uns als Orchester seit der Bach-Zeit gibt und wir heute in Leipzig und der ganzen Welt musizieren. Wir revanchieren uns seit drei Jahrhunderten mit engagiertem Spiel auf Weltklasseniveau sowie ideen- und abwechs- lungsreich zusammengestellten Programmen. Und – unsere Herzens- angelegenheit – mit Benefizkonzerten für Leipziger Initiativen. Unsere Gewandhauskapellmeister haben Musik-, Zeit- und Stadtgeschichte geschrieben: Mendelssohn, Nikisch, Masur. Unser aktueller Gewandhaus- kapellmeister Andris Nelsons ist ein international gefeierter Star. -

Singet Und Jubilieret
Singet und JubilieretSinget ... 35 Jahre Quedlinburger Musiksommer 45 Jahre Schuke-Orgel in der Stiftskirche 50 Jahre Quedlinburger Oratorienchor FEST SCHRIFT Martin Luther: »Musik ist die Kunst der Propheten, die einzige Kunst, welche den Aufruhr in der Seele besänftigen kann; sie gehört zu den herrlichsten und kostbarsten Gaben, die uns Gott geschenkt hat.« Singet und Jubilieret ... Singet und JubilieretSinget ... 35 Jahre Quedlinburger Musiksommer 45 Jahre Schuke-Orgel in der Stiftskirche 50 Jahre Quedlinburger Oratorienchor Förderverein Quedlinburger Musiksommer e.V. FEST SCHRIFT Einführung 5 Gruß- und Geleitworte 6 · Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 6 · Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt 7 · Christoph Hackbeil, Regionalbischof für den Propstsprengel Stendal-Magdeburg 8 der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland · Martin Skiebe, Landrat des Landkreises Harz 9 · Christoph Carstens, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Quedlinburg 10 · Frank Ruch, Oberbürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg 11 Der Quedlinburger Musiksommer – Rückblick auf 35 Jahre 13 · Quedlinburgs Kirchenmusik in der Nachkriegszeit bis 1981 13 · Der Quedlinburger Musiksommer ab 1981 – ein Festival für klassische Musik 17 · Ein Streifzug durch 35 Jahre Quedlinburger Musiksommer 21 · Der Quedlinburger Musiksommer – eine Erfolgsgeschichte 42 Am 10. Oktober 2016 wird die Orgel der Stiftskirche 45 Jahre alt 45 · Geschichte der Orgeln in der Stiftskirche 45 · Arno Bartel – Organist an der Stiftskirche von 1939–1980 47 · Geschichte der jetzigen Orgel 1959–1971 49 · Die Schuke-Orgel op. 420 53 · Bemerkenswerte Gottesdienste und Konzerte seit 1971 und die Interpreten 54 Der Quedlinburger Oratorienchor wird 50 Jahre alt 59 · Kleiner Rückblick auf Quedlinburgs Chorgeschichte 59 · Kontinuität des Oratorienchors in Zeiten des Wandels 64 · Ein Chorjahr von A bis O – wie a capella bis Oratorium 71 Die Chorleiter 85 · Carl Künne (1925–1995) – Kantor und Organist an der Kirche St. -
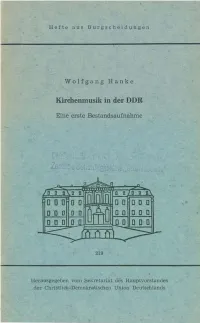
Kirchenmusik in Der DDR
Hefte aus Burgscheidungen Wolfgang Hanke Kirchenmusik in der DDR Eine erste Bestandsaufnahme 219 Herausgegeben vom Sekretariat des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands -4- SI n•... Hefte aus Burgscheidungen .. ~ Wolfgang llanke Kirchenmusik in der DDR Eine erste Bestandsaufnahme hr' 'I i D' \.. I n Jnl' a,v ,",ul,ulun","stdtte ,,(;[,~,. 1983 Herausgegeben vom Sekretariat des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Nnion Deutsdllands Ag-Nr.224/111/83- "Sehr. .hoch schätzen wir das Schaffen der Kirchenrnusiker und bildenpen ' Künstler unseres Landes, die im sakralen Raum tätig sind. Sie bereichern das kulturelle Leben der Städte und Gemeinden, -erschließen unvergängliches Erbe dem Heute, fördern künstlerische Talente, und oft praktizieren,sie besonders eindrucksvoll den Einklang von Bürgerpflicht und Christenpflicht," Mit diesen Worten gab Parteivorsitzender Gerald Götting im Bericht des Hauptvorstandes an qen 15. Parteitag der ChristIich-Demokratisrhen 'Nnion Deutschlands im Oktober 1982 erneut der hohen Wertschätzung Ausdruck, die die enu den im "Raum der Kirclie wirkenden Kunstschaf fenden und nicht zuletzt den Kir,chenmusikern entgegen bringt: . In ähnlicher Weise ist auch auf früheren Parteitagen, Sit zungen des Hauptvorstandes und Beratungen der CDU mit ," Kunst.:. und Kulturschaffenden der Einsatz der Kirchenmusi ker gewürdigt und unterstrichen worden, welchen hervorra genden Beitrag sie zur Entwicklung und Bereicherung 'des geistig-kulturellen Lebens an ihren Wirkungsstätten und oft weit darüber hinaus zur musischen und ästhetischen Erzie hung breiter Kreise leisten. So erklärte Werner Wünschmann, Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes der CDU, ' auf einer Tagung mit christlichen Künstlern 1981 in Burgscheidungen u, a,: .. Unsere Republik und ihr kulturel les Leben wären um vieles ärmer, wenn nicht in Hunderten von Kirchen fast Woche für Woche Orgelkonzerte, Mon~.t ·für Monat Lieder- und Motettenabende stattfänden 'und in den Festzeiten die großen Oratorien und Passionen erklängen. -

BACH 739 - Bach’S Organ Music Played on Silbermann Organs: Volume 6 ______
BACH 739 - Bach’s Organ Music played on Silbermann Organs: Volume 6 _____________________________________________________________________________________________________________________ This disc offers several organ works of major significance, and takes the listener on a tour which includes four different organs, all built by Bach’s friend and contemporary, the Master Organ-builder Gottfried Silbermann (1683-1753). We begin and end with the great Freiberg Cathedral organ, Silbermann’s finest extant instrument, and surprisingly perhaps, only the second one he built – at the age of 28 We then hear three different village organs, and if they all sound very similar this is no coincidence. Working out of his Freiberg workshops, centrally situated to serve his home state of Saxony, Silbermann confined his projects to the borders of Saxony, thus minimizing transportation costs. He formulated a standard village organ – for it was mostly the villages which he served – of 2 manuals and 20 to 23 stops, aiming for mass-production, or as near as was possible. This provided him with considerable savings on pipe and woodwork construction, savings which he passed on to his customers in the form of the very best materials available and immaculate workmanship – qualities which draw admiration from researchers and restorers even today. In addition he frequently added a free extra stop over and above the contracted specification. Silbermann was a dedicated craftsman – and a good businessman! From 1702 to 1707 Gottfried had studied the arts of organ-building with his elder brother Andreas in Strasbourg, and for two of these years with Thiery in Paris. A condition of his elder brother's tutelage was that Gottfried would not work in his brother's "territory"! So in 1710 Gottfried returned to his native Saxony and set up shop centrally in Freiberg, bringing with him qualifications and certificates which immediately established his reputation locally. -
Kreisparteischulen Der SED 1947–1952 116
Mike Schmeitzner Schulen der Diktatur Die Kaderausbildung der KPD/SED in Sachsen 1945–1952 Berichte und Studien Nr. 33 Herausgegeben vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universität Dresden Mike Schmeitzner Schulen der Diktatur Die Kaderausbildung der KPD/SED in Sachsen 1945–1952 Dresden 2001 Herausgegeben vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universität Dresden Mommsenstr. 13, 01062 Dresden Tel. (0351) 463 2802, Fax (0351) 463 6079 Layout: Walter Heidenreich Umschlaggestaltung: Penta-Design, Berlin Druck: Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG, Dresden Printed in Germany 2001 Abdruck und sonstige publizistische Nutzung – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet. Belegexemplar gewünscht. ISBN 3-931648-36-2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 7 2. Von Moskau nach Sachsen: Die Anfänge kommunistischer Kaderschulung 1944/45 13 3. Die Landesschulungsabteilung der KPD als Steuerungs- instrument der Kaderschulung 1945/46 23 4. Die Parteischulen der KPD 1945/46 32 4.1 Die Bezirksparteischule „Fritz Heckert“ 33 4.2 Die Kreis- bzw. Gebietsparteischulen 47 5. Die Schulungs- und Bildungspolitik der SPD 1945/46 51 5.1 Die Arbeiterakademie Oberreinsberg-Bieberstein 52 5.2 Dezentrale Schulungen 60 6. „Ideologische Klärung“ oder ideologische Gleichschaltung? Die gemeinsamen Schulungskonferenzen von KPD und SPD im Vorfeld der SED-Gründung 62 7. Ein sozialdemokratischer „Pfahl im Fleische“ der SED? Der Coup mit der SPD-Arbeiterakademie im April 1946 72 8. Die Landesschulungsabteilung der SED als Steuerungs- instrument der Kaderschulung 1946–1952 74 9. Die Landesparteischulen der SED 1946–1952 83 9.1 Ungebrochene Kontinuitäten I: Parteischulstrukturen und Personal 83 9.2 Ungebrochene Kontinuitäten II: Das Kadersystem 95 9.3 Ungebrochene Kontinuitäten III: Marxismus-Leninismus als Lehrinhalt 105 10. -

Download File
20 GLOBAL COMMUNICATIONS Heidi J.S. Tworek and Richard R. John The harnessing of steam and electricity in the mid-nineteenth century created a new world of possibilities in business, politics, and public life. In no realm was this transformation more momentous than in communications, an activity commonly understood at this time to embrace not only the trans-local circtilation of information, but also the long-distance transportation of people and goods (Matterlart 1996, 2000). For the first time in world history, merchants could convey overseas large quantities of goods on a regular schedule and exchange information at a speed greater than a ship could sail. New organizations sprang up to take advantage of this "communications revolution," as this transformation has come to be known (John 1994). Some were public agencies; others were private firms. Each was shaped not only by the harnessing of new energy sources, but also by the institutional rules of the game. These rules defined the relationship of the state and the market, or what economic historians call the political economy. This chapter surveys this transformation, which we have come to view with fresh eyes fol lowing the commercialization of the Intern~t in the 1990s. It features case studies of two well documented global communications organizations that originated in the nineteenth century - undersea cable companies and news agencies - which we have supplemented by a brief discus sion of other important global communications organizations: radio, telephony, and the mail. We have not surveyed film, a topic addressed by Peter Miskell's chapter in this Handbook. Four premises shape our chapter. -

Hinweisdienst Musik
HINWEISDIENST MUSIK JOHANN SEBASTIAN BACH Hinweise für den Benutzer 1. Diese Onlinefassung ist kostenlos, jede Weiterverbreitung ist jedoch untersagt. 2. Nachgewiesen werden Tonaufnahmen, die im Deutschen Rundfunkarchiv an den Standorten Frankfurt a. M. (Ffm) oder Berlin vorhanden sind. 3. Aufnahmen einer Komposition sind durch Leerzeilen voneinander getrennt, wobei nachstehende Symbole Werk- und Aufnahmedaten differenzieren: Titel (Werktitel) einer Komposition, z.B. Oper, Sinfonie, Liederzyklus Gesamtaufnahme einer Komposition (bezugnehmend auf ), d.h. Nennung der Interpreten des mit markierten Werkes, z.B. einer Operngesamtaufnahme, vollständigen Aufnahme einer Sinfonie oder eines kompletten Liederzyklus' Teiltitel einer Komposition (Werkausschnitt), z.B. Bezeichnung einer Opernouvertüre oder einer einzelnen Arie, eines Sinfoniesatzes oder Liedes aus einem Liederzyklus Teilaufnahme eines Werkes (Aufnahme eines Ausschnitts bezugnehmend auf ), d.h. Nennung der jeweiligen Interpreten des mit markierten Werkausschnitts. 4. Aufnahmedaten, die nur annähernd ermittelt werden können, sind durch 'c' (circa), 'n' (nach) und 'v' (vor) bezeichnet (z.B. 1950c); ein der Jahreszahl hinzugefügtes 'p' weist darauf hin, daß lediglich das Veröffentlichungsdatum der Aufnahme zu ermitteln war (z.B. 1950p). Nicht ermittelbare Aufnahmedaten sind mit 'o.J.' (ohne Jahr), fehlende Zeitangaben mit 'o.A.' (ohne Angabe) gekennzeichnet. 5. Nachweise, die sich auf Bestände des ehemaligen Rundfunks der DDR am Standort Berlin des Deutschen Rundfunkarchivs beziehen (DRA Berlin), sind durch 'DRA Berlin' gekennzeichnet. Bestellungen dieser Aufnahmen richten Sie bitte an folgende Adresse: Deutsches Rundfunkarchiv, Standort Berlin, Schallarchive, Rudower Chaussee 3, 12489 Berlin, Tel (030) 67764- 201, Fax: (030) 67764-200 Redaktionsschluß: 01.03.2000 Dieser Hinweisdienst wird vom Musik-Referat des Deutschen Rundfunkarchivs in Zusammenarbeit mit dem Standort Berlin zusammengestellt. Das Referat ist von Montag bis Freitag, jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr, zu erreichen. -

Historic Organs of Belgium May 15-26, 2018 12 Days with J
historic organs of BELGIUM May 15-26, 2018 12 Days with J. Michael Barone historic organs of GERMANY May 22-June 4, 2019 14 Days with J. Michael Barone www.americanpublicmedia.org www.pipedreams.org National broadcasts of Pipedreams are made possible with funding from Mr. & Mrs. Wesley C. Dudley, grants from Walter McCarthy, Clara Ueland, and the Greystone Foundation, the Art and Martha Kaemmer Fund of the HRK Foundation, and Jan Kirchner on behalf of her family foun- dation, by the contributions of listeners to American Public Media stations nationwide, and by the thirty member organizations of the Associated Pipe Organ Builders of America, APOBA, represent- ing the designers and creators of pipe organs heard throughout the country and around the world, with information at www.apoba.com. See and hear Pipedreams on the Internet 24-7 at www.pipedreams.org. A complete booklet pdf with the tour itinerary can be accessed online at www.pipedreams.org/tour Table of Contents Welcome Letter Page 2 Bios of Hosts and Organists Page 3-7 The Thuringian Organ Scene Page 8-9 Alphabetical List of Organ Builders Page 10-15 Organ Observations Page 16-18 Tour Itinerary Page 19-22 Tour Members Playing the Organs Page 23 Organ Sites Page 24-116 Rooming List Page 117 Traveler Profiles Page 118-122 Hotel List Page 123-124 Map Inside Back Cover Thanks to the following people for their valuable assistance in creating this tour: Tim Schmutzler Valerie Bartl, Cynthia Jorgenson, Kristin Sullivan, Janet Tollund, and Tom Witt of Accolades International Tours for the Arts in Minneapolis. -

Nachlass Constantin Von Dietze
UNIVERSITÄTSARCHIV DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG I. BR. Bestand: C 100 Nachlass Constantin von Dietze (1891-1973) Laufzeit: 1845-2011 2013 bearbeitet von Steffen Lippitz und Petra Hofmann Universitätsarchiv der Albert-Ludwigs-Universität, 79085 Freiburg Inhaltsverzeichnis Vorbemerkungen .................................................................................................................................... 5 1. Persönliche Unterlagen .................................................................................................................... 14 1.1 Unterlagen zur Person ......................................................................................................... 14 1.2 Unterlagen zur Famillie ........................................................................................................ 15 1.3 Schule und Studium ............................................................................................................. 16 1.4 Militär und Referendariat .................................................................................................... 22 1.5 Lebenserinnerungen ............................................................................................................ 24 1.6 Familiengeschichte ............................................................................................................... 27 1.7 Reiseberichte........................................................................................................................ 30 1.8 Rundbriefe ...........................................................................................................................