Tegeler Fließ
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
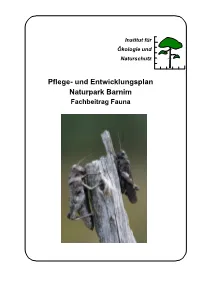
Fachbeitrag Fauna
Institut für Ökologie und Naturschutz Pflege- und Entwicklungsplan Naturpark Barnim Fachbeitrag Fauna Institut für Ökologie und Naturschutz Pflege- und Entwicklungsplan Naturpark Barnim Fachbeitrag Fauna erstellt im Auftrag der Landesumweltamtes Brandenburg Abt. Großschutzgebiete Tramper Chaussee 2 16225 Eberswalde Bearbeiter: Ingo Brunk unter Mitwirkung von: Silke Haack, Detlef Gebauer, Thomas Grewe Olivia Moritz (Avifauna) Andreas Reichling Udo Rothe (Fische) Eberswalde, Juni 2007 I Institut für . Ökologie und . PEP Naturpark Barnim Naturschutz . FB Fauna Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................ V Tabellenverzeichnis ................................................................................................................. V 1 Einleitung .................................................................................................................... 1 2 Fischotter und Biber .................................................................................................. 2 2.1 Datenlage ..................................................................................................................... 2 2.2 Verbreitung im Naturpark ............................................................................................ 2 2.2.1 Verbreitung des Fischotters (Lutra lutra) .................................................................... 2 2.2.2 Verbreitung des Elbebibers (Castor fiber) .................................................................. -
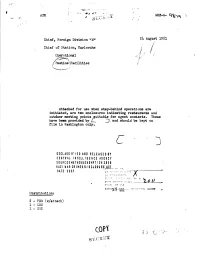
• (OP1 Si ,C1-R"T .L.A%
AIR MG —A— (A %-1 ) Chief, Foreign Division oll" 24 August 1951 . / Chief of . Station, Karlsruhe Operational. IPastime\Facilities Attached for use when star-behind operations are initiated, are two enclosures indicating restaurants and outdoor meeting points suitable for agent contacts. These have been provided by J. should be kept on file in Washington only. C DECLASS IF I ED AND RELEASED BY CENTRAL I NTELL IS ENCE AGENCY SOURCES METHOOSEX EHPT ION MO NAZI WAR CR IMES 01 SCLODURrADL.,,, DATE 20 07 • P'J! U1E104a___, t7.7 77; o Distributiont 2 - FDA (w/attach) 1 - COS 1 - BOB • (OP1 si ,C1-r"T .L.A% POINTS IN BERLIN SUITABLF, FOR OUTDOOR mtEmlis 1. Berlin-Britz Telephone booth in front of Post Office on the corner of . Chaussee Strasse and Tempelhofer Weg. 2. Berlin-Charlottenburg Streetcar stop for the line towards Charlottenburg in front Of S-Bahnhof Westend.. 3. Berlin-Friedenau Telephone booth on the corner of Handjery Strasse and Isolde Strasse (Maybach Platz). 4. Berlin-Friedrichsfelde Pillar used for posters on the corner of Schloss StrasSe and Wilhelm Strasse. 5. .Berlin=Friedrichshain Streetcar stop for line 65 in the direction of Lichtenberg located on Lenin Platz. 6. Derlin-Grffnau Final stop for bus lines A 36 and 38 in Grffnau. 7. Berlin-Gruneuald Ticket counter in S-Bahnhof Halensee. 8. Berlin-Heinersdorf Pillar used for posters on the corner of Stiftsweg and Dreite Strasse. 9. Berlin-Hermsdorf Ticket counter located inside S-Bahnhof Hermsdorf. 10. Berlin-Lankuitz Pillar used for posters on the corner of Marienfelde Strasse and Emmerich Strasse. -

FV Wannsee Tennis Borussia – SV Tasmania 7
#142 * 1€ * tebe.de 007.09.137.09.13 * BBerliner-Pilsner-Pokalerliner-Pilsner-Pokal * RRundeunde 1 TTennisennis BBorussiaorussia – FFVV WWannseeannsee 113.09.133.09.13 * BBerlin-Ligaerlin-Liga * 77.. SSpieltagpieltag TTennisennis BBorussiaorussia – SSCC SStaakentaaken SPONSOREN Hotel Steglitz International Umbro Trinity Music Berliner Pilsner AWOG Kunstpacker Betting Expert Tischlerei Leutloff Krügers Party Service Teamsponsor Physiomed 26 Tennis Borussia dankt seinen Sponsoren und Partnern! ANSTOSS Liebe Fans von Tennis Borussia, liebe Gäste! n der Meisterschaft finden die Schütz- die Besucher im Mommsenstadion wahrneh- linge von Chef-Coach Markus Schatte men dürfen. Mit dem Ende der Transferperiode Iimmer mehr zu ihrer Form. Ich freue konnten wir mit Moris Fikic, einen Mann für die mich, dass der im TeBelive! #140 verabredete linke Angriffsseite, verpflichten. Der Bosnier, der Deal zwischen Fans und Mannschaft so gut zuletzt bei Optik Rathenow unter Vertrag war, angenommen wird. Der Support zu den Heim- bringt es trotz seiner erst 22 Lebensjahre auf 23 und Auswärtsspielen sorgt nicht nur für famose Regionalliga- und 56 Oberliga-Einsätze (Rathe- Stimmung, sondern wird von der Mannschaft now und Hansa Rostock). Mit der Hansa-U19 dankbar aufgenommen. Die beiden letzten wurde er 2010 Deutscher Juniorenmeister im Spiele haben ja auch deutlich gemacht, dass Finale gegen Bayer Leverkusen. Wir wünschen da noch was geht, wenn es, wie gegen den ihm viel Erfolg mit den Veilchen. Nordberliner SC, auch schon fast aussichtslos Eine weitere Personalie ist noch zu vermelden. erscheint. Der Deal lebt – hier: anfeuern, da: Alexander Fritz hat aus privaten Gründen seine kämpfen bis zur neunzigsten Minute. Und Co-Trainer-Tätigkeit beendet. Für seinen jahre- manchmal ein bisschen länger .. -

September 2011 Heft Nr.115 31. Jahrgang
September 2011 Heft Nr.115 31. Jahrgang v. l.: „Hausmeister Krause“, 1. Vorsitzende S. Steinert, Pressewartin B. Samolarz, Jugendwart S. Behrendt Aus dem Inhalt: Vorstand Seite 4 Turnen und Gesundheitssport Seite 34 Prellball Seite 13 Impressum Seite 40 Handball Seite 20 Trainingszeiten des TSV Seite 41 Schach Seite 31 Anschriften des TSV Seite 46 Tischtennis Seite 32 - 2 - Herbstferien Vom 04.10. bis 14.10.2011 Montag, Mittwoch, Freitag 10 - 14 Uhr Dienstag, Donnerstag 14 - 18 Uhr TSV-Marienfelde 1890 e.V. Alte Feuerwache / Alt-Marienfelde 36 12277 Berlin Für Kinder ab 6 Jahre Wir basteln mit euch! Wir bieten Sport und Spiele an und organisieren Aktionstage für euch! Ihr könnt bei uns Frühstücken/Mittagessen! INFO: Tel.: 721 13 14 oder www.tsv-marienfelde.de Essen 1,- €, Obst und Gemüse 0,50€, Getränke und aufwändiges Bastelmaterial zum Einkaufpreis. Keine Voranmeldung nötig !!! Einfach reinschauen und mitmachen! - 3 - Vorstand Termine / Veranstaltungen bis Ende 2011 12.11. 14.00 h Prellball Bundesliga Männer, Geisbergstr., Schöneberg 11.12. Eislaufen der Jugend 4.12. 12 – 19 h Weihnachtsmarkt des TSV Marienfelde auf dem Vereinsgelände „Alte Feuerwache“ Veranstaltungen in Marienfelde an denen sich der TSV Marienfelde beteiligt: 7.9. 15 – 20.00 h Sommerfest in der ehem. ZAB (Zentrale Aufnahmestelle für Aussiedler), Marienfelder Allee/Ecke Stegerwaldstr. 17.9. 13 – 17.00 h Stadtteilfest 2011 in Marienfelde (veranstaltet vom Jugendamt Tempelhof-Schöneberg gemeinsam mit in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Organisationen und Einrichtungen) 24.9. 14 – 18.00 h Kiepertmeile, Kiepert-GS, Prechtlstr. Öffentlichkeitsarbeit Wir haben ja nun die Sommerferien gut hinter uns gebracht, doch vorher fand noch das Sommerfest statt, das dieses Jahr nicht von einer Hitzewelle geplagt wurde und daher auch besser besucht war. -

Fahrplan RB27
RB27 Groß Schönebeck / Schmachtenhagen > Basdorf > Berlin-Karow / Berlin Gesundbrunnen Touristinformationen im Überblick NEB-Kundencenter NEB A m gültig ab 15.12.2019 Tel. 030 396011-344 Die regionalen Tourist-Informationen ver mitteln [email protected], www.NEB.de Fahrtnummer 61040 61000 61042 61042 61002 61002 61044 61044 61080 61004 61004 61046 61082 61006 61048 61008 61050 61050 61010 61052 61052 61012 61054 61054 61014 61056 61056 61016 Stadt führungen und Unter künfte, haben Kontakte S+U Bahnhof Berlin-Lichtenberg Verkehrshinweis Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Sa+So Mo-Fr Sa+So Mo-Fr Sa+So Mo-Fr Mo-Fr Sa+So tägl. Mo-Fr tägl. tägl. tägl. Mo-Fr Sa+So tägl. Mo-Fr Sa+So tägl. Mo-Fr Sa+So tägl. Mo-Fr Sa+So tägl. und Infos zu lokalen Fahrrad- und Bootsverleihern, geben kulinarische Tipps, Auskünfte zu Veranstal- Weitlingstr. 15, 10317 Berlin Groß Schönebeck ab . 5.12 . 6.12 . 7.12 . 9.12 . 11.12 . tungs- und Besichtigungs terminen und vieles mehr. Mo-Fr 6.15–19 Uhr, Sa 8–14 Uhr Klandorf x . 5.15 . 6.15 . 7.15 . 9.15 . 11.15 . Ruhlsdorf-Zerpenschleuse x . 5.19 . 6.19 . 7.19 . 9.19 . 11.19 . Lottschesee x . 5.24 . 6.24 . 7.24 . 9.24 . 11.24 . Tourist-Information im Bahnhof Wandlitzsee Klosterfelde . 4.57 . 5.27 . 6.03 6.27 6.27 . 7.27 . 8.27 . 9.27 . 10.27 . 11.27 . 12.27 Bahnhofsplatz 2, 16348 Wandlitz Berlin Gesundbrunnen/Berlin-Karow O Wandlitzsee . 5.02 . 5.32 . 6.09 6.32 6.32 . -

Die Güterbahnhöfe Berlin-Schönholz Und Berlin-Hermsdorf
in-Schönholz und Berlin-Hermsdorf Ein bildreiches und verkehrshistorisches Buch über die beiden Reinickendorfer Güterbahnhöfe in Schönholz und Gleistod Hermsdorf mit den jeweiligen Anschlussbahnen zur Bun- desmonopolverwaltung für Branntwein an der Provinz- – straße und dem Gütergleis zum Bahnhof der NEB in Ber- lin-Wilhelmsruh sowie den Volta-Werken in Berlin- Die Güterbahnhöfe Waidmannslust. Berlin-Schönholz und Die bekannte Buchreihe „Gleistod – Ehemalige Gleise in Berlin-Reinickendorf“ wird mit diesem Buch erweitert und Berlin-Hermsdorf durch viele Informationen ergänzt. Berl Güterbahnhöfe Die sowie deren Anschlussgleise Ein Buch von Michael Bayer MICHAEL BAYER ISBN 978-3-9820299-4-8 Einzelpreis 39,90 EUR Den Gründern der Eisenbahnen in Berlin-Reinickendorf zur Ehre, den Freunden zur Erinnerung. Seite | 1 Originalausgabe 1. Auflage 2019 © Michael Bayer, Heiligental 11, 13437 Berlin (V.i.S.d.P) Alle Rechte vorbehalten. Dieses beinhaltet Urheber-, Urheberpersönlichkeits-, Marken-, Handelsaufma- chungs-, Patent- und Geschäftsgeheimnisrechte, Rechte zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb sowie andere Rechte an geistigem Eigentum und sonstige Eigentumsrechte. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile – auch auszugsweise - ist nur mit Zustimmung des Autors und Verlags erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil- mungen, sonstige fotomechanische Wiedergaben und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektro- nischen Medien. Sachliche, kritische Anmerkungen oder sonstige Hinweise sind gerne unter der E-Mail-Adresse [email protected] erbeten. ISBN: 978-3-9820299-4-8, Printed in Germany, Selbstverlag. Einzelpreis 39,90 EUR Bild Einband: 06. September 2009 – Güterschuppen in Hermsdorf mit dem Ladegleis in Richtung Waidmannslust. Bild Rückband: April 1986 – Die Lokomotive DR 106 267-8 fährt mit einem Bauzug durch den Güter- bahnhof Berlin-Schönholz. -

Morgen Statt 2030 – Neue Alte Wege Nach Basdorf Fotos/Montage: Bfvst
Titelthema i2030 aus: verkehrspolitische Zeitschrift SIGNAL 5-6/2018 (6. Januar 2018) Berliner Fahrgastverband IGEB Berliner Fahrgastverband IGEB www.igeb.org • [email protected] Tel. (030) 78 70 55 11 Berliner Fahrgastverband Morgen statt 2030 – neue alte Wege nach Basdorf Fotos/Montage: BfVst Dieses Projekt stellt eine Besonderheit dar, der Strecke existiert noch heute und wird Höhe von 22,1 Millionen Euro verantworten, denn im Gegensatz zu den anderen geht für Zubringerfahrten zum Werk Stadler die dann nahezu ungenutzt abgeschrieben es hier überwiegend um Infrastruktur, für Pankow genutzt. Für einen zügigen Regi- werden müssten. die nicht DB Netz verantwortlich zeichnet, onalverkehr muss diese jedoch ertüchtigt Es gibt allerdings noch eine weitere Hür- sondern die Niederbarnimer Eisenbahn AG werden, da die aktuell fahrbaren 30 km/h de. Zwar hatte Berlins Verkehrssenatorin (NEB). allenfalls für den Rangierverkehr zum Werk Regine Günther nach dem Lenkungskreis Einst startete die im Volksmund „Heide- und den historischen Ausflugsverkehr der am 18. Juni 2018 erklärt: „Auch die Planung krautbahn“ genannte Strecke vom Bahnhof Berliner Eisenbahnfreunde ausreichen. für eine Reaktivierung der Heidekrautbahn Reinickendorf-Rosenthal und fuhr über Bas- Ferner war die Verbindung zur Nordbahn läuft an, zunächst geht es dabei um die Teil- dorf nach Liebenwalde bzw. Groß Schöne- abgebaut worden und muss nun komplett strecke bis Wilhelmsruh, perspektivisch bis beck. Mit dem Mauerbau 1961 wurde die neu errichtet werden, wie auch ein neuer Gesundbrunnen. Das ist eine gute Nachricht Personenbeförderung auf dem Strecken- Regionalbahnhof am heutigen S-Bahnhof für Pendler im Norden Berlins und darüber abschnitt Wilhelmsruh—Schönwalde ein- Berlin-Wilhelmsruh. Für diesen Bahnhof hinaus.“ gestellt. liegt bereits ein Planfeststellungsbeschluss Den Beweis, dass auf die gute Nachricht Seit der Wende ist es erklärtes Ziel, die alte vor (s. -

Berlin Train Routemap Bergfelde Schönflieb MühlenbeckMönchmühle
Oranienburg Lehnitz Rüdnitz Borgsdorf Bernau Birkenwerder BernauFriedenstal Zepernick Hennigsdorf Hohen Neuendorf Röntgental Berlin Train Routemap Bergfelde SchönflieB MühlenbeckMönchmühle LastUpdate Nov.3.2020 Frohnau Heiligensee Buch Hermsdorf Schulzendorf Rathaus Waidmannslust Karow Reinickendorf Wittenau AltTegel Tegel Wilhelmsruh KarlBonhoeffer Nervenklinik Borsigwerke Eichborndamm AltReinickendorf Lindauer Allee Schönholz Blankenburg Holzhauser Strasse ParacelsusBad Otisstrasse Residenzstrasse PankowHeinersdorf FranzNeumannPlatz Schamweberstrasse Osloer Strasse KurtSchumacherPlatz Wollankstrasse Pankow Afrikanische Strasse Rehberge Nauener Platz Seestrasse Pankstrasse Leopoldplatz Bornholmer Strasse Wartenberg Ahrensfelde Amrumer Strasse Hohenschönhausen Mehrower Allee Haselhorst Rohrdamm Halemweg Beusselstrasse Westhafen Wedding Zitadelle Paulsternstrasse Siemensdamm JakobKaiserPlatz Gesundbrunnen RaoulWallenbergStrasse Schönhauser Allee Prenzlauer Allee Gehrenseestrasse Strausberg Nord Altstadt Spandau Greifswalder Jungfernheide Strasse Marzahn Voltastrasse Strausberg Stadt Humboldthain Rathaus Spandau Reinickendorfer Birkenstrasse Bernauer Strasse Poelchaustrasse Hegermühle Strasse Spandau Nordbahnhof Hönow Schwartskopffstrasse Rosenthaler Platz LouisLewinStrasse Oranienburger Mierendorffplatz Naturkundemuseum Strausberg Strasse Stresow Weinmeisterstrasse Hellersdorf Oranienburger Ruhleben Turmstrasse Landsberger Allee Springpfuhl Petershagen Nord Tor Westend Hackescher Markt Cottbusser Platz Pichelsberg OlympiaStadion -

Standesamtsbestände Im Landesarchiv Berlin
Standesamtsbestände im Landesarchiv Berlin Auflistung nach Reposituren - Stand April 2013 [* Fortexistenz, fortlaufende Übernahmen] Registerüberlieferung Repositur Standesamtsbezeichnung Grdg. Auflsg. Sprengel Heute zuständiges Standesamt Sterbe Heirat Geburt P Rep. 100 Tegel 1874 1948 Tegel Reinickendorf 1874 - 1948 1874 - 1932* 1874 - 1902* P Rep. 101 Tegel Schloss und Forst 1915 1921 Tegel Schloss und Forst Reinickendorf 1915 - 1921 1915 - 1921 P Rep. 102 Heiligensee 1904 1938 Heiligensee Reinickendorf 1904 - 1938 1904 - 1932* P Rep. 110 Wittenau 1874 1948 Wittenau Reinickendorf 1874 - 1948 1874 - 1932* 1874 - 1902* P Rep. 113 Hermsdorf 1902 1948 Hermsdorf Reinickendorf 1902 - 1948 1902 - 1932* 1902 - 1902* P Rep. 114 Frohnau 1912 1938 Frohnau Reinickendorf 1912 - 1938 1912 - 1932* P Rep. 116 Lübars-Waidmannslust 1902 1921 Lübars / Waidmannslust Reinickendorf 1902 - 1921 1902 - 1921 P Rep. 125 Reinickendorf-West 1920 1938 Reinickendorf-West Reinickendorf 1920 - 1938 1920 - 1931* P Rep. 130 Reinickendorf von Berlin 1874 * Reinickendorf Reinickendorf 1874 - 1982* 1874 - 1932* 1874 - 1902* P Rep. 150 Tempelhof 1874 2001 Tempelhof Tempelhof-Schöneberg 1874 - 1982* 1874 - 1932* 1874 - 1902* P Rep. 151 Mariendorf 1874 1942 Mariendorf Tempelhof-Schöneberg 1874 - 1942 1874 - 1932* 1874 - 1902* P Rep. 152 Marienfelde 1874 1942 Marienfelde Tempelhof-Schöneberg 1874 - 1942 1874 - 1932* 1874 - 1890 P Rep. 153 Lichtenrade 1919 1942 Lichtenrade Tempelhof-Schöneberg 1919 - 1942 1919 - 1932* P Rep. 160 Schöneberg I 1874 1938 Schöneberg Tempelhof-Schöneberg 1874 - 1937 1874 - 1932* 1874 - 1902* P Rep. 161 Schöneberg II 1911 1938 Schöneberg Tempelhof-Schöneberg 1911 - 1938 1911 - 1932* P Rep. 162 Friedenau 1888 1938 Friedenau Tempelhof-Schöneberg 1888 - 1938 1888 - 1932* 1888 - 1902* P Rep. 163 Schöneberg von Berlin 1938 2001 Schöneberg Tempelhof-Schöneberg 1938 - 1982* P Rep. -

Drucksache 17 / 13 450 Schriftliche Anfrage
Drucksache 17 / 13 450 Schriftliche Anfrage 17. Wahlperiode Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Tim-Christopher Zeelen (CDU) vom 20. März 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. März 2014) und Antwort Problematik steigender Grundwasserstände im Bezirk Reinickendorf Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: Frage 1: Wie haben sich im Jahr 2013 die Grundwas- serstände im Monatsverlauf in den Ortsteilen (Borsigwal- de, Frohnau, Heiligensee, Hermsdorf, Lübars, Konrads- höhe, Märkisches Viertel, Reinickendorf, Tegel, Waid- mannslust und Wittenau) entwickelt? Antwort zu 1: Die Entwicklung der Grundwasserstän- de des Hauptgrundwasserleiters in den verschiedenen Ortsteilen ist an Grundwasserstandsganglinien kennzeich- nender Messstellen (s. Abb. 1 bis 9) dargelegt. Für die Ortsteile Lübars und Märkisches Viertel kön- nen diesbezüglich keine Informationen gegeben werden, da der Hauptgrundwasserleiter hier nicht flächenhaft bzw. nur in isolierten, relativ gering mächtigen Vorkommen ausgebildet ist. Zu berücksichtigen ist, dass in diesen Bereichen in Abhängigkeit von den Niederschlägen so genanntes Schichtenwasser, also oberflächennahes Grundwasser unabhängig vom Hauptgrundwasserleiter, auftreten kann. Für das so genannte Schichtenwasser, das beispiels- weise auch in größeren Bereichen der Ortsteile Frohnau, Waidmannslust und Wittenau vorkommen kann, sind jedoch keine Messwerte vorhanden. Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 13 450 Abb. 1: Grundwasserstandsganglinie an der Messstelle 807 in Borsigwalde Abb. 2: Grundwasserstandsganglinie an der Messstelle 176 in Frohnau 2 Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 13 450 Abb. 3: Grundwasserstandsganglinie an der Messstelle 340 in Heiligensee Abb. -

Primelstr. 12 16348 Wandlitz Tel. 033397/81860 Fax
der Primelstr. 12 16348 Wandlitz Tel. 033397/81860 Fax. 033397/81861 [email protected] Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort …………………………………………………………………………. 03 2 Leitbild und pädagogische Grundsätze…………………………………… 04 3 Umsetzung im Schulleben…………………………………………………… 06 3.1 Unterricht ………………………………………………………………. 06 3.1.1 Gestaltung des Unterrichts…………………………………………….. 07 3.1.2 Einsatz neuer Medien………………………………………………….. 07 3.1.3 Anfangsunterricht……………………………………………………….. 08 3.1.4 Förderung der Schülerinnen und Schüler……………………………. 09 3.1.5 Qualitätssicherung und Evaluation des Unterrichts…………………. 11 3.2 Schulleben 3.2.1 Streitschlichter / soziales Lernen …………………………………….. 13 3.2.2 Höhepunkte im Schuljahr ……………………………………………… 13 3.2.3 Fächerbezogene Veranstaltungen / Wettbewerbe / Olympiaden….. 14 3.2.4 Zusatzangebote………………………………………………………… 16 4 Kooperation und Öffnung nach außen……………………………………. 17 4.1 Zusammenarbeit mit den Eltern ……………………………………… 17 4.2 Zusammenarbeit mit dem Schulträger ………………………………. 17 4.3 Zusammenarbeit mit dem Hort ……………………………………….. 17 4.4 Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten ……………………….. 18 4.5 Zusammenarbeit mit den Grundschulen und weiterführenden Schulen ………………….. 18 4.6 Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern ………………. 18 5 Schulmanagement ……………………………………………………………. 20 5.1 Fortbildungskonzept …………………………………………………… 21 5.2 Vertretungskonzept …………………………………………………….. 21 5.3 Informationsfluss in der Schule ……………………………………….. 21 5.4 Gesundheit, Hygiene, Sicherheit ……………………………………... 21 5.5 Lehrerprofessionalität …………………………………………………. -

Auf Försters Wegen
reise tour Berliner Forsten, Thorsten Wiehle Auf Försters Wegen Im Norden und Osten Berlins Inhalt Vorwort Seite 4 Tipps zum Waldbesuch Seite 6 Das Mischwaldprogramm der Berliner Forsten Seite 160 Über die Berliner Wälder Seite 163 Register Seite 164 Impressum Seite 167 ZWISCHEN TEGELER FLIESS & VOM PLÄNTERWALD BIS ZU DEN BUCHER FORST MÜGGELSEEN Tour 1 Lübars – Arkenberge £ Seite 12 Tour 18 Plänterwald £ Seite 90 Tour 2 Karower Teiche £ Seite 17 Tour 19 Müggelsee £ Seite 95 Tour 3 Bucher Forst £ Seite 20 Tour 20 Teufelssee £ Seite 98 Tour 4 Revier Buch £ Seite 24 Tour 21 Revier Friedrichshagen £ Seite 102 Tour 5 Bucher Rieselfelder £ Seite 28 Tour 22 Krummendammer Heide Tour 6 Gorinsee £ Seite 34 £ Seite 108 Tour 7 Revier Gorin £ Seite 38 Tour 23 Köpenicker Bürgerheide £ Seite 110 Tour 24 Revier Rahnsdorf I £ Seite 114 Tour 25 Revier Rahnsdorf II £ Seite 117 Tour 26 Revier Rahnsdorf III £ Seite 120 RUND UM WANDLITZ & BIESENTHAL RUND UM DAHME & MÜGGELBERGE Tour 8 Drei-Seen-Tour £ Seite 44 Tour 27 Zum Müggelturm £ Seite 126 Tour 9 Revier Arendsee £ Seite 48 Tour 28 Revier Teufelssee £ Seite 130 Tour 10 Prendener Bauernheide £ Seite 52 Tour 29 Langer See £ Seite 134 Tour 11 Revier Ützdorf £ Seite 56 Tour 30 Revier Müggelheim £ Seite 138 Tour 12 Lanke – Basdorf £ Seite 62 Tour 31 Müggelheimer Forst I £ Seite 142 Tour 13 Wanderweg Hellsee £ Seite 66 Tour 32 Müggelheimer Forst II £ Seite 144 Tour 14 Biesenthaler Becken £ Seite 70 Tour 33 Revier Fahlenberg £ Seite 148 Tour 15 Probstheide £ Seite 76 Tour 34 Revier Grünau £ Seite 152 Tour 16 Revier Albertshof £ Seite 79 Tour 35 Revier Schmöckwitz £ Seite 156 Tour 17 Willmersdorfer Heide £ Seite 82 2 3 VORWORT VORWORT Gorin kann man mit ein bisschen Glück das Wild Der Berliner Wald hat beobachten ist, das in der freien Wildbahn nur sel- rund um die Uhr geöff- 29 000 Hektar Wald … net, … Eintritt frei … zu ten so zu sehen ist.