Der Dokumentarische Propagandafilm Im Nationalsozialismus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

36 Biel the Place of Polish Films.Pdf
http://dx.doi.org/10.18778/8088-266-9.03 Urszula Biel The Place of Polish Films on German market between 1920s and 1930s, with special emphasis on Borderlands In the last few years there were few publications on Polish-German film collaboration during the interwar period, especially regarding years 1934–1939 when these mutual relations served political agenda.1 Special emphasis has been put on coproduction and distribution of Ger- man films in Poland. This paper considers reverse side of these relations, which is the presence of Polish films in Germany during the interwar period. The main source for this study will be the diplomatic and governmental cor- respondence of both countries during the mentioned period. In order to situate the place of Polish cinema in Weimar Republic and the Third Reich one must keep in mind huge disproportions between the two cinematographies, in both qualitative and quantitative terms. In 1918 Ger- many was second film industry in the world market, with the production of 340 films,2 whereas slowly developing Polish branch reached only seven mov- ies.3 During the next few years these numbers changed, but the proportions still reflected great differences in the potential of both cinematographies. Af- ter the World War I many countries boycotted German films. As a response the government of Weimar Republic blocked import of these states national production. German cinematography not only survived almost three years of isolation, but ended up more powerful than before. In order to fulfill the pro- grammes of cinema theatres the production of national cinema increased from 470 films in 1919 to 510 in 1920.4 In 1921 Berlin opened up to other countries movies, but finding way to Reich’s screens was still very difficult. -

The Film Music of Edmund Meisel (1894–1930)
The Film Music of Edmund Meisel (1894–1930) FIONA FORD, MA Thesis submitted to The University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy DECEMBER 2011 Abstract This thesis discusses the film scores of Edmund Meisel (1894–1930), composed in Berlin and London during the period 1926–1930. In the main, these scores were written for feature-length films, some for live performance with silent films and some recorded for post-synchronized sound films. The genesis and contemporaneous reception of each score is discussed within a broadly chronological framework. Meisel‘s scores are evaluated largely outside their normal left-wing proletarian and avant-garde backgrounds, drawing comparisons instead with narrative scoring techniques found in mainstream commercial practices in Hollywood during the early sound era. The narrative scoring techniques in Meisel‘s scores are demonstrated through analyses of his extant scores and soundtracks, in conjunction with a review of surviving documentation and modern reconstructions where available. ii Acknowledgements I would like to thank the Arts and Humanities Research Council (AHRC) for funding my research, including a trip to the Deutsches Filminstitut, Frankfurt. The Department of Music at The University of Nottingham also generously agreed to fund a further trip to the Deutsche Kinemathek, Berlin, and purchased several books for the Denis Arnold Music Library on my behalf. The goodwill of librarians and archivists has been crucial to this project and I would like to thank the staff at the following institutions: The University of Nottingham (Hallward and Denis Arnold libraries); the Deutsches Filminstitut, Frankfurt; the Deutsche Kinemathek, Berlin; the BFI Library and Special Collections; and the Music Librarian of the Het Brabants Orkest, Eindhoven. -
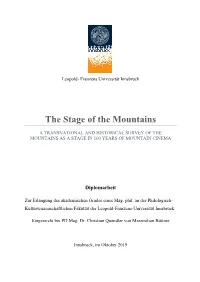
The Stage of the Mountains
Leopold- Franzens Universität Innsbruck The Stage of the Mountains A TRANSNATIONAL AND HISTORICAL SURVEY OF THE MOUNTAINS AS A STAGE IN 100 YEARS OF MOUNTAIN CINEMA Diplomarbeit Zur Erlangung des akademischen Grades eines Mag. phil. an der Philologisch- Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Eingereicht bei PD Mag. Dr. Christian Quendler von Maximilian Büttner Innsbruck, im Oktober 2019 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides statt durch meine eigenhändige Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die vorliegende Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Magister- /Master-/Diplomarbeit/Dissertation eingereicht. ______________________ ____________________________ Datum Unterschrift Table of Contents Acknowledgments .................................................................................................................... 4 Introduction .............................................................................................................................. 1 Mountain Cinema Overview ................................................................................................... 4 The Legacy: Documentaries, Bergfilm and Alpinism ........................................................... 4 Bergfilm, National Socialism and Hollywood -

Download (PDF)
PRESSEMAPPE Titel: Bring ‘em Back Alive, USA 1932, Clyde E. Elliott, Design: Pentagram BRANDSPUREN - FILMPLAKATE AUS DEM SALZSTOCK 28. NOVEMBER 2019 BIS 31. MAI 2020 DEUTSCHE KINEMATHEK – MUSEUM FÜR FILM UND FERNSEHEN www.deutsche-kinemathek.de Brandspuren – Filmplakate aus dem Salzstock 28. November 2019 bis 31. Mai 2020 Fakten Titel Brandspuren – Filmplakate aus dem Salzstock Laufzeit 28. November 2019 - 31. Mai 2020 Ort Museum für Film und Fernsehen im Filmhaus am Potsdamer Platz Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin Öffnungszeiten Mittwoch bis Montag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr Dienstag geschlossen Feiertage siehe: www.deutsche-kinemathek.de Tagesticket 8 € regulär, 5 € ermäßigt, 2 € Schüler, 8 € kl. und 16 € gr. Familienticket 5 € Gruppenticket, freier Eintritt donnerstags ab 16 Uhr Fahrverbindungen S-/U-Bahn Potsdamer Platz, Bus M48, M85, 200, 300 Varian-Fry-Straße Informationen T +49 (0)30 300903-0, F +49 (0)30 300903-13 E-Mail: [email protected] www.deutsche-kinemathek.de/besuch/ausstellungen www.facebook.com/MuseumfuerFilmundFernsehen www.twitter.com/de_kinemathek www.instagram.com/deutsche_kinemathek Fläche Etage 4, Filmhaus Führungen Öffentliche, mit den Kuratoren, „Zu Gast!“, siehe S. 4 Ausstellung Thematische Gliederung: Geschichte des Reichsfilmarchivs, Sicherung von Kulturgut / Filmaufnahmen von der Einfahrt in das Bergwerk Grasleben (Blackbox) / Restaurierte Filmplakate und Zensurmaterialien Exponate Plakate: 24 restaurierte Filmplakate von 22 Titeln internationaler und nationaler Produktionen aus den -

The Social Ecologies of the Bergfilm
humanities Article Image, Environment, Infrastructure: The Social Ecologies of the Bergfilm Seth Peabody Seth Peabody, Carleton College, One North College Street, Northfield, MN 55057, USA; [email protected] Abstract: The German mountain film (Bergfilm) has received extensive critical attention for its political, social, and aesthetic implications, but has received remarkably little attention for its role in the environmental history of the Alps. This article considers the Bergfilm within the long history of depictions of the Alps and the growth of Alpine tourism in order to ask how the role of media in environmental change shifts with the advent of film. The argument builds on Verena Winiwarter and Martin Knoll’s model of social-ecological interaction, Adrian Ivakhiv’s theoretical framework for the environmental implications of film, and Laura Frahm’s theories of filmic space. Through an analysis of Arnold Fanck’s films Der heilige Berg [The Holy Mountain, Fanck 1926] and Der große Sprung [The Great Leap, Fanck 1927], which are compared with Gustav Renker’s novel Heilige Berge [Holy Mountains, Renker 1921] and set into the context of the environmental history of the Alpine regions where the films were shot, the author argues that film aesthetics serve as a creative catalyst for environmental change and infrastructure development. While some ecocinema scholars have Citation: Peabody, Seth. 2021. Image, argued that environmental films teach viewers new ideas or change modes of behavior, this analysis Environment, Infrastructure: The suggests that film aesthetics are most effective at accelerating processes of environmental change that Social Ecologies of the Bergfilm. are already underway. Humanities 10: 38. -

200 Da-Oz Medal
200 Da-Oz medal. 1933 forbidden to work due to "half-Jewish" status. dir. of Collegium Musicum. Concurr: 1945-58 dir. of orch; 1933 emigr. to U.K. with Jooss-ensemble, with which L.C. 1949 mem. fac. of Middlebury Composers' Conf, Middlebury, toured Eur. and U.S. 1934-37 prima ballerina, Teatro Com- Vt; summers 1952-56(7) fdr. and head, Tanglewood Study munale and Maggio Musicale Fiorentino, Florence. 1937-39 Group, Berkshire Music Cent, Tanglewood, Mass. 1961-62 resid. in Paris. 1937-38 tours of Switz. and It. in Igor Stravin- presented concerts in Fed. Repub. Ger. 1964-67 mus. dir. of sky's L'histoire du saldai, choreographed by — Hermann Scher- Ojai Fests; 1965-68 mem. nat. policy comm, Ford Found. Con- chen and Jean Cocteau. 1940-44 solo dancer, Munic. Theater, temp. Music Proj; guest lect. at major music and acad. cents, Bern. 1945-46 tours in Switz, Neth, and U.S. with Trudy incl. Eastman Sch. of Music, Univs. Hawaii, Indiana. Oregon, Schoop. 1946-47 engagement with Heinz Rosen at Munic. also Stanford Univ. and Tanglewood. I.D.'s early dissonant, Theater, Basel. 1947 to U.S. 1947-48 dance teacher. 1949 re- polyphonic style evolved into style with clear diatonic ele- turned to Fed. Repub. Ger. 1949- mem. G.D.B.A. 1949-51 solo ments. Fel: Guggenheim (1952 and 1960); Huntington Hart- dancer, Munic. Theater, Heidelberg. 1951-56 at opera house, ford (1954-58). Mem: A.S.C.A.P; Am. Musicol. Soc; Intl. Soc. Cologne: Solo dancer, 1952 choreographer for the première of for Contemp. -

Personenbezogene Unterlagen Aus Der Zeit Des Nationalsozialismus
Personenbezogene Unterlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das Bundesarchiv in Berlin und seine Bestände, insbesondere des ehemaligen amerikanischen Berlin Document Centers (BDC) Täglich erreichen das Bundesarchiv in Berlin zahlreiche familiengeschichtlich orientierte Anfragen nach personenbezogenen Unterlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Motive, welche hinter einer solchen Anfrage stecken können, sind keineswegs homogen und unterscheiden sich doch in vielen Fällen von denen des Genealogen. Diese Tatsache ist zum einen den hier verwahrten relevanten Dokumenten selbst geschuldet, die mit denen eines Personenstandsarchivs nicht vergleichbar sind. Andererseits ist das besondere Interesse an diesen Unterlagen dem besonderen Stellenwert dieser historischen Epoche und der bis heute aktuellen öffentlichen Diskussion um die Aufarbeitung jenes kurzen, aber signifikanten Zeitabschnittes in der deutschen Geschichte geschuldet. “Der Genealoge” erinnert sich daran, daß doch wohl jeder “deutsche Volksgenosse” bzw. jedes NSDAP- Mitglied seine “arische” Abstammung zu erbringen hatte und begibt sich auf die Suche nach einem Archiv, welches diese “Ariernachweise” wünschenswerterweise zentral überliefert hätte. Eine nicht geringe Anzahl von Anfragen resultiert jedoch aus persönlicher Betroffenheit und ist getrieben von der Frage, an welcher Position und in welchem Grade die eigenen Vorfahren in das System des Nationalsozialismus verstrickt waren oder gar durch ihr individuelles Verhalten gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Inwiefern das Bundesarchiv in der Lage ist, die genannten Hoffnungen und Erwartungen im Einzelfalle zu erfüllen, soll hier exemplarisch in einer inhaltlichen Abgrenzung des Themas auf die Zeit des “Dritten Reiches” von 1933 - 1945 und bezogen auf das Bundesarchiv in Berlin dargestellt werden. Dabei ist klarzustellen, daß es die oft angefragte “Zentrale Archivierung von Ariernachweisen” nie gegeben hat. -

Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism By
Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism by Nicholas Walter Baer A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Film and Media and the Designated Emphasis in Critical Theory in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Anton Kaes, Chair Professor Martin Jay Professor Linda Williams Fall 2015 Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism © 2015 by Nicholas Walter Baer Abstract Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism by Nicholas Walter Baer Doctor of Philosophy in Film and Media Designated Emphasis in Critical Theory University of California, Berkeley Professor Anton Kaes, Chair This dissertation intervenes in the extensive literature within Cinema and Media Studies on the relationship between film and history. Challenging apparatus theory of the 1970s, which had presumed a basic uniformity and historical continuity in cinematic style and spectatorship, the ‘historical turn’ of recent decades has prompted greater attention to transformations in technology and modes of sensory perception and experience. In my view, while film scholarship has subsequently emphasized the historicity of moving images, from their conditions of production to their contexts of reception, it has all too often left the very concept of history underexamined and insufficiently historicized. In my project, I propose a more reflexive model of historiography—one that acknowledges shifts in conceptions of time and history—as well as an approach to studying film in conjunction with historical-philosophical concerns. My project stages this intervention through a close examination of the ‘crisis of historicism,’ which was widely diagnosed by German-speaking intellectuals in the interwar period. -

Cinema and the Swastika
Cinema and the Swastika October-2010 MAC/CIN Page-i 9780230_238572_01_prexxiv Also by Roel Vande Winkel NAZI NEWSREEL PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR Also by David Welch NAZI PROPAGANDA: The Powers and the Limitations PROPAGANDA AND THE GERMAN CINEMA 1933–45 THE THIRD REICH: Politics and Propaganda HITLER: Profile of a Dictator October-2010 MAC/CIN Page-ii 9780230_238572_01_prexxiv Cinema and the Swastika The International Expansion of Third Reich Cinema Edited by Roel Vande Winkel and David Welch October-2010 MAC/CIN Page-iii 9780230_238572_01_prexxiv © Editorial matter, selection, introduction and chapter 1 © Roel Vande Winkel and David Welch, 2007, 2011 All remaining chapters © their respective authors 2007, 2011 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No portion of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any licence permitting limited copying issued by the Copyright Licensing Agency, Saffron House 6-10 Kirby Street, London EC1N 8TS. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The authors have asserted their rights to be identified as the authors of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published in hardback 2007 and this paperback edition 2011 by PALGRAVE MACMILLAN Palgrave Macmillan in the UK is an imprint of Macmillan Publishers Limited, registered in England, company number 785998, of Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS. -

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) Permalink https://escholarship.org/uc/item/0hq1924k Author Zelechowski, Jamie Publication Date 2017 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Germanic Languages by Jamie Leigh Zelechowski 2017 © Copyright by Jamie Leigh Zelechowski 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) by Jamie Leigh Zelechowski Doctor of Philosophy in Germanic Languages University of California, Los Angeles, 2017 Professor Todd S. Presner, Co-Chair Professor Roman Koropeckyj, Co-Chair My dissertation investigates the cinematic representation of forced migration (due to the border changes enacted by the Yalta and Potsdam conferences in 1945) in East Germany, West Germany, and Poland, from 1945–1970. My thesis is that, while the representations of these forced migrations appear infrequently in feature film during this period, they not only exist, but perform an important function in the establishment of foundational national narratives in the audiovisual sphere. Rather than declare the existence of some sort of visual taboo, I determine, firstly, why these images appear infrequently; secondly, how and to what purpose(s) existing representations are mobilized; and, thirdly, their relationship to popular and official discourses. -

Tim Bergfelder
Chapter 1 INTRODUCTION: GERMAN-SPEAKING EMIGRÉS AND BRITISH CINEMA, 1925–50: CULTURAL EXCHANGE, EXILE AND THE BOUNDARIES OF NATIONAL CINEMA Tim Bergfelder Britain can be considered, with the possible exception of the Netherlands, the European country benefiting most from the diaspora of continental film personnel that resulted from the Nazis’ rise to power.1 Kevin Gough- Yates, who pioneered the study of exiles in British cinema, argues that ‘when we consider the films of the 1930s, in which the Europeans played a lesser role, the list of important films is small.’2 Yet the legacy of these Europeans, including their contribution to aesthetic trends, production methods, to professional training and to technological development in the film industry of their host country has been largely forgotten. With the exception of very few individuals, including the screenwriter Emeric Pressburger3 and the producer/director Alexander Korda,4 the history of émigrés in the British film industry from the 1920s through to the end of the Second World War and beyond remains unwritten. This introductory chapter aims to map some of the reasons for this neglect, while also pointing towards the new interventions on the subject that are collected in this anthology. There are complex reasons why the various waves of migrations of German-speaking artists to Britain, from the mid-1920s through to the postwar period, have not received much attention. The first has to do with the dominance of Hollywood in film historical accounts, which has given prominence to the -

Annette Deeken the Film Company Universal Pictures Advertised THE
Annette Deeken THE WHITE HELL OF PITZ PALU / DIE WEISSE HÖLLE VOM PIZ PALÜ The film company Universal Pictures advertised THE WHITE HELL OF PITZ PALU as 'The greatest thriller of the screen!' when it premiered in London on 10 June 1930. The version shown in London was accompanied by music written by the experienced film composer Guiseppe Becce while the original, produced by the German company Sokal, was released as a silent movie. DIE WEISSE HÖLLE VOM PIZ PALÜ, directed by Dr. Arnold Fanck and G.W. Pabst, was first screened in Vienna on 11 October 1929. The first screening in Germany took place in Berlin (15 November 1929) and the first French screening followed shortly on 13 December 1929. The film became an overnight success in German cinemas. More than 100,000 moviegoers went to see the picture in the following four weeks in Berlin's Ufa- Palast am Zoo-cinema (Horak 1997:39). The popularity of DIE WEISSE HÖLLE VOM PIZ PALÜ is further confirmed by several film statistics comparing the success of movies at the time. Specialist magazines such as Film-Kurier, Filmblätter and Film-Echo published the profitability of cinemas as well as their respective visitor numbers. They chronicle that DIE WEISSE HÖLLE VOM PIZ PALÜ was the second most successful movie of the 1929/30 season, being beaten to the top spot only by DIE FRAU IM MOND by Fritz Lang in the top ten movies of the year (Garncarz 1993:199). The German cinema, Ufa-Palast in Hamburg, at the time the largest film auditorium in Europe, with 2,667 seats, was inaugurated with this popular mountaineering drama.