Judenfriedhof.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verwaltungsgemeinschaft Dormitz Dormitz,13
Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/Stadt (mit Anschrift) Ort, Datum Verwaltungsgemeinschaft Dormitz Dormitz,13. Januar 2017 Sebalder Straße 12 91077 Dormitz B e k a n n t m a c h u n g Planfeststellung für die Verlegung der Staatsstraße 2243 "Effeltrich-Neunkirchen a. Brand" westlich Neunkirchen a. Brand von Bau-km 0+020 bis Bau-km 3+065 im Gebiet des Marktes Neunkirchen a. Brand sowie der Gemeinden Hetzles und Dormitz, Landkreis Forchheim, gemäß Art. 36 ff. des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) i.V.m. Art. 72 ff. des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) Das Staatliche Bauamt Bamberg hat für das o.g. Bauvorhaben bei der Regierung von Oberfranken die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach dem Bayer. Straßen- und Wegegesetz beantragt. Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Art. 37 BayStrWG. Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Kompensationsmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Neunkirchen a. Brand, Dormitz, Hetzles und Rosenbach beansprucht. Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt zur allgemeinen Einsicht aus bei (Anschrift der Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/Stadt, Zimmer-Nr.) Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Straße 12, 91077 Dormitz in der Zeit (von – bis) während der Dienststunden (von – bis) 16.01. bis 16.02.2017 Montag bis Mittwoch: 8:00 – 16:00 Uhr Donnerstag: 8:00 – 18:00 Uhr Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr Zudem wird der Plan zeitgleich zur öffentlichen Auslegung auf den Internetseiten der -
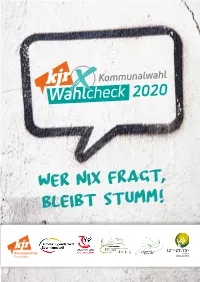
Wer NIX Fragt, Bleibt Stumm!
Kommunalwahl Wahlcheck 2020 WER NIX FRAGT, BLEIBT STUMM! Kreisjugendring Forchheim 2 Kommunalwahl Wahlcheck 2020 Die Landrats- und Bürgermeisterkandidat/-innen standen wieder im Mittelpunkt des „Wahlchecks zur Kommunalwahl 2020“, einer Aktion, die der Kreisjugend- ring Forchheim – vertreten durch den amtierenden Vorsitzenden Thomas Wil- fling – zusammen mit den Kommunalen Jugendpflegerinnen Ursula Albuschkat und Stefanie Schmitt initiiert hat. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit einem persönlichen Brief ein- geladen, an der Befragung teilzunehmen. Hierfür wurden unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Fragen gesammelt, die diese den Lokalpolitiker/-in- nen stellen wollten. Ebenfalls beteiligt waren die Delegierten der KJR-Vollver- sammlung als Vertreter/-innen der Vereine und Verbände. Zusammengekommen sind eine Vielzahl von Fragen, die Kinder und Jugendliche sowie Vereins- und Verbandsvertreter unseres Landkreises aktuell beschäftigen. Gemeinsam mit den Gemeindejugendpfleger/-innen der Städte und Gemeinden Ebermannstadt, Eggolsheim, Gräfenberg, Weißenohe, Hausen, Heroldsbach und Hallerndorf wurden acht Fragen ausgewählt, die stellvertretend für die vielen jungen Menschen im Landkreis Forchheim gestellt werden sollen. Bis Donnerstag, den 27. Februar 2020 bestand die Möglichkeit, die ausgefüll- ten Fragebögen an den KJR zurückzusenden. Die Ergebnisse aller Fragebögen wurden ungefiltert – also auch ohne Korrekturen – abgedruckt und sind seit dem 02. März 2020 unter www.kjr-forchheim.de der interessierten Öffentlich- keit zugänglich. Im Nachgang der Kommunalwahl 2020 möchten der Kreisjugendring und die Kommunalen Jugendpflegerinnen mit den gewählten Bürgermeister/-innen ins Gespräch kommen. Hierzu sind Besuche vor Ort geplant, um gemeinsam das The- ma Kinder und Jugendliche sowie die Jugendarbeit vor Ort zu beleuchten. Der Kreisjugendring und die Kommunalen Jugendpflegerinnen bedanken sich für die Unterstützung und freuen sich auf interessante Gespräche mit den zukünfti- gen Bürgermeisterkandidat/-innen und Landrat. -

Das Aktuelle Haus Lenk in Neunkirchen Am Brand
Das aktuelle Haus Und hier finden Sie uns: Das Baugebiet „südlich Tennenbachweg“ in Neunkirchen am Brand liegt im Westen des Ortes Richtung Erleinhof. Ein HOLZ BAU HAUS in Neunkirchen/Brand! Seit Oktober 2003 gibt es in 91077 Neunkirchen am Brand, Geisbergweg 11 ein HOLZ BAU HAUS . Das Foto zeigt das Haus in der von Erlangen/Dormitz von Gräfenberg/Eckental Bauzeit im Winter 2003/2004. Haussteckbrief • Planung und Entwurf HOLZ BAU HAUS Systemhaus 7, Von Erlangen folgen Sie der Staatsstraße 2240 Änderungen durch Anbau mit durch Buckenhof und Dormitz nach Neunkirchen. Einliegerwohnung Fahren Sie am Ortseingang geradeaus (Rewe • bleibt rechts liegen) bis die Vorfahrtsstraße Wohnfläche ca. 145qm zzgl. rechts abzweigt. Einliegerwohnung Hier biegen Sie links ab und danach die erste • Gründung: Betonpfähle und Straße rechts ins Neubaugebiet. Holzelementdecke, Kleinkeller mit Von Eckental und Kleinsendelbach aus biegen Haustechnikraum und Pelletlager Sie an der Staatsstraße 2240 rechts ab und • Satteldach, 50cm Kniestock fahren geradeaus (REWE bleibt rechts liegen) • Fassade Lärche unbehandelt wie oben beschrieben in das Neubaugebiet. • Von Forchheim biegen Sie vor dem Stadttor Pellet-Brenner mit rechts auf die Friedhofstraße ab und dann auf Nachheizbetrieb für Scheitholz, die Erleinhofer Straße. An der linksabknickenden solare Heizungsunterstützung Vorfahrt fahren Sie geradeaus und die nächste • Strahlungsheizung in Lehm rechts ins Neubaugebiet. natürlich -baubio -logisch GmbH Im Baugebiet die erste Rechts, das zweite Haus. Dirk Dittmar, Ulrich Bauer Baubiologische Beratungsstelle IBN Gute Fahrt! Planung, Energieberatung, Baustoffe Partner der HolzBauHaus GmbH Feuchter Str. 19, 90530 Wendelstein 09129 29 44 64 tel 09129 29 44 62 fax [email protected] www.natuerlich-baubiologisch.de ....und die Erfahrungen im eigenen Haus verwerten. -

Kommunale Partnerschaften Der Europäischen Metropolregion Nürnberg
Stadt Nürnberg Amt für Internationale Beziehungen Partnerkommunen von Städten, Gemeinden und Landkreisen in der Europäischen Metropolregion Nürnberg Stadt / Gemeinde Landkreis Partnerkommune Land Landkreis Adelsdorf Erlangen-Höchstadt, Uggiate Trevano Italien MFr Adelsdorf Erlangen-Höchstadt, Feldbach Österreich MFr Ahorn Coburg, OFr Irdning Österreich Ahorn Coburg, OFr Eisfeld Thüringen Allersberg Roth, MFr Saint-Céré Frankreich Altdorf b. Nürnberg Nürnberger Land, MFr Sehma Sachsen Altdorf b. Nürnberg Nürnberger Land, MFr Dunaharaszti Ungarn Altdorf b. Nürnberg Nürnberger Land, MFr Pfitsch Italien Altdorf b. Nürnberg Nürnberger Land, MFr Colbitz Sachsen-Anhalt Amberg kreisfrei, OPf Perigueux Frankreich Amberg kreisfrei, OPf Trikala Griechenland Amberg kreisfrei, OPf Desenzano del Garda Italien Amberg kreisfrei, OPf Bystrzyca Klodzka Polen Amberg kreisfrei, OPf Kranj Slowenien Amberg kreisfrei, OPf Usti nad Orilici Tschechien Amberg-Sulzbach Landkreis, OPf Canton Maintenon Frankreich Amberg-Sulzbach Landkreis, OPf Grafschaft Argyll Großbritannien Amberg-Sulzbach Landkreis, OPf Lkr. Sächsische Sachsen Schweiz Ammerndorf Fürth, MFr Dulliken Schweiz Ammerthal Amberg-Sulzbach, OPf Modiim Israel Ansbach kreisfrei, MFr Jingjiang China Ansbach Landkreis, MFr Jingjiang China Ansbach kreisfrei, MFr Anglet Frankreich Ansbach kreisfrei, MFr Fermo Italien Ansbach Landkreis, MFr Erzgebirgskreis Sachsen Ansbach Landkreis, MFr Mudanya Türkei Ansbach kreisfrei, MFr Bay City USA Arzberg Wunsiedel, Ofr Arzberg Österreich Arzberg Wunsiedel, Ofr Horní Slavkov -

Endbericht 2016
Tabellen Gebietskategorien nach LEP 2013 und nach RP 2011 Tabelle 1 LEP Bayern RP Oberfranken-West 3 1 Gemeinde Verd. Raum N/FÜ/ER Allgemein ländlicher Raum Mittelzentrum Allgemeiner ländl. Raum Verd. ZonenÄuß. Ländl. Teilr., dessen i. Entw. bes. Maße gestärkt werden Ländl. Teilr. i. R. gr. Verd. Umf. Mittelzentrum Mögliches Mittelzentrum Kleinzentrum Mittelbereich Nahbereich Entwicklungs- Achsen 2 Dormitz x x Erlangen Neunkirchen a.B. Ebermannstadt x x x x Forchheim Effeltrich x x Erlangen Neunkirchen a.B. Eggolsheim x x x Forchheim Hallerndorf üb.reg. Achse Egloffstein x x Nürnberg Gräfenberg Forchheim x x x x üb.reg. Achse Gößweinstein x x x Nürnberg Gräfenberg x x x Nürnberg Hallerndorf x x Forchheim Eggolsheim Hausen x x x4 Forchheim Forchheim üb.reg. Achse Heroldsbach x x x4 Forchheim Forchheim Hetzles x x Erlangen Neunkirchen a.B. Hiltpoltstein x x Nürnberg Gräfenberg Igensdorf x x x Nürnberg Gräfenberg Kirchehrenbach x x x5 Forchheim Forchheim Kleinsendelbach x x Erlangen Neunkirchen a.B. Kunreuth x x Forchheim Forchheim Langensendelbach x x Erlangen Neunkirchen a.B. Leutenbach x x Forchheim Forchheim Neunkirchen a.B. x x x Erlangen Obertrubach x x Nürnberg Gräfenberg Pinzberg x x Forchheim Forchheim Poxdorf x x Erlangen Neunkirchen a.B. Pretzfeld x x x5 Forchheim Ebermannstadt Unterleinleitner x x Forchheim Ebermannstadt Weilersbach x x Forchheim Forchheim Weißenohe x x Nürnberg Gräfenberg Wiesenthau x x Forchheim Forchheim Wiesenttal x x Forchheim Ebermannstadt Quelle: Regionalplan Oberfranken-West 1988 /17. Änderung 25.07.2011 4 zentrale Doppelorte Landesentwicklungsprogramm Bayern 20.06.2013 Raumstruktur Karte 1, Stand 25.07.2011 5 zentrale Doppelorte 1: Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen Nah- und Mittelbereiche Begründungskarte 1, zweite Änderung 1999 Im LEP sind keine Etwicklingsachsen mehr definiert. -

Augsburg-Druck- Ebook
JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST based on original vital records 1867 – 1940s researched and displayed by Rolf Hofmann + Herbert Immenkötter printed in 2018 1 CONTENT 3 Introduction 4 Necrology based on original Vital Records 110 Family Name Index 126 Maiden Name Index 131 Birth Place Index 140 Chronological Order of Grave Sites 141 Schematic Cemetery Map 146 Stonemason Max Koppel & Sons 147 Memorial of World War I Victims 149 Photo Gallery of Remarkable Graves 156 Biographical note on Rolf Hofmann 158 Biography of Herbert Immenkötter 159 Main Sources of Cemetery Research 160 Imprint 2 INTRODUCTION This necrology was originally compiled by the historic Jewish Community of Augsburg from 1867 (foundation of Augsburg Jewish cemetery at Haunstetter Strasse) until 1940 (end of Jewish Community) and also corresponds to the grave sites, as numbers of this necrology are the same as on gravestone backs, still legible today. Additional information comes from vital records of Community Registry Office. This grave list is published on the Alemannia Judaica website. Family history details were compiled in 2009 - 2011 by Rolf Hofmann together with Herbert Immenkötter. Of great help was Gernot Römer’s remarkable book “An meine Gemeinde in der Zerstreuung” (circular letters by Augsburg Rabbi Ernst Jacob 1941-1949) with family history details which otherwise we would not have been able to gather. This list is inevitably incomplete, it contains errors and does not cover all death cases of Augsburg Jewish families between the opening of the Augsburg Jewish cemetery (1867) and the liquidation of the Jewish community (ca 1940) because of limited available resources. However, there is a wealth of information on many Jewish families who then had lived in Augsburg - valuable for descendants, historians as well as genealogists. -

Radtouren in Der Fränkische Schweiz
Radfahren Themenradwege, Rundtouren und vieles mehr Mit großer Übersichtskarte Aktiv “Spielend radeln” durchs Leinleitertal Unter diesem Motto bietet sich eine 17 km lange Radstrecke ausgehend von Ebermannstadt (beim alten Wasserrad) durch das Wiesent- und das Lein- leitertal an. Sie ist besonders geeignet für Familien mit kleinen Kindern. Der sehr gut ausgebaute Radweg (größtenteils geteert) führt nach Heiligen- stadt und weiter über Burggrub nach Tiefenpölz. Er kann natürlich auch etappenweise genutzt werden. Neben dem großzügigen Erlebnis-Freibad in Ebermannstadt-Rothenbühl und dem neuen Natursee am Ortsrand von Heiligenstadt (Richtung Burggrub) finden sich entlang der Strecke zahlreiche Kinderspielplätze. Siehe auch: www.fraenkische-schweiz.com/sport/rad/rad_spielend.html www.fraenkische-schweiz.com Burgenstraße-Radweg Casanovas Ausritt Er kommt aus Nürnberg, beginnt im Bereich der Fränkischen Schweiz in Erleben Sie die Fränkische Schweiz mit ihren kulturellen und geologischen Schätzen. Neunkirchen am Brand und führt durch die beteiligten Mitgliedsgemeinden. Start ist in Bayreuth. Über Speichersdorf- Creußen- Pegnitz- Betzenstein- Gräfenberg- Die einzelnen Etappen des 108 km langen Abschnittes sind: Ebermannstadt- Gößweinstein- Waischenfeld- Mistelgau; 184 Kilometer, ca. 2000 Neunkirchen am Brand - Forchheim: 16 km Höhenmeter, 3-4 Tage; Forchheim - Ebermannstadt: 14 km Landschaftlich sehr schöne Tour: vom Fuße des Fichtelgebirges durch den Velden- Ebermannstadt - Muggendorf: 8 km steiner Forst in die romantischen Täler der Fränkischen Schweiz. Muggendorf - Sachsenmühle - Gößweinstein: 8 km Sehenswertes: Gößweinstein - Pottenstein: 7 km Donndorf-Eckersdorf: Schloss Fantaisie / Gartenkunstmuseum. Mistelbach (Vari- Pottenstein - Waischenfeld: 8 km ante): Hirtenfelsen, Bartholomäuskirche. Pittersdorf (Variante): Heimatmuseum Waischenfeld - Aufseß: 12 km Hummel-Stube. Mistelgau: Pfarrkirche; Obernsees: St. Rupertus-Kapelle, Jakobus- Aufseß - Heiligenstadt: 8 km kirche mit Barockgarten, Therme Obernsees, tägl. -

Herzlich Willkommen!
Herzlich willkommen! Bürgerbegehren „Pro Ehrenamt“ Antrag • „Mit schriftlichem Antrag vom 4. Oktober 2018 begründet zweiter Bürgermeister Fuchs die nach seiner Auffassung notwendige Änderung der Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters“ (Mitteilungsblatt 25/18) • Keine Information dazu bei der Bürgerversammlung am 12. November Bürgerbegehren „Pro Ehrenamt“ Antrag • Zur Ladung der Gemeinderatssitzung vom 22. November wird als Tagesordnungspunkt „7. Satzung über die Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters; Beschlussfassung“ angekündigt • Antrag & Satzung selbst werden nicht verteilt • Finanzielle Auswirkungen werden nicht dargelegt, selbst in der Sitzung erfolgt keine Angabe von den Antragstellern oder der Verwaltung Bürgerbegehren „Pro Ehrenamt“ Diskussion & Beschluss im Gemeinderat • Als Begründung für den Antrag wird die Über- lastung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters durch Termine & Besprechungen in- und außerhalb der Gemeinde genannt • Neu auf die Gemeinde übertragene Aufgaben werden angeführt aber nicht benannt • Verantwortung für 40 Mitarbeiter („in der VG“) wird behauptet Bürgerbegehren „Pro Ehrenamt“ Diskussion & Beschluss im Gemeinderat • Mehr Gemeinden diskutierten über einen hauptamtlichen 1. Bgm • Die von den CSU Gemeinderäten dargelegten Kosten werden bestritten • Weder Befürworter noch Verwaltung äußern Zahlen • Der Antrag wird mit 10 zu 5 beschlossen Bürgerbegehren „Pro Ehrenamt“ Arbeitsaufwand: Projekte In letzten Jahrzehnten bzw. Wahlperioden war keine Überlastung erkennbar Neue Aufgaben ab 2014? Fehlanzeige • Sanierung -

Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin Landkreis Forchheim
Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin Landkreis Forchheim Teilnehmende Kliniken: Klinikum Forchheim Klinik Fränkische Schweiz GmbH Krankenhausstraße 10 Feuersteinstraße 2 91301 Forchheim 91320 Ebermannstadt Tel. 0 91 91 / 61 02 22 Tel: 0 91 94 / 55 - 0 [email protected] [email protected] www.klinikumforchheim.de www.klinik-fraenkische-schweiz.de Individuelle Rotationsmöglichkeiten in folgende Gebiete: • Innere Medizin (Kardiologie, Akutgeriatrie, geriatrische Rehabilitation) • Chirurgie (Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie) • Anästhesiologie / Intensivmedizin • Frauenheilkunde und Geburtshilfe • Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Teilnehmende Fachärzte für Allgemeinmedizin: Dr. med. Cordula Braun-Quentin Dormitz 0 91 34 / 99 78 70 Medizinische Genetik Dr. med. Gabriele Brütting Pottenstein 0 92 43 / 70 14 88 - 0 Betriebsmedizin, Naturheilverfah- ren, Phlebologie [email protected] www.dr-bruetting.de Dr. med. Theresia Dittmann Eggolsheim 0 95 45 / 94 44 44 Dr. med. Hans-Jürgen Dittmann Dr. med. Heidrun Höppner Dr. med. Bernd Feustel Gräfenberg 0 91 92 / 99 28 80 www.hausarztpraxis-graefenberg. Dr. med. Michaela Gruber de Dr. med. Thomas Fiermann Forchheim-Kers- 0 91 91 / 6 66 22 www.schuback-fiermann.de bach Heroldsbach Dr. med. Karsten Forberg Neunkirchen am 0 91 34 / 9 96 30 Akupunktur Dr. med. Peter Walter Brand [email protected] www.praxisforberg-walter.de Andreas Gerhardt Ebermannstadt 0 91 94 / 85 85 Chirotherapie Dr. med. Detlef Hollatz Weilersbach 0 91 91 / 9 63 83 Chirotherapie, Naturheilverfahren Dr. med. Joachim Mörsdorf Pretzfeld 0 91 94 / 7 37 10 Phlebologie, Psychotherapie Sina Herschel Dr. med. Reinhard Niebler Kunreuth 0 91 99 / 2 37 Manuelle Medizin / Chirotherapie, Sportmedizin Dr. med. Christoph Pilz Neunkirchen am 0 91 34 / 6 01 Betriebsmedizin, Naturheilverfah- Brand ren, Sportmedizin, Umweltmedizin Dr. -

Wirtschaftsstandort Landkreis Forchheim Leben – Arbeiten – Unternehmerin Sein Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsstandort Landkreis Forchheim Leben – Arbeiten – UnternehmerIn Sein Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................................3 Ein Standort zum Leben - Arbeiten - UnternehmerIn Sein .....................................4 Unser Regionalmanagement ........................................................................................6 Wirtschaftsförderung im Landkreis Forchheim ........................................................7 Wir gestalten die Zukunft - Faszination Industrie BorgWarner Ludwigsburg GmbH .......................................................................................8 Gebr. Waasner Elektrotechnische Fabrik GmbH ................................................................9 Hofmann GmbH ................................................................................................................10 Kennametal Produktions GmbH & Co. KG .......................................................................11 Liapor GmbH & Co. KG .....................................................................................................12 NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG .............................................................................13 Piasten GmbH...................................................................................................................14 Schumacher Packaging GmbH & Co. KG .........................................................................15 Siemens Healthineers AG -

Necrology Jewish Cemetery Augsburg at Haunstetter Strasse (1867-1940) Version 04
NECROLOGY JEWISH CEMETERY AUGSBURG AT HAUNSTETTER STRASSE (1867-1940) VERSION 04 For family name index + further cemetery details check www.alemannia-judaica.de/augsburg_friedhof.htm Adult death cases were noted from Jewish vital records Augsburg - volume 3 (State Archive Augsburg) This necrology was originally compiled by the historic Jewish Community of Augsburg from 1867 (foundation of Augsburg Jewish cemetery at Haunstetter Strasse) until 1940 (end of Jewish Community) and also corresponds to the grave sites, as numbers of this necrology are the same as on gravestone backs. Family history details were compiled in 2009 - 2011 by Rolf Hofmann ( [email protected] ) together with Prof Dr Herbert Immenkoetter and in close cooperation with Yehuda Schenef, who has created a special grave list of this cemetery, based on the actually still legible grave inscriptions. This list now has also become part of our website. Of great help was Gernot Roemer’s book “An meine Gemeinde in der Zerstreuung” (circular letters by Augsburg Rabbi Ernst Jacob 1941-1949) with family history details which otherwise we would not have been able to gather. MAIN SOURCES = Family history details basically were gathered from Jewish vital records of Bavarian Swabia as holdings of State Archive Augsburg. Other sources are mentioned in brackets as AAZ = Augsburger Abendzeitung (newspaper obit), ANN = Augsburger Neueste Nachrichten (newspaper obit), ANC = Ancestry.Com (genealogical website), ATJ = Aron Taenzer - Geschichte der Juden in Jebenhausen und Goeppingen, ATH -

RP265 Schwierz.Pdf
The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP) PHOTO COLLECTION OF ISRAEL SCHWIERZ – P 265 Israel Schwierz was born in 1943 in Frankenberg, today Niemodlin (Poland) and attended schools in Poland and the German Democratic Republic. After volunteer military service in the West German army he studied education. From 1969 till 1977 he was a teacher in Kitzingen and from 1977 to 1997 in Würzburg. In 1997 Schwierz became the headmaster of a school in Arnstein. Israel Schwierz is a longstanding member of the Jewish Community of Würzburg, where he served as a board member for more than 8 years. Since 1994 he has been a lay leader and teacher of religion, at the Jewish American military community of Würzburg. Since 1977 Israel Schwierz has conducted intensive research on Jewish roots in Bavaria and Thuringia, which resulted in 3 books (mentioned at the end of this list). For years Israel Schwierz has been giving lectures in various circles and has been working for several Jewish press organs as well. The photographs in this collection were taken by Israel Schwierz during the years 1980-1995 for his studies on vestiges of the Jewish presence (mainly cemeteries and synagogues), first in Germany and later in other European countries, mainly Poland. In most cases there are several similar photos of the same item. Most of the photos are black & white and there are many very similar photos in the collection. In addition to the photographs, there are numerous negatives in the collection, not all of which were printed. PHOTOS (P 265/1 – 58, 182 - 218) Rec.