Burckhardt Et Al., 2003
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beiträge Zur Insekteufauna Der DDR: Lepidoptera — Crambidae
j Beitr. Ent. • Bd. 23 • 1973 • H. 1 -4 • S. 4 -5 5 - Berlin Institut für Pflaiizenscliutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der D D R zu Berlin Zweigstelle Eberswalde Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI) Ebersw alde Gü n t h e r Pe te r se n , Gerrit F r ie se & Gü n th er R in n h o eer Beiträge zur Insekteufauna der DDR: Lepidoptera — Crambidae Mit 42 Figuren und 51 Farbabbildungen1 Inhalt E in le itu n g ......................................................................................................................... 5 Artenbestand ................................................................................................................... 5 Zoogeograpbische A n alyse ......................................................................... ............ 7 Ökologie ............................................................................................................................. s8 Bestimnumgstabelle ................................................................................................. 11 Systeuiatiseh-fannistiscbes Verzeichnis der Gattungen und Arten 2 0 Verzeichnis (Checklist) der Crambxden der D D R .................................. 50 L it e r a t u r .......................................................................................................................... 53 In d ex ................................................................................................................................... 5 4 Einleitung Im Gegensatz zu den meisten anderen -

The Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin As a Refuge of the Moths (Lepidoptera: Heterocera) Within the City
Acta Biologica 23/2016 | www.wnus.edu.pl/ab | DOI: 10.18276/ab.2016.23-02 | strony 15–34 The Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin as a refuge of the moths (Lepidoptera: Heterocera) within the city Łukasz Dawidowicz,1 Halina Kucharczyk2 Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland 1 e-mail: [email protected] 2 e-mail: [email protected] Keywords biodiversity, urban fauna, faunistics, city, species composition, rare species, conservation Abstract In 2012 and 2013, 418 species of moths at total were recorded in the Botanical Garden of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The list comprises 116 species of Noctuidae (26.4% of the Polish fauna), 116 species of Geometridae (28.4% of the Polish fauna) and 63 species of other Macrolepidoptera representatives (27.9% of the Polish fauna). The remaining 123 species were represented by Microlepidoptera. Nearly 10% of the species were associated with wetland habitats, what constitutes a surprisingly large proportion in such an urbanised area. Comparing the obtained data with previous studies concerning Polish urban fauna of Lepidoptera, the moths assemblages in the Botanical Garden were the most similar to the one from the Natolin Forest Reserve which protects the legacy of Mazovian forests. Several recorded moths appertain to locally and rarely encountered species, as Stegania cararia, Melanthia procellata, Pasiphila chloerata, Eupithecia haworthiata, Horisme corticata, Xylomoia graminea, Polychrysia moneta. In the light of the conducted studies, the Botanical Garden in Lublin stands out as quite high biodiversity and can be regarded as a refuge for moths within the urban limits of Lublin. -

Coleoptera and Lepidoptera (Insecta) Diversity in the Central Part of Sredna Gora Mountains (Bulgaria)
BULLETIN OF THE ENTOMOLOGICALENTOMOLOGICAL SOCIETY OF MALTAMALTA (2019) Vol. 10 : 75–95 DOI: 10.17387/BULLENTSOCMALTA.2019.09 Coleoptera and Lepidoptera (Insecta) diversity in the central part of Sredna Gora Mountains (Bulgaria) Rumyana KOSTOVA1*, Rostislav BEKCHIEV2 & Stoyan BESHKOV2 ABSTRACT.ABSTRACT. Despite the proximity of Sredna Gora Mountains to Sofia, the insect assemblages of this region are poorly studied. As a result of two studies carried out as a part of an Environmental Impact Assessment in the Natura 2000 Protected Areas: Sredna Gora and Popintsi, a rich diversity of insects was discovered, with 107 saproxylic and epigeobiont Coleoptera species and 355 Lepidoptera species recorded. This research was conducted during a short one-season field study in the surrounding areas of the town of Panagyurishte and Oborishte Village. Special attention was paid to protected species and their conservation status. Of the Coleoptera recorded, 22 species were of conservation significance. Forty-five Lepidoptera species of conservation importance were also recorded. KEY WORDS.WORDS. Saproxylic beetles, epigeobiont beetles, Macrolepidoptera, Natura 2000 INTRODUCTION INTRODUCTION The Sredna Gora Mountains are situated in the central part of Bulgaria, parallel to the Stara Planina Mountains The Sredna chain. Gora TheyMountains are insufficiently are situated instudied the central with partregard of toBulgaria, their invertebrate parallel to theassemblages. Stara Planina Mountains chain. They are insufficiently studied with regard to their invertebrate assemblages. There is lack of information about the beetles from Sredna Gora Mountains in the region of the Panagyurishte There is lack townof information and Oborishte about village. the beetles Most offrom the Srednaprevious Gora data Mountains is old and foundin the inregion catalogues, of the mentioningPanagyurishte the town mountain and Oborishte without distinct village. -

(Amsel, 1954) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) – a New Species for the Croatian Pyraloid Moth Fauna, with an Updated Checklist
NAT. CROAT. VOL. 30 No 1 37–52 ZAGREB July 31, 2021 original scientific paper / izvorni znanstveni rad DOI 10.20302/NC.2021.30.4 PSOROSA MEDITERRANELLA (AMSEL, 1954) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE, PHYCITINAE) – A NEW SPECIES FOR THE CROATIAN PYRALOID MOTH FAUNA, WITH AN UPDATED CHECKLIST DANIJELA GUMHALTER Azuritweg 2, 70619 Stuttgart, Germany (e-mail: [email protected]) Gumhalter, D.: Psorosa mediterranella (Amsel, 1954) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) – a new species for the Croatian pyraloid moth fauna, with an updated checklist. Nat. Croat., Vol. 30, No. 1, 37–52, 2021, Zagreb. From 2016 to 2020 numerous surveys were undertaken to improve the knowledge of the pyraloid moth fauna of Biokovo Nature Park. On August 27th, 2020 one specimen of Psorosa mediterranella (Amsel, 1954) from the family Pyralidae was collected on a small meadow (985 m a.s.l.) on Mt Biok- ovo. In this paper, the first data about the occurrence of this species in Croatia are presented. The previ- ous mention in the literature for Croatia was considered to be a misidentification of the past and has thus not been included in the checklist of Croatian pyraloid moth species. P. mediterranella was recorded for the first time in Croatia in recent investigations and, after other additions to the checklist have been counted, is the 396th species in the Croatian pyraloid moth fauna. An overview of the overall pyraloid moth fauna of Croatia is given in the updated species list. Keywords: Psorosa mediterranella, Pyraloidea, Pyralidae, fauna, Biokovo, Croatia Gumhalter, D.: Psorosa mediterranella (Amsel, 1954) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) – nova vrsta u hrvatskoj fauni Pyraloidea, s nadopunjenim popisom vrsta. -

Nota Lepidopterologica
©Societas Europaea Lepidopterologica; download unter http://www.biodiversitylibrary.org/ und www.zobodat.at Nota lepid. 22 (3): 212-226; 01.IX.1999 ISSN 0342-7536 Notes on some Western Palaearctic species of Bucculatrix (Gracillarioidea, Bucculatricidae) Wolfram Mey Museum für Naturkunde, Humboldt-Universität Berlin, Invalidenstraße 43, D-101 15 Berlin Summary. The type material of 12 species of Bucculatrix Zeller, 1839 deposited in the Museum für Naturkunde Berlin is revised. B. imitatella Herrich-Schäffer, [1855], and B. jugicola Wocke, 1877, are sunk in synonymy of B. cristatella (Zeller, 1839). Two other synonyms have been established: B. alpina Frey, 1870 = B. leucanthemella Constant, 1895, syn. n.; B. infans Staudinger, 1880 = B. centaureae Deschka, 1973, syn. n. The male genitalia of the species are figured. Lectotypes have been designated for 5 species. Zusammenfassung. Es wird das Typenmaterial von 12 Arten der Gattung Bucculatrix Zeller, 1839 revidiert, die sich im Museum für Naturkunde Berlin befinden. Zwei Namen stellten sich als neue Synonyme heraus: B. imitatella Herrich-Schäffer, [1855], syn. n. und B. jugicola Wocke, 1877, syn. n. von B. cristatella (Zeller, 1839). Zwei weitere Synonyme werden bekanntgemacht: B. leucanthemella Constant, 1895, syn. n. von B. alpina Frey, 1870 und B. centaureae Deschka, 1973, syn. n. von B. infans Staudinger, 1880. Für fünf Arten werden Lectotypen festgelegt. Résumé. Le matériel-type de 12 espèces du genre Bucculatrix Zeller, 1839, déposé au Museum für Naturkunde Berlin, a été révisé. Deux noms sont apparus comme étant de nouveaux synonymes: B. imitatella Herrich-Schäffer, [1855], syn. n. et B. jugicola Wocke, 1877, syn. n. de B. cristatella (Zeller, 1839). -

CURRICULUM VITAE Helen Alipanah (Phd) Iranian Research Institute Of
CURRICULUM VITAE Helen Alipanah (PhD) Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP) Assistant Professor in Animal Biosystematics Research Department of Insect Taxonomy (Deputy) P.O. Box 1454, Tehran 19395, Iran Tel: +98 21 22403012-16 Fax: +98 21 22402570 E-mail: [email protected]; [email protected] URL: www.iripp.ir Academic qualifications PhD (2010): Animal Biosystematics, School of Biology, College of Science, University of Tehran (Tehran- Iran); Thesis: "Phylogenetic study of the tribus Oxyptilini (Lepidoptera, Pterophoridae, Pterophorinae) based on the morphological data". MSc (1995): Zoology, Faculty of Science, Tehran University (Tehran-Iran); Thesis: "Taxonomical survey on worker ants of Tehran and aboard". BSc (1991): Zoology, Faculty of Science, Tehran University (Tehran-Iran). Research interests 1. Phylogenetic studies using morphological and molecular data. 2. Geometric Morphometrics. 3. Geographical Information System (GIS) and Distribution modeling. 4. Taxonomic survey on ant fauna of Iran Selected research projects 1. Faunistic study of the subfamily Pyralinae (Lepidoptera: Pyralidae) in Iran. 2016- 2017. 2. Faunistic study of the subfamilies Crambinae, Scopariinae, Acentropinae, Cybalomiinae, Glaphyriinae, Schoenobiinae (Lepidoptera: Crambidae) in Iran. 2014-2016. 3. Taxonomic study of the family Cossidae (Lepidoptera: Cossoidea) in Iran, mostly based on the specimens preserved in the Hayk Mirzayans Insect Museum. 2014- 2016. 4. Taxonomic study of the family Tineidae in Iran. 2011-2014. 5. Faunal study of the leaf miners of the families Gracillariidae, Lyonetidae and Bucculatricidae in subreagions two and three of agricultural divisions in Iran. 2009-2012. 6. Faunal Study of the family Tortricidae in Iran. 2004-2007. 7. Faunal Study of the superfamily Pterophoroidea in Iran. 2004-2006. -

Beiträge Zur Bayerischen Entomofaunistik 14: 25–29
Dieses PDF wird von der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Entomologen e.V.für den privaten bzw. wissenschaftlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung oder die Bereitstellung in einer öffentlichen Bibliothek oder auf einer website ist nicht gestattet. Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 14:25–29, Bamberg (2014), ISSN 1430-015X Die Braungelbe Leimkrauteule Conisania luteago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) hat jetzt auch Bayern erreicht! (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae) von Werner Wolf & Andreas Bischof Summary: First reliable records of Conisania luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) from Bavaria (Lower Franconia) are given. Possible origin and area expansion of this species within the last decades is shor tly discussed. Zusammenfassung: Es werden die ersten gesicherten Nachweise von Conisania luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) aus Bayern (Unterfranken) gemeldet. Die damit im Zusammenhang stehende Arealerweiterung dieser Art wird kurz dargestellt und diskutiert. Einleitung In den vergangenen zehn Jahren konnten in Bayern einige Schmetterlingsarten festgestellt werden, die vor- her nicht zum bayerischen Fauneninventar gehörten. Erwähnt seien hier nur Caradrina kadenii (Freyer, 1836) (Kratochwill, 2005; Sage, 2005), Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) (Wolf, 2010) oder aktuell Pieris mannii (Mayer, 1851) (Kratochwill, 2011). Deren Zuwanderung erfolgte entlang schon früher bekannter und für einige der genannten Arten auch „erwarteter“ Einwanderungswege. Umso überra- schender waren die Funde von Conisania luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775), über die hier be- richtet werden soll. Nachweis in Bayern Am 29.vi.2012 (1 ), 10.vii.2013 (2 ) und 16.vii.2013 (1 ) konnte der Zweitautor beim Lichtfang in seinem Garten in Bad Königshofen (Unterfranken) insgesamt vier Exemplare dieser Noctuide (Abb. 1) fan- gen. Auch nach dem äußeren Erscheinungsbild dürften die Tiere zur Nominatsubspecies und nicht zur mit- telrheinischen ssp. -

Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Ростовской Области
Эверсманния. Энтомологические исследования Eversmannia в России и соседних регионах. Вып. 17-18. 15. VI. 2009: 57–70 No. 17-18. 2009 А.Н. Полтавский 1, К.С. Артохин 2, Ю.А. Силкин 3 1г. Ростов-на-Дону, Ботанический сад Южного Федерального университета 2г. Ростов-на-Дону, ООО «Агролига России» 3г. Ростов-на-Дону, Ростовское отделение РЭО К фауне огнёвок (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Ростовской области A.N. Poltavsky, K.S. Artokhin, Y.A. Silkin. To the fauna of Pyralid and Crambid moths (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) of Rostov-on-Don Province. SUMMARY. Since 1978, during day- and night-time moth monitoring in Rostov-on-Don Province, 5397 ex. of 137 species Pyralidae and Crambidae were collected in 36 localities. Preliminary studies of S.N. Alpheraky [Алфера- ки, 1876] represented 63 species. The total list now includes 157 species of both families. Two species of Pyralidae (Phycitinae), Pempelia amoenella (Zeller, 1848) and Metallosticha argyrogrammos (Zeller, 1847), re reported from Russia for the first time. The most common and mass species are: Nomophila noctuella ([Den. & Schiff.]), Etiella zinckenella (Tr.), Aporodes floralis (Hb.), Euchromius ocellea (Hw.), Actenia brunnealis (Tr.), Homoeosoma nimbella (Dup.), Mecyna flavalis ([Den. & Schiff.]), Synaphe moldavica (Esp.), Pediasia luteella ([Den. & Schiff.]), Lamoria anella ([Den. & Schiff.]), Endotricha flammealis ([Den. & Schiff.]), Parapoynx stratiotata (L.), Hypsopygia costalis (F.), Calamotropha paludella (Hb.), Thisanotia chrysonuchella (Scop.), Agriphila tristella ([Den. & Schiff.]). Введение Для Ростовской области известен единственный список огнёвок, включающий 63 вида [Ал- фераки, 1876], причем часть указаний нуждается в уточнении. Особую актуальность изучение региональной фауны огнёвок имеет в связи с тем, что эта группа представляет весомую часть биоразнообразия, включает значительное число угрожаемых видов и индикаторов малонару- шенных природных комплексов [Большаков, 1999]. -

Description of Coleophora Oreiosella Baldizzone, Sp. N. And
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 ISSN: 2340-4078 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Baldizzone, G. Description of Coleophora oreiosella Baldizzone, sp. n. and new records on the distribution of some European Coleophoridae (Lepidoptera: Coleophoridae) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 47, no. 186, 2019, May-August, pp. 269-277 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45561111015 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 47 (186) junio 2019: 269-277 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 Description of Coleophora oreiosella Baldizzone, sp. n. and new records on the distribution of some European Coleophoridae (Lepidoptera: Coleophoridae) G. Baldizzone* Abstract A new species of the genus Coleophora Hübner, 1822, C. oreiosella Baldizzone, sp. n., known to be found only in the Sierra Nevada, Spain, is described. New data on the distribution of some European species are provided. The male of C. depunctella Toll, 1961, is shown for the first time. KEY WORDS: Lepidoptera, Coleophoridae, Coleophora, new species, new records, Europa. Descripción de Coleophora oreiosella Baldizzone, sp. n. y nuevos registros sobre la distribución de algunos Coleophoridae europeos (Lepidoptera: Coleophoridae) Resumen Se describe una nueva especie del género Coleophora Hübner, 1822, C. oreiosella Baldizzone sp. n., sólo conocida de Sierra Nevada, España. Se proporcionan nuevos datos sobre la distribución de algunas especies europeas. -
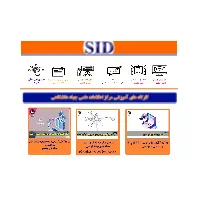
First Report of Bucculatrix Ulmifoliae (Lepidoptera, Bucculatricidae) from Iran
6758 ! 6. ! . 45 3 : ) ) ' 012 First report of Bucculatrix ulmifoliae (Lepidoptera, Bucculatricidae) from Iran. Eng. Sh. Maleki 1∗, Dr. V. Baniameri 2, Dr. H. Alipanah 2 and Dr. M. Shojaee 1. Dept. of Entomology, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran 1; Iranian Research Institute of plant protection, P. O. Box 19395-1454, Tehran, Iran 2. Corresponding author: [email protected] ∗. During a survey on the damaged elms in Almahdi, Shaghayegh, Taslihat and Magidiyeh parks in the summer of 2010, the larvae and pupae of a Bucculatrix species were collected. After emerging of the adult specimens, they were determined as Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931. As far as our knowledge, five Bucculatrix species are reported from Iran so far: Bucculatrix ulmella , 1848 which is reported on elm tree in Tehran region (1), B. pomifoliella Clemens, ?that is collected in Khorasan region on apple tree (7), and the three species namely B. iranica Deschka, 1981, B. endospiralis Deschka, 1981 and B. pectinella Deschka, 1981 which are collected from the south of Iran and introduced as new species by Deschka (1981) (2). This is the first report of Bucculatrix ulmifoliae from Iran. During recent years this species has caused extreme damages on the elm trees in some parts of Tehran. The genus Bucculatrix is cosmopolitan with more than 220 known species (3) mostly (about 180 species) distributed in the North American and Eurasia (6) B. ulmifoliae is widespread in all parts of Europe including The Netherlands, Germany, Austria, Czech Republic, Hungary, Italian mainlands, Macedonia, Poland, Romania, England, south and central parts of Russia, Sardinia, Sicily, Slovakia and Yugoslavia (4, 5). -

Additions, Deletions and Corrections to An
Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -

Bosco Palazzi
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 ISSN: 2340-4078 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Bella, S; Parenzan, P.; Russo, P. Diversity of the Macrolepidoptera from a “Bosco Palazzi” area in a woodland of Quercus trojana Webb., in southeastern Murgia (Apulia region, Italy) (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 46, no. 182, 2018, April-June, pp. 315-345 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45559600012 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 46 (182) junio 2018: 315-345 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 Diversity of the Macrolepidoptera from a “Bosco Palazzi” area in a woodland of Quercus trojana Webb., in southeastern Murgia (Apulia region, Italy) (Insecta: Lepidoptera) S. Bella, P. Parenzan & P. Russo Abstract This study summarises the known records of the Macrolepidoptera species of the “Bosco Palazzi” area near the municipality of Putignano (Apulia region) in the Murgia mountains in southern Italy. The list of species is based on historical bibliographic data along with new material collected by other entomologists in the last few decades. A total of 207 species belonging to the families Cossidae (3 species), Drepanidae (4 species), Lasiocampidae (7 species), Limacodidae (1 species), Saturniidae (2 species), Sphingidae (5 species), Brahmaeidae (1 species), Geometridae (55 species), Notodontidae (5 species), Nolidae (3 species), Euteliidae (1 species), Noctuidae (96 species), and Erebidae (24 species) were identified.