Das Januar-Hochwasser 2011 in Hessen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beteiligungsbericht 2017
MAIN-KINZIG-KREIS Beteiligungsbericht 2017 ® Aleksei Vasileika/123rf.com Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises Beteiligungsbericht 2017 Seit e 1 Main-Kinzig-Kreis IMPRESSUM Herausgeber: Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises Barbarossastraße 16 - 24 63571 Gelnhausen Telefon 06051/85-0 Ansprechpartner: Referat 6 - Beteiligungsmanagement (Jochen Hemmer) Druck: Main-Kinzig-Kreis, Hausdruckerei Stand: 15. Oktober 2018 Beteiligungsbericht 2017 Seit e 2 Main-Kinzig-Kreis VORWORT Sehr geehrte Leserinnen und Leser, vermutlich ist Ihnen häufig gar nicht bewusst, wie viele Leistungen der Main-Kinzig-Kreis über seine Unternehmen und Beteiligungen im Alltagsleben der Bürger erbringt. Ob es der Besuch eines Englischkurses in der Volkshochschule, der Aufenthalt im Krankenhaus, der schnelle Internetzugang oder auch die wohnortnahe Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in einem Seniorenzentrum ist, überall stehen häufig Unternehmen des Main-Kinzig-Kreises dahinter. Über 4.100 Mitarbeiter machen es sich täglich zum Ziel, die Einwohner des Main-Kinzig-Kreises mit Produkten und Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicher und möglichst wirtschaftlich zu versorgen. Mitunter auch dort, wo es für private Unternehmen wirtschaftlich nicht attraktiv ist, wichtige Leistungen für eine gute Infrastruktur anzubieten. Einen sichtbaren Beleg hierfür stellt die Strategie „Gesunde Kliniken 2020“ der Main-Kinzig-Kliniken dar. Nach Fertigstellung des Erweiterungsneubaus der Kinder- und Frauenklinik in 2017, konnte im August 2018 das Richtfest für das größte Bauvorhaben, der Erweiterungsneubau des Hauptgebäudes Haus A mit 6.500 qm zusätzlicher Fläche, gefeiert werden. Im Bereich der Bildung bietet der Bildungspartner Main-Kinzig mit dem Projektstart des Alpha mobil MKK gezielte Maßnahmen für Menschen mit funktionalem Analphabetismus. Dies ist immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, stellt die betroffenen Menschen aber durch die zunehmende Digitalisierung vor immer größere Herausforderungen. -

Zum Vorkommen Der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium Rivicola (LAMARCK 1818) in Darmstadt Mit Anmerkungen Zum Bestandsrückgang Von Sphaerium Corneum (LINNAEUS 1758)
29 Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 96 29 – 32 Frankfurt a. M., Januar 2017 Zum Vorkommen der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) in Darmstadt mit Anmerkungen zum Bestandsrückgang von Sphaerium corneum (LINNAEUS 1758) HASKO F. NESEMANN Abstract: The River orb mussel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) is recorded for the first time in Darmstadt from a small stream feeding several fish ponds. The rapid decline of S. rivicola and S. corneum (O. F. MÜLLER 1774) during the last decades is mentioned. Keywords: Sphaerium rivicola new record, S. corneum, rapid decline, Hesse. Zusammenfassung: Die Flusskugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) wurde neu für Darmstadt in einem sehr kleinen Fließgewässer nachgewiesen, das eine Kette von Teichen speist. Auf den raschen Bestands- rückgang von S. rivicola und S. corneum (O. F. MÜLLER 1774) in den letzten Jahrzehnten wird hingewiesen. Einleitung Die bekannte Verbreitung der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) in Hessen war auf die größeren Ströme und Flüsse Rhein, Main, Neckar, Lahn, Fulda und Werra begrenzt (KO- BELT 1871, JUNGBLUTH 1978). Die Art ist durch ihre Adultgröße und Gehäusemerkmale eindeutig von den anderen Arten der Gattung unterschieden (ZETTLER & GLÖER 2006). Unsichere Fundangaben sind dennoch verbreitet in der Literatur zu finden, weil junge und halbwüchsige S. rivicola häufig nicht erkannt und als S. corneum (LINNAEUS 1758) bestimmt bzw. besonders große „Mastformen“ der letzteren wegen ihrer Dimensionen mit S. rivicola verwechselt wurden. Bestandsentwicklung von Sphaerium rivicola in Südhessen In jüngster Vergangenheit haben die Bestände von S. rivicola in den südhessischen Flüssen trotz ver- besserter Wasserqualität stark abgenommen (NESEMANN 1984, 2014). Es kann ein direkter Zusam- menhang mit der explosiven Ausbreitung und Vermehrung der neozoischen Körbchenmuschel Corbi- cula fluminea (O. -
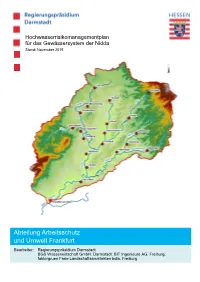
HWRM-Nidda-Langfassung.Pdf
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen - Übersicht Projektgebiet - -

Abteilung Arbeitsschutz Und Umwelt Frankfurt
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda - Kurzfassung - Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda – Kurzfassung Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen -

Bericht Zur Gewässergüte 2010
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Bericht zur Gewässergüte 2010 Die seit den 1970er Jahren verstärkt durchgeführten Abwasserreinigungsmaßnahmen von Städten, Gemeinden und Industrie führten zu enormen Verbesserungen des Gütezustands der Fließgewässer. Die aktuelle Gewässergütekarte 2010 zeigt, dass im Hinblick auf die Gewässergüte derzeit in 78 % der Gewässerabschnitte ein sehr guter oder guter ökologischer Zustand vorliegt. Auf einer Gesamtlänge von 1.780 km besteht in den Fließgewässern in Hessen jedoch noch ein Handlungsbedarf zur Minderung der organischen Belastung. Dezernat W1 Gewässerökologie - Dr. Mechthild Banning Dezernat Z4 Informationstechnik - Ute Helsper Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 1. EINLEITUNG 3 2. METHODIK 3 2.1 BEWERTUNG DER GEWÄSSERGÜTE 3 2.2 DATENGRUNDLAGE 5 2.3 ERSTELLUNG DER GEWÄSSERGÜTEKARTE 2010 6 3. ERGEBNISSE 8 4. ABHÄNGIGKEITEN BEI DER BEWERTUNG DES ÖKOLOGISCHEN ZUSTANDS IN DEN ZWEI MODULEN ALLGEMEINE DEGRADATION UND SAPROBIE 13 5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 20 6. ZUSAMMENFASSUNG 26 7. LITERATURVERZEICHNIS 28 8. ANHANG 28 8.1 GEWÄSSERGÜTEKARTE 29 8.2 PROZENTUALER ANTEIL ORGANISCH BELASTETER ABSCHNITTE INNERHALB DER EINZELNEN WASSERKÖRPER (2006 UND 2010) 30 Seite 2 von 37 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Einleitung Die Gewässergütedefizite und die Erfolge der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden in Hessen seit den 1970er Jahren in der biologischen Gütekarte dokumentiert. Die erste biologische Gütekarte wurde bereits 1970 erstellt. In unregelmäßigen Abständen (in den Jahren 1976, 1986, 1994, 2000, 2006 und nun 2010) wurde und wird diese Karte aktualisiert. Der Vergleich der Gütekarten dokumentiert dabei zum einen die Erfolge der getroffenen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, weist jedoch auch auf noch bestehende Gütedefizite hin. Mit der vorliegenden Gewässergütekarte wird ein Gesamtüberblick über die derzeitige organische Belastungssituation der Fließgewässer in Hessen gegeben. -

Bearbeitungsgebiet Main Bericht Zur Bestandsaufnahme
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Ge- sundheit und Verbraucherschutz Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Freistaat Thüringen Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) Bearbeitungsgebiet Main Bericht zur Bestandsaufnahme Koordinierungsbüro BAG Main am Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg Umsetzung der EU-WRRL Bestandsaufnahme BAG Main Inhaltsverzeichnis ZusammenfassungTU UT .................................................................................................................15 EinführungTU UT ..............................................................................................................................21 1TU UT AllgemeineTU Beschreibung des Bearbeitungsgebietes Main (BAG Main)UT ........................23 1.1TU UT UmsetzungTU der WRRL im BAG MainUT .......................................................................23 1.2TU UT Lage,TU naturräumliche BedingungenUT .........................................................................24 1.2.1TU UT FließgewässerlandschaftenTU UT ......................................................................................27 1.3TU UT RaumnutzungenTU UT .......................................................................................................28 1.4TU UT WasserbewirtschaftungTU UT ............................................................................................29 2TU -

Erläuterungen EJ 1857 (Pdf) (4.885Mb)
Geologische Specialkarte des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden Landesgebüfle im Maasstabe von 1350000. Herausgegeben VOR). mittelrheinischen geologischen Verein. Secfiun ßüüingen der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister—Stabs (Section Gelnhausen der topographischen Karte des Kurfürstenthums Hessen) geologisch bearbeitet VOD R. Ludwig, Inhaber des Kurf. Hess. Wilhelms-Ordens. Mit einem Höhenverzeichniss. Darmstadt, 1857. Hofbuchhandlung von G. Jonghaus. \. "//;Ä %äERLIU'I‘HECA \ ä amm A’CADEM:; \ GEORGIAE ; AUG. \____/.. Karten und Mittheilungen des mittelrheinischen geologischen Vereins. ___—___... %tulugifibt Speriullmrte des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden Landesgebiete. Section Büdingen-Gelnhausen. Darmstadt, 1857. Hofbuchhandlung von G. Junghans. Geologische Specialkarte des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden Landesgebüfle im Maasstabe von 1350000. Herausgegeben vom mittelrheinischen geologischen Verein. SeoHon ßüüingen der Karte des Grossh. Hess. General—Quartiermeister-Stabs (Section Gelnhausen der topographischen Karte des Kurfürstenthums Hessen) geologisch bearbeitet von B. Ludwig, Inhaber des Kurf. Hess. Wilhelms-Ordens. Mit einem Höhenverzeichniss. IA ”II. ”|. Darmstadt, 1857. Hofbuchhandlung von G. Junghans. Vo_rwort. Indem wir Namens des mittelrheinischen geologischen Vereins hiermit die dritte Section der geologischen Specialkarte der Oeffentlichkeit überge- ben, in gleichmässiger Ausführung wie die 1855 erschienene Section Fried- berg und die 1856 herausgegebene Section Giessen, erkennen -

Beteiligungen 2018.Cdr
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2018 Wetteraukreis Maschinenring Grafische Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse WEBIT Wetterau e.V. Stand 31.12.2018 Eigenbetrieb IT AWB 100% Kreisverwaltung Abfallwirtschaftsbetrieb (Kreisausschuss) Wetterauer Kreisbauern- Agrar Service verband GmbH Wetterau e.V. Sparkasse Oberhessen Büdingen OVAG GI Stadt VoBa Gießen- VB Bad Nauheim Friedberg eG Städte + Vogelsbergkreis Landkreis Gießen Gemeinden Heimat- und Ge- Wetterauer Evang. IHK Gießen- Gemeinde schichtsverein, 18 andere HBV Landwirt- 36 andere 54,55% Land Gemeinden Kirche Friedberg Glauburg Förderverein Gebietskörper- schaftliche Be- Gesellschafter 6,71% Keltenwelt Hessen schaften teiligungs GmbH Wirtschaft Wetterau e. V. 28,43% je 4,0% je 16,67% je 34,32% 100% 63,46% 22,55% 14,10% 36,54% 4,04% 63,35% je 33,33% 32,1% 25% 50,96% 17% 33,33% 51,7% 16,2% 94,21% 100% 56,86% 16,66% 5,79% 50% 50% 20% 46,3% 36,7% 16,66% TKB Region ZOV WAGG TRW WEAG ORD Integrations- Wirtschafts- Breitband- Zweckverband Stiftung Zweckverband WAUS GmbH Naturschutz- beteiligungs-GS Vogelsberg Wetterauer Tourismus Sprudelhof Wetterauer Oberhessische Kompostierung i. Insolvenz Stiftung förderung Stifung Oberhessische für Tierkörper- Wetterau GmbH Touristik achäolog. Gesell- Region Wetterau Bad Nauheim beseitigung Entsorgungs- Recycling Wetterau GmbH Wetterau Wetterau GmbH Wetterau GmbH Versorgungs- GmbH Anlagen GmbH Dienste GmbH betriebe schaft Glauberg Hessen-Süd Soziales je 9,09% Entsorgung Nidda 42,34% 65,68% Glauberg 6,66% Regionalpark Ballungsraum Stadt Gedern Ortenberg RheinMain gGmbH Breitband- 100% Büdingen Bad infrastruktur GS 31,25% Friedberg 3,704% Rhein-Main- Vilbel Vitos GmbH Oberhessen Verkehrsverbund GmbH mbH 0,863% Ekom21 - KGRZ Hessen OVVG OVVG-Konzern Nassauische Heimstätte erkehr 1,18% Oberhessische 0,016% 86,67% 12,15% Versorgungs- und Wohnungs- und Entwick- Kliniken des Verkehrsgesellschaft mbH lungsgesellschaft mbH Breitband- 0,347% Mittelhessische Wetteraukreises 26,41% Stadt Bad Nauheim Friedberg- beteiligungs-GS Energiegenossenschaft e.G. -

Natur. Erlebnis. Wetterau
Natur. Erlebnis. Wetterau Reizvolle Landschaften und sanfte Natur Gießen R6 R4 Wetzlar V A5 Lich o Laubach g A45 e l s b Schotten e Hungen r g Münzenberg R4 Butzbach 5 Rockenberg 10 6 Wölfers- Nidda Gedern Ober- heim 4 Echzell Mörlen Hirzenhain Keltenradweg 2 Ranstadt Bad Reichels- Nauheim heim Ortenberg Usingen R6 8 Friedberg 1 7 3 Glauburg Kefenrod A45 Rosbach Florstadt Keltenradweg 9 Wehrheim Büdingen R4 Altenstadt s Wöllstadt Niddatal n u Limeshain u Karben a Bad Homburg T Bad Orb A5 A66 Gelnhausen Bad Vilbel Langenselbold Hanau Frankfurt Gießen R6 R4 Erläuterungen Inhaltsverzeichnis Wetzlar V A5 Lich o Laubach g A45 e l s Parken Herzlich Willkommen 03 Schotten b e Bahnhof 1 Die Nidderauen von Stockheim 04 Hungen r g Bushaltestelle 2 Rund um das Bingenheimer Ried 06 Münzenberg R4 Radweg 3 Nachtweid von Dauernheim und Mähried von Staden 08 Butzbach 5 Rockenberg 10 Tipps 4 Fruchtbare Böden rund um die „Wetterauer Seenplatte“ 10 Wölfers- Gedern 6 Nidda Sehenswertes in der Nähe 5 Die Magerrasen bei Nidda 12 Ober- heim 4 Echzell Mörlen Hirzenhain 6 Keltenradweg Wetterauer Landgenuss Hinauf auf den Hausberg bei Butzbach 14 2 Ranstadt Bad Reichels- 7 Nauheim heim Ortenberg Vulkanradweg Kirschen in Ockstadt 16 Usingen R6 8 Friedberg 1 BahnRadweg Hessen 8 Rund um den Winterstein im Taunus 18 7 3 Glauburg Kefenrod A45 Keltenradweg 9 Unterwegs in Büdingen 20 Rosbach Florstadt 9 Keltenradweg Wehrheim Büdingen Bonifatius-Route 10 Der Kurpark von Bad Salzhausen 22 R4 Altenstadt Wöllstadt Niddatal Deutscher Limes-Radweg TourismusRegion Wetterau 24 u s Limeshain n Regionalparkroute Aktiv für die Wetterauer Naturschätze 26 u Karben a Bad Homburg T Bad Orb Lutherweg Die Wetterau – von Natur aus lecker. -

Flächennutzungsplan Der Stadt Büdingen
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT BÜDINGEN Umweltbericht zum Flächennutzungsplan Planungsstand März 2012 Planungsbüro Vollhardt Am Vogelherd 51 35043 Marburg Auftraggeber : Der Magistrat der Stadt Büdingen Eberhard Bauner Allee 16 63654 Büdingen Tel: 06042 / 884-0 Ansprechpartner: Bauamtsleiter Marth Bearbeitet durch: Planungsbüro Vollhardt Ing.-Büro für Bauwesen, Bauleitplanung und Land- schaftsplanung Am Vogelherd 51 35043 Marburg Tel: 06421 / 304 989-0 Fax: 06421 / 304 989-40 e-mail: [email protected] Umweltbericht zum FNP der Stadt Büdingen Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG .................................................................................................. 1 1.1 Anlass und Aufgabenstellung 1 1.2 Rechtsgrundlagen, planungsrechtliche Stellung und Verfahrensablauf 1 1.3 Methode, Gliederung und Aufbau der Umweltprüfung 2 1.4 Umweltziele gemäß Fachgesetzen und Fachplänen 3 1.5 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Flächennutzungsplans 4 2. BESTANDSDARSTELLUNG DER EINSCHLÄGIGEN UMWELTASPEKTE ........................................................................................ 6 2.1 Landschaft 6 2.2 Geologie und Boden 6 2.3 Wasser 7 2.4 Klima und Luft 10 2.5 Biotope, Pflanzen und Tiere 11 2.6 Mensch 19 2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 21 2.8 Nutzung erneuerbarer Energien – Energieeinsparung 24 2.9 Ver- und Entsorgung, Kreislaufwirtschaft 26 3 WIRKUNGSPROGNOSE – UMWELTAUSWIRKUNGEN GEPLANTER EINGRIFFE ....................................................................................................