Preussen Und Landschaft Tagungsdokumentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rond De Grenssteen, Winter 1988
NUMMER 8: WINTER 1988 ROND DE GRENSSTEEN EEN UITGAVE VAN DE STICHTING HEEMKUNDEKRING DE GRENSSTEEN MOOK - MIDDELAAR - MOLENHOEK Foto omslag: twee vrouwenkopjes, één van de prachtige schilderstukken van Dirk Ocker. Deze kunstenaar wist op geheel eigen, vaak mystieke wij- ze, sfeer te brengen in zijn composities. I. Pinckers-van Roosmalen A. Pinckers De Plasmolense Schilders Dirk Ocker (2) Dirk Ocker geloofde dat hij be- brengen. Ze deden geen dieren, lijk gelopen werd, tussen de spin- zig was met zijn laatste hoe klein ook, kwaad: geen spin, newebben door. Pauw hield er reïncarnatie-gang hier op aarde. geen mier, geen hond of kat of van in het bos te slapen, en ze We moeten hem dan ook probe- vogel. In huis waadde men als baadde zich geregeld in één van ren te zien in het licht van deze het ware door de spinnewebben; de drie meertjes. En dat in die overtuiging. Zo vond hij dat hij je kon precies zien waar gewoon- tijd! alleen te maken had met zijn op- dracht voor dit leven: schilderen. Dat deed hij met volle overgave zonder zich te storen aan welke kritiek dan ook. Hij werkte zo hard mogelijk om boven niet met lege handen aan te komen. Dit verklaart ook waarom hij niet graag werken verkocht. Verko- pen deed hij alleen als het letter- lijk broodnodig was. Het is opvallend dat de schilders die beïnvloed werden door de Theosofie allen anders werkten en tot verschillende conclusies kwamen. Mondriaan bijvoor- beeld werd abstract, tot op he- den nog bevreemdend voor een grote groep mensen. Dirk Ocker maakte mystiek, geheimzinnig, sfeer oproepend. -
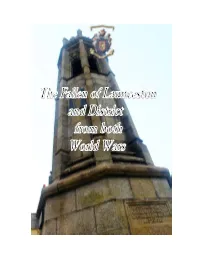
Launceston-And-Districts-Fallen-From-Both-World-Wars..Pdf
This is not a complete record of all those that fell during the two wars, with some of the fallen having no information available whatsoever. However there are 222 names from within the district that I have been able to provide a narrative for and this booklet hopefully will provide a lasting memory for future generations to view and understand the lives behind the names on the various memorials around Launceston. It has not been easy piecing together the fragments of information particularly from the first world war where many records were destroyed in the blitz of the second world war, but there are many resources now available that do make the research a little easier. Hopefully over time the information that is lack- ing in making this a complete story will be discovered and I can bring all the re- cords up to date. Of course there have been many people that have helped and I would like to thank Peter Bailey, Claudine Malaquin, Dennis Middleton, Jim Edwards, Martin Kel- land, Grant Lethbridge Morris and Michael Willis for their invaluable help in compiling this homage plus the resources that are freely available at Launceston Library. My hope is that the people will find this a fascinating story to all these souls that bravely gave their lives in the service of their country and that when we come to remember them at the various remembrance services, we will actually know who they were. Roger Pyke 28th of October 2014. Launceston’s Fallen from World War One William Henry ADAMS William was born in 1886 at 14 Hillpark Cottages, Launceston to Richard and Jane Adams. -

Einteilung Des Reichswaldes in 231 Rechteckige Abteilungen (Jagen)
Einteilung des Reichswaldes in 231 rechteckige Abteilungen (Jagen) Schlagwörter: Waldweg Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde Gemeinde(n): Bedburg-Hau , Gennep , Goch , Groesbeek , Kleve (Nordrhein-Westfalen), Kranenburg (Nordrhein-Westfalen) Kreis(e): Kleve (Nordrhein-Westfalen) Bundesland: Nordrhein-Westfalen Grenzstein am sogenannten "D-Gestell" (Rendevous) im Klever Reichswald (2012). Hier kreuzen sich die Jagenwege (Gestelle), die den Reichswald in Abteilungen aufgliedern. Fotograf/Urheber: Selter, Bernward Die alte quadratische Einteilung mit 117 Abteilungen von 1826 wurde von der Forstverwaltung als zu groß und unpraktisch empfunden und 1856 halbiert. Es gab seitdem 231 Abteilungen, deren Nummern bis 1994 auch auf der Topographischen Karte 1:25.000 abgebildet waren. An dem Punkt, wo jeweils vier nummerierte Abteilungen aneinander grenzten, sind Grenzsteine mit den jeweiligen Nummern gesetzt worden, von denen die meisten immer noch im Gelände anzutreffen sind. Beim Kartenvergleich der Uraufnahme von 1843 mit der Neuaufnahme von 1894 fällt wiederum auf, dass große Teile des herkömmlich gewachsenen Waldwegenetzes mit der Abteilungseinteilung wieder dargestellt sind. (Peter Burggraaff, Universtät Koblenz, 2013) Literatur Gorissen, Friedrich (1950): Heimat im Reichswald. Kleve. Huth, Klaus (1981): Zur Geschichte des Klever Reichswaldes unter besonderer Berücksichtigung der Waldeigentums- und Rechtsverhältnisse, der Waldnutzung sowie der Waldbewirtschaftung. Ein Beitrag zur regionalen Forstgeschichte. (Diplomarbeit Universität -

NIKK 2. Halbjahr 2010
Halbjährliche Zeitschrift für Mitglieder und Freunde Herbst / Winter 2010 des NABU Kreisverband Kleve e.V. – erscheint seit 1985. Naturschutz NiKK im Kreis Kleve Kreisverband Kleve e. V. Veranstaltungstermine von August 2010 bis Januar 2011 1. Streuobstwiesenfest im Kreis Kleve am 12.09.10 Wiesenbrüter in der Düffel: Kaum Bruterfolg Die Grüne Wüste Vierfleck-Libelle Foto: Norbert Mühldorfer Herbst / Winter 2010 Naturschutz NiKK im Kreis Kleve Kreisverband Kleve e. V. Grünaderweißling Foto: H.-J.Windeln NABU Kreisverband Kleve intern 4 1. Streuobstwiesenfest im Kreis Kleve 5 Nachlese zur Mitglieder- versammlung 2010 7 Neue Mitarbeiterin in der NABU-Station 8 ZÖPI-Leben in der NABU-Naturschutzstation Natur- und Umweltschutzpolitik 10 Die Grüne Wüste 13 Wiesenbrüter in der Düffel: Kaum Bruterfolg aufgrund mangelnder Schutzmaßnahmen 16 Wildwarnanlagen im Klever Reichswald – Fazit und Ausblick Natur im Kreis Kleve 18 Wo leben die „gefährlichen“ Ameisenlöwen? 36 Naturschutzjugend Issum 19 Kormoran-Exkursion ständig im Einsatz NABU kooperativ mit Zugabe 38 Gemüsequiz für clevere Kids 29 Ehrenamtsarbeit im 20 Libellen auf einer Wiese in Naturschutz – das Projekt Rund um Haus und Garten Issum-Sevelen Ehrenamtsmanagement 40 Schwalbenfreundliches Haus 22 Neues aus der Natur im Kreis 30 Wo die alten Sorten wohnen – in Warbeyen Kleve Das Gartenprojekt geht ins 42 Wie kann man eine Wildwiese NABU aktiv 2. Jahr anlegen? 25 Auf dem Weg zu mehr 34 Grünes Netzwerk Grenze Termine und Anschriften Fluss natur – LIFE+ belebt 35 Deutliche Bestandserholung der die Rheinaue 44 Wichtige NABU-Adressen Uferschnepfe in der Hetter und regelmäßige Treffen im 27 Ziegenkäse von Natur- NABU Kids aktiv Kreis Kleve schutzwiesen – eine erfolg- reiche Kooperation mit dem 36 NAJU- Kindergruppe Emmerich: 45 Veranstaltungsprogramm Rouenhof Noch Plätze frei Herbst / Winter 2010 NiKK 2 2010 3 NABU Kreisverband Kleve intern Obst bäu me. -

Kleve 02821/9797122 ~SOFORTBARGELD~ Bis Zu… € -Goldschmuck 55G -Zahngold-Platin-Palladium RISTORANTE PIZZERIA BACCO DUE SERVICE: - Trauringstudio HAFENSTR
Lieferservice ab 3.11.20 ROYAL GOLD Hagschestr.23 - Kleve 02821/9797122 ~SOFORTBARGELD~ bis zu… € -Goldschmuck 55g -Zahngold-Platin-Palladium RISTORANTE PIZZERIA BACCO DUE SERVICE: - Trauringstudio HAFENSTR. 32 · 47533 KLEVE , € TELEFON 0 28 21-121 88 - Gravuren Batteriewechsel… 75 WWW.BACCODUE.DE - Uhren und Schmuck Reparatur 50. WOCHE ZEITUNG FÜR KLE V E , KALK A R , BE D BURG-HAU UND KRANENBURG SAMSTAG 12. DEZEMBER 2020 Eine zauberhafte Weihnachtswelt „Corona-Beschlüsse müssen klar sein Mit „Fit durch den Arbeitsalltag“ im Freizeitpark „erfahren“ und dürfen Menschen nicht verwirren“ neue Perspektiven schaffen NN-Leser können Tickets für eine Rundfahrt Der Landtagsabgeordnete Dr. Günther Das Bildungsangebot des SOS-Kinderdorfs im Wunderland gewinnen. Seite 5 Bergmann (CDU) im NN-Interview. Seite 6 wird von den Jobcentern finanziert. Seite 9 POLIZEI _____________ Fachanwalt für ARBEITSRECHT Rechtsanwalt und Betriebswirt (IWW) Zu schnelles Fahren Fachanwalt für Insolvenzrecht | Fachanwalt für Arbeitsrecht gefährdet alle überall Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 47623 Kevelaer | Fon 02832 97 55 22 6 www.rahaupt.com Die Polizei plant zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wieder Geschwindigkeitskontrollen. Gemessen wird unter anderem heute in Geldern-Pont, am mor- gigen Sonntag in Bedburg-Hau, Montag in Twisteden, Dienstag in Rees-Millingen, Mittwoch in Geldern-Hartfeld, am kommen- den Donnerstag in Kranenburg- Wyler, am Freitag in Uedem- Keppeln und am Samstag, 19. Dezember, in Kalkar-Neulou- isendorf sowie Sonntag näch- ster Woche in Weeze. Darüber hinaus muss man mit weitere Kontrollen rechnen. KIRCHE ______________ Weihbischof Lohmann mit Corona infiziert Der Weihbischof des Bistums Münster für die Regionen Niederrhein und Recklinghau- Für Ingeborg Reinhardt hat Grammatik einen hohen Stellenwert. Vor knapp einem Jahr erschien ihr Buch – mittlerweile gibt es auch das sen, Rolf Lohmann, hat sich mit passende Spiel dazu. -

3839254167 Lp.Pdf
Niederrhein BIRGIT POPPE / KLAUS SILLA LIEBLINGSPLÄTZE zum Entdecken Niederrhein BIRGIT POPPE / KLAUS SILLA Sofern hier nicht aufgelistet, stammen alle Bilder von Klaus Silla: Joachim Lück, Goli-Verein S. 46; WeselMarketing GmbH S. 84; Privatarchiv der ›Rö- mischen Herberge‹ S. 98; Dr. Stefan Roggenbuck S. 140, S. 164, S. 176; SWK S. 168. Autoren und Verlag haben alle Informationen geprüft. Gleichwohl wissen wir, dass sich Gegebenheiten im Verlauf der Zeit ändern, daher erfolgen alle Angaben ohne Ge- währ. Sollten Sie Feedback haben, bitte schreiben Sie uns! Über Ihre Rückmeldung zum Buch freuen sich Autoren und Verlag: [email protected] Besuchen Sie uns im Internet: www.gmeiner-verlag.de Überarbeitete Neuauflage 2017 © 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch Telefon 0 75 75/20 95-0 [email protected] Alle Rechte vorbehalten Lektorat/Korrektorat: Katja Ernst/Claudia Reinert Satz: Julia Franze Umschlaggestaltung: U.O.R.G., Lutz Eberle, Stuttgart unter Verwendung eines Fotos von Klaus Silla Kartendesign: Mirjam Hecht Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten Printed in Germany ISBN 978-3-8392-5417-2 Eine Region der fließenden Grenzen /// Der Niederrhein .................................................10 KLEVE UND UMGEBUNG 1 Die ›Golden Gate‹ am Niederrhein /// Rheinbrücke in Emmerich ......................................17 2 Wo noch Wassergeister hausen /// Drususbrunnen in Elten ........................................19 3 ›Letzte Hallig vor Hooge‹ /// Kleve-Schenkenschanz ..........................................21 -

Het Klever Reichswald. Een Cultuurhistorische Wandeling Gratis
HET KLEVER REICHSWALD. EEN CULTUURHISTORISCHE WANDELING GRATIS Auteur: Ralf GГјnther Aantal pagina's: 72 pagina's Verschijningsdatum: none Uitgever: none EAN: 9789461480392 Taal: nl Link: Download hier geopaden op de stuwwal De Top van Limburg is rijk aan historie en heeft veel te vertellen. De langgerekte smalle vorm van het gebied is al veelzeggend. Deze smalle vorm was een voortvloeisel van het Congres van Wenen, na de val van Napoleon. De grens van het nieuwe koninkrijk der Nederlanden met het koninkrijk Pruisen kwam hier te liggen op een kanonschot afstand ten oosten van de Maas. De grote strategische betekenis van het gebied werd extra duidelijk op het einde van W. De regio is ook interessant vanwege zijn rijke spoor- en keramiekhistorie, maar vergeet ook de Romeinse tijd niet! Al deze cultuurhistorische bezienswaardigheden liggen in een gevarieerd landschap. Niet alleen de rivieren Maas en Niers bepalen het gezicht ervan. Ook de heuvels van de Maasduinen en het stuwwallandschap St. Jansberg, Mookerheide en Reichswald geven het landschap een afwisselingsrijk karakter. Deze landschappen, samen met het Brabantse Maasheggenlandschap, zorgen ervoor, dat de Top van Limburg zowel op het gebied van cultuurhistorie als van landschapshistorie veel te vertellen heeft. Ondanks deze bijzondere combinatie is het gebied relatief onbekend. Dat heeft meerdere oorzaken. Zoals Limburg wel eens als een stukje buitenland in Nederland wordt beschouwd, er dus niet helemaal bij hoort, zo ligt voor veel Zuid- en Midden- Limburgers de provinciegrens net boven Roermond. De bewoners van de Top van Limburg hebben zelf ook het gevoel dat ze niet helemaal bij Limburg horen o. Zijn ze wel Limburgers of zijn ze meer Brabanders of Gelderlanders? En voor de bewoners van Well voelde dit weer anders aan dan voor de bewoners van Molenhoek. -

INSEKTENSCHWUND UND PESTIZIDBELASTUNG in NATURSCHUTZGEBIETEN in Nordrhein-Westfalen Und Rheinland-Pfalz
1 | Foreword Forschungsbericht <<< INSEKTENSCHWUND UND PESTIZIDBELASTUNG IN NATURSCHUTZGEBIETEN in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz IMPRESSUM München, Dezember 2020 Forschungsbericht WECF e.V. München, Deutschland Author*innen: Jelmer Buijs, Buijs Agro-Services, Bennekom, Niederlande ([email protected]) Margriet Mantingh, WECF e.V., Deutschland ([email protected]) Rezensent*innen von Abschnitten dieses Berichts: Prof. Dr. Wolfgang Weisser, Abteilung für Ökologie und Ökosystemmanagement, Fakultät für Lebenswissenschaften Weihenstephan, Deutschland Dr. Francisco Sánchez-Bayo, Ehrenmitglied der Universität von Sydney, Australien Verena Demmelbauer, WECF e.V., Deutschland Fotos: Natasha Nozdrina, Margriet Mantingh und Jelmer Buijs Cover Design: Charlotte Aukema Diese Publikation wurde durch die Deutsche Postcode Lotterie sowie im Rahmen des Projekts Make Europe Sustainable for All mit Mitteln der Europäischen Kommission gefördert. Für den Inhalt dieser Publikation sind Women Engage for a Common Future e.V. (WECF) und Buijs Agro-Services verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben weder den Standpunkt der Deutschen Postcode Lotterie noch der Europäischen Kommission wieder. WECF e.V. St. Jakobs-Platz 10 80331 München Tel.: +49 89 23 23 938 0 www.wecf.org/de/ 3 | Content Inhalt Vorwort ....................................................................................................................................... 7 Danksagung ................................................................................................................................... -

INSECT DECLINE and PESTICIDE CONTAMINATION in NATURE CONSERVATION AREAS in North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate
1 | Foreword Research report <<< INSECT DECLINE AND PESTICIDE CONTAMINATION IN NATURE CONSERVATION AREAS in North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate Research report <<< INSECT DECLINE AND PESTICIDE CONTAMINATION IN NATURE CONSERVATION AREAS in North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate COLOFON Munich, December 2020 Research report WECF e.V. Munich, Germany Authors: Jelmer Buijs, Buijs Agro-Services, Bennekom, Netherlands ([email protected]) Margriet Mantingh, WECF e.V., Germany ([email protected]) Reviewers of sections of this report: Prof. Dr. Wolfgang Weisser, Department of Ecology and Ecosystem Management, School of Life Sciences Weihenstephan, Germany Dr. Francisco Sánchez-Bayo, Honorary Associate of The University of Sydney, Australia Verena Demmelbauer, WECF e.V., Germany Photographs: Natasha Nozdrina, Margriet Mantingh and Jelmer Buijs Design cover: Charlotte Aukema English language: Frans Verkleij This research was made possible by the generous financial support by the Deutsche Postcode Lotterie. Project FV 1610, timeframe 15 September 2019 – 30 December 2020. The contents of this publication are the sole responsibility of WECF e.V. and can under no circumstances be taken as reflecting the position of the Deutsche Postcode Lotterie. This publication has been produced with the financial assistance of the European Union, as part of the project ‘Make Europe Sustainable For All’. The contents of this publication are the sole responsibility of WECF e.V. and can under no circumstances be taken as reflecting -

Umweltbericht FNP Kleve 2020
UMWELTBERICHT – FNP KLEVE Umweltbericht zur erneuten Offenlage | 2020 Umweltbericht zur FNP-Neuaufstellung Kleve Auftraggeber: Stadt Kleve Fachbereich 61 - Planen und Bauen Minoritenplatz 1 47533 Kleve Projektleitung Umweltbericht: Willy-Brandt-Platz 4 44135 Dortmund Bearbeitung Dipl.-Ing. Markus Liesen (2011-2014) Landschaftsarchitekt AKNW Dipl.-Ing. Alexander Quante (2015-2020) Landschaftsarchitekt AKNW 01. Juli 2020 grünplan - büro für landschaftsplanung Umweltbericht zur FNP-Neuaufstellung Kleve Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG .................................................................................................................. 1 1.1 Planungsanlass ............................................................................................................ 1 1.2 Lage und Kurzcharakteristik der Flächennutzungssituation ................................... 2 1.3 Ziele und Inhalte des FNP ............................................................................................ 3 1.4 Leitlinien der FNP-Neuaufstellung .............................................................................. 5 1.5 Ergebnisse des Scoping-Termins ............................................................................... 5 1.6 Umweltrelevante Themenkomplexe im Zuge des Flächennutzungsplanverfahrens und des Umweltberichtes (Auswahl) ................. 7 2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND METHODISCHE VORGEHENSWEISE DER UMWELTPRÜFUNG .......................................................... 8 2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen ............................................................................... -

Zum Download
Gegenwind im Reichswald e.V. Tegenwind in het Reichswald Stadt Kleve Fachbereich Planen und Bauen Abt. Stadtplanung Landwehr 4-6 D-47533 Kleve --- vorab per E-Mail an [email protected] --- 30.08.2015 Einwendung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB zum neuen Flächennutzungsplan der Stadt Kleve (öffentliche Auslegung vom 29.06.2015-31.08.2015) Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Schreiben machen wir Einwände gegen den Flächennutzungsplan der Stadt Kleve geltend, der sich seit dem 29.06.2015 bis zum 31.08.2015 in der zweiten Auslegung befindet. Unsere Bedenken beziehen sich auf die Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergie im Reichswald (P1 und P2), sowohl an dessen sensiblem Rand (P3). Einleitend möchten wir kritisch anmerken, dass wir die Art und den gewählten Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Planungen für denkbar fragwürdig halten. Während seit dem Jahr 2011 unter aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit an dem neuen Flächennutzungsplan gearbeitet wird, sind die genannten Konzentrationszonen in für die Bürger nicht transparenter Weise erst vor der zweiten Auslegung in den Flächennutzungsplan aufgenommen worden. Ein gerichteter Austausch hierzu mit der Bevölkerung fand nicht statt. Dieses Vorgehen widerspricht dem von der Behörde kommunizierten Bemühen um eine aktive Beteiligung der Bürger bei der Entwicklung des neuen Flächennutzungsplans. Hierunter finden Sie unsere Bedenken hinsichtlich der Windkraft-Planungen im und am Reichswald. 1. Fehlende Nachvollziehbarkeit vor dem Hintergrund der Raumordnung Landesentwicklungsplan (LEP) Der neue Landesentwicklungsplan, der möglicherweise die Nutzung von Waldgebieten für die Errichtung von Windkraftanlagen (hiernach kurz WKA) stimuliert, befindet sich noch in der Entwurfsfase. Somit besteht aktuell kein Erfordernis der Darstellung von Flächen im Reichswald als Konzentrationszonen für Windenergie. -

Umweltverträglichkeitsstudie Zum Bau Von 12 Windenergieanlagen Im Windpark Kranenburg (Kreis Kleve)
Umweltverträglichkeitsstudie zum Bau von 12 Windenergieanlagen im Windpark Kranenburg (Kreis Kleve) Antragsteller ABO Wind Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Büro für Ökologie & Landschaftsplanung Hartmut Fehr, Diplom-Biologe Wilhelmbusch 11 52223 Stolberg Tel.: 02402-1274995 Fax: 02402-1274996 Internet: www.planungsbuero-fehr.de e-mail: [email protected] Stand: 09.05.2016 Umweltverträglichkeitsstudie – Bau eines Windparks im Reichswald/Kranenburg (Kreis Kleve) Inhalt Inhalt 1. ANLASS DER PLANUNG .......................................................................................................... 1 2. BESCHREIBUNG DER UMWELT UND IHRER BESTANDTEILE IM EINWIRKUNGSBEREICH DES VORHABENS ......................................................................................................................... 1 2.1 Planvorgaben ................................................................................................................ 4 2.1.1 Regionalplan .............................................................................................................. 4 2.1.2 Flächennutzungsplan.................................................................................................. 5 2.1.3 Landschaftsplan ......................................................................................................... 6 2.2 Menschen und Bevölkerung im Umfeld des geplanten Windparks .................................. 8 2.3 Naherholung/Tourismus ...............................................................................................10