Rechts, Oder Was…?!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rikke Alberg Peters
Conjunctions: Transdisciplinary Journal of Cultural Participation Become Immortal! Mediatization and mediation processes of extreme right protest Rikke Alberg Peters This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited Conjunctions, vol. 2, no. 1, 2015, ISSN 2246-3755, https://doi.org/10.7146/tjcp.v2i1.22274 keywords Right-wing extremism, neo-fascism, protest action, mediation, mediatization, ethno-nationalism abstract Th is paper presents a case study of the German neo-fascist network Th e Immortals (Die Unsterblichen) who in 2011 performed a fl ash-mob, which was disseminated on YouTube for the so-called “Become Immortal” campaign. Th e street protest was designed for and adapted to the specifi c characteristics of online activism. It is a good example of how new contentious action repertoires in which online and street activism intertwine have also spread to extreme right groups. Despite its neo-fascist and extreme right content, the “Become Immortal” campaign serves as an illustrative case for the study of mediated and mediatized activism. In order to analyze the protest form, the visual aesthetics and the discourse of Th e Immortals, the paper mobilizes three concepts from media and communication studies: media practice, mediation, and mediatiza- tion. It will be argued that the current transformation and modernization processes of the extreme right can be conceptualized and understood through the lens of these three concepts. -

Historia Scribere 08 (2016)
historia scribere 08 (2016) Der Nazis neue Kleider: Die Vereinnahmung jugendlicher Subkulturen durch die extreme Rechte in Deutschland Tobias Leo Kerngebiet: Zeitgeschichte eingereicht bei: Ass.-Prof.in Mag.a Dr. in Eva Pfanzelter (MA) eingereicht im Semester: WS 2014/15 Rubrik: SE-Arbeit Abstract The Nazis’ New Clothes: The Take-over of Youth Subcultures by right- wing Extremists in Germany Right-wing extremist parties, organisations and movements tried and still try to take over youth subcultures. For about ten years, the right-wing extremist group Autonomous Nationalists has been trying to take over and copy left- wing movements, however more subtly and on a much broader social base than with the skinheads. This paper focuses on the take-over of the skinhead subculture by right-wing extremists as well as their attempt to reach left-wing subcultures as Autonomous Nationalists. The Hegemony Theory by Antonio Gramsci, a Marxist, is used as an explanatory model. Einleitung „[Da] Aktionsformen, Subkulturen, Aussehen, Farben, usw. nun mal kein Copyright be- sitzen, […] [und] niemand ein Recht darauf hat, dies allein für sich zu beanspruchen“,1 so schreiben die Autonomen Nationalisten (AN) Ostfriesland in ihrem Blog, zielen sie drauf ab, „jegliche Jugendsubkulturen zu unterwandern und sie für […] [sich] zu 2 gewinnen“. Das altbekannte Bild von Neonazis – kahl rasierte Köpfe, Bomberjacken 1 Blog: Autonome Nationalisten Ostfriesland, Über uns, November 2008, [http://logr.org/leerostfriesland/uber- uns/], eingesehen 27.11.2014. 2 Blog: AN Ostfriesland, Über uns. 2016 I innsbruck university press, Innsbruck historia.scribere I ISSN 2073-8927 I http://historia.scribere.at/ OPEN ACCESS Nr. 8, 2016 I DOI 10.15203/historia.scribere.8.486ORCID: 0000-000x-xxxx-xxxx 84 Der Nazis neue Kleider historia.scribere 08 (2016) und glänzend polierte Springerstiefel samt weißen Schnürsenkeln – hat schon seit längerem ausgedient. -

Autonomous Nationalists’: New Developments and Contradictions in the German NeoNazi Movement
The `Autonomous Nationalists': new developments and contradictions in the German neo-Nazi movement Article (Published Version) Schlembach, Raphael (2013) The ‘Autonomous Nationalists’: new developments and contradictions in the German neo-Nazi movement. Interface: a journal for and about social movements, 5 (2). pp. 295-318. ISSN 2009-2431 This version is available from Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/50208/ This document is made available in accordance with publisher policies and may differ from the published version or from the version of record. If you wish to cite this item you are advised to consult the publisher’s version. Please see the URL above for details on accessing the published version. Copyright and reuse: Sussex Research Online is a digital repository of the research output of the University. Copyright and all moral rights to the version of the paper presented here belong to the individual author(s) and/or other copyright owners. To the extent reasonable and practicable, the material made available in SRO has been checked for eligibility before being made available. Copies of full text items generally can be reproduced, displayed or performed and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. http://sro.sussex.ac.uk Interface: a journal for and about social movements Article Volume 5 (2): 295 - 318 (November 2013) Schlembach, Autonomous Nationalists The ‘Autonomous Nationalists’: new developments and contradictions in the German neo-Nazi movement Raphael Schlembach Abstract This article examines the action repertoires, symbolism and political ideology of the ‘Autonomous Nationalists’ (Autonome Nationalisten in German) that have emerged as a sub-cultural youth trend within the German extreme right. -

WP022 Alain De Benoist's Anti-Political Philosophy Beyond
Working Paper Series Papers available in the Working Paper Series are works in progress. Please do not cite without permission. Any comments should be addressed directly to the author Reference WP022 Title Alain de Benoist’s anti-political philosophy beyond Left and Right: Non-emancipatory responses to globalisation and crisis Author Raphael Schlembach Email: [email protected] 2 Raphael Schlembach (Liverpool Hope University) Alain de Benoist’s anti-political philosophy beyond Left and Right: Non-emancipatory responses to globalisation and crisis Key Words – anti-politics, economic crisis, globalisation, populism, neo-fascism Abstract The purpose of this paper is to analyse and critique non-emancipatory and anti-political forms of opposition to globalisation and to the current Eurozone management of the global financial crisis. It will question, amongst other themes, critiques of globalisation that present themselves as mere critiques of capitalist excess or capital’s ‘transnational’ form. This opens up the problem of the national/global antinomy as well as of responses that contain a nationalist or traditionalist element. The paper draws primarily on a critical discussion of the work of ‘European New Right’ philosopher Alain de Benoist. In de Benoist’s writings it detects an anti-political rejection of the political divide between left and right, which aligns it with contemporary neo-fascist opposition to the Eurozone crisis. The paper will reflect upon this alignment through a discussion of Marxist critical theory, putting forward the argument that capitalist processes must be understood as non-personal domination rather than as a system of individual greed or wilful exploitation. This should also open up the possibility to re-evaluate some of the recent progressive, yet largely populist, movement mobilisations directed at the crisis. -

How Extreme Is the European Far-Right Reem Ahmed
2 Investigating the Far Right • Not a homogeneous group – spectrum spanning varying degrees of extremism and activism, ranging from racial supremacy to cultural exclusion. • Traditionally differentiate between extreme and radical right • “the clear-cut boundaries between parties, movements and subcultural actors are increasingly becoming obsolete” (Fielitz and Laloire 2016) • To what extent do these groups talk about the same issues in the same way, in spite of the apparent differences in tone and underlying ideologies? Quantitative Study: Data & Method • Exploratory study – data collected by VOX-Pol researchers • 175 EU-based extreme right Twitter accounts • 388,795 tweets collected between September 2015 - 2016 through the Twitter Streaming API • English was the most prominent language (32.2%), followed by Spanish (16.9%) and German (15%) • Reflects the countries represented in the sample - Spain (18.3%), followed by the UK and Germany (both 12.6%) • Investigated top hashtags, hashtag co-occurrences, URLs, as well as a cursory insight into suspension rates Hashtag Counts Hashtag Co-occurences URLs • 34.7% of the tweets contained URLs • Mainstream right-leaning and explicitly far-right news sites, such as Mail Online, Die Welt, Daily Express, Breitbart, Russia Today (RT), and Sputnik News • Used to ‘substantiate’ the ‘evidence’ presented in the tweets – mostly concerning refugees and immigrants • Websites and blogs centring around conspiracy theories and more underground far-right websites and forums (e.g. David Duke, Daily Stormer etc.) -

Rechtsextreme Strukturen, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Und Bürgerschaftliches Engagement Gegen Rechtsextremismus in Der Landeshauptstadt Dresden
Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung IKG Rechtsextreme Strukturen, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und bürgerschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus in der Landeshauptstadt Dresden Bielefeld, im Dezember 2010 Inhaltsübersicht A ZUM KONZEPT DER ANALYSE ........................................................................... 5 B EMPIRISCHE ERGEBNISSE .................................................................................6 B1 RECHTSEXTREMISTISCHE STRUKTUREN IN DRESDEN. ERSCHEINUNGSBILD UND RELEVANZ ....... 6 B2 GRUPPENBEZOGENE MENSCHENFEINDLICHKEIT UND BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT GEGEN RECHTSEXTREMISMUS IN DRESDEN ................................................................................ 67 C AUSBLICK .........................................................................................................145 - 2 - Vorwort Diese Studie zu rechtsextremen Strukturen, Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und bürgerschaftlichem Engagement gegen Rechtsextremismus in der Landeshauptstadt Dresden wurde im Rahmen des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" und des "Lokalen Handlungsprogramms für Toleranz und Demokratie und gegen Extremismus" der Landeshauptstadt Dresden gefördert. Sie besteht aus zwei Teilen. In Teil 1 werden die rechtsextremen Strukturen analysiert, d.h. es werden die Erscheinungs- formen beschrieben und die politische Relevanz eingeordnet. Die empirische Darstellung bezieht sich dabei auf den parteiförmigen und den bewegungsförmigen Rechtsextremismus -

When Neo-Nazis March and Anti-Fascists Demonstrate. PROTEAN COUNTERPUBLICS in the DIGITAL
When neo-Nazis march and anti-fascists demonstrate. PROTEAN COUNTERPUBLICS IN THE DIGITAL AGE Christina Neumayer A thesis submitted to the PhD school at the IT University of Copenhagen for the degree of Doctor of Philosophy, Copenhagen, January 2013. Abstract Demonstrations organised by neo-Nazis and the New Right, accompanied by large counter protests by anti-fascist groups, civil society networks, and citizens, have become important political events in Germany. Digital media technologies play an increasingly important role in the confrontation between the two ends of the political spectrum framed by historically rooted ideology. This study explores how different media technologies are appropriated by activists, who consider themselves marginalised and oppositional to the mainstream, on both sides of the conflict. The study aims to examine how digital media permeate counterpublics’ (Negt and Kluge 1972; Fraser 1992; Brouwer 2006; Warner 2002) strategies, tactics, and media practices in their struggles for visibility in these protest events. The counterpublics on both ends of the political spectrum take place and are analysed across three dimensions: [1] technical affordances and media environments; [2] strategies, tactics, and media practices; and [3] political positions and ideologies. The results are based on a data set of online communication, representation, and media coverage on different online media platforms related to marches planned by neo-Nazis in the former East Germany, which were accompanied by counter protests by anti-fascist groups, NGOs, and civil society. The data is analysed across these dimensions by using the methodological frameworks of discourse theory (Carpentier 2007; Dahlberg and Phelan 2011; Laclau and Mouffe 1985) and critical discourse analysis (Fairclough 2010; van Dijk 2001; van Dijk 1998b). -
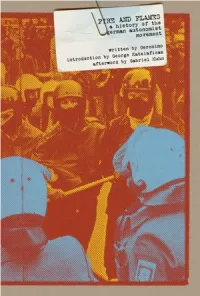
Fire and Flames
FIRE AND FLAMES FIRE AND FLAMES a history of the german autonomist movement written by Geronimo introduction by George Katsiaficas translation and afterword by Gabriel Kuhn FIRE AND FLAMES: A History of the German Autonomist Movement c. 2012 the respective contributors. This edition c. 2012 PM Press Originally published in Germany as: Geronimo. Feuer und Flamme. Zur Geschichte der Autonomen. Berlin/Amsterdam: Edition ID-Archiv, 1990. This translation is based on the fourth and final, slightly revised edition of 1995. ISBN: 978-1-60486-097-9 LCCN: 2010916482 Cover and interior design by Josh MacPhee/Justseeds.org Images provided by HKS 13 (http://plakat.nadir.org) and other German archives. PM Press PO Box 23912 Oakland, CA 94623 www.pmpress.org 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed in the USA on recycled paper by the Employee Owners of Thomson-Shore in Dexter, MI. www.thomsonshore.com CONTENTS Introduction 1 Translator’s Note and Glossary 9 Preface to the English-Language Edition 13 Background 17 ------- I. THE EMERGENCE OF AUTONOMOUS POLITICS IN WEST GERMANY 23 A Taste of Revolution: 1968 25 The Student Revolt 26 The Student Revolt and the Extraparliamentary Opposition 28 The Politics of the SDS 34 The Demise of the SDS 35 Militant Grassroots Currents 37 What Did ’68 Mean? 38 La sola soluzione la rivoluzione: Italy’s Autonomia Movement 39 What Happened in Italy in the 1960s? 39 From Marxism to Operaismo 40 From Operaio Massa to Operaio Sociale 42 The Autonomia Movement of 1977 43 Left Radicalism in the 1970s 47 “We Want Everything!”: Grassroots Organizing in the Factories 48 The Housing Struggles 52 The Sponti Movement at the Universities 58 A Short History of the K-Groups 59 The Alternative Movement 61 The Journal Autonomie 63 The Urban Guerrilla and Other Armed Groups 66 The German Autumn of 1977 69 A Journey to TUNIX 71 II. -

Identifikationsangebote Der Rechten Szene Im Netz Korpus Zur
Identifikationsangebote der rechten Szene im Netz Korpus zur Veröffentlichung Reissen-Kosch, Jana (2016): Identifikationsangebote der rechten Szene im Netz. Eine linguistische Analyse persuasiver Online-Kommunikation. Bremen: Hem- pen. D82 (Diss. RWTH Aachen University, [2015]). Auf den folgenden Seiten ist das Korpus der Analysen in Reissen-Kosch, Jana (2016): Identifikationsangebote der rechten Szene im Netz. Eine linguistische Analyse persuasiver Online-Kommunikation. Bremen: Hempen. D82 (Diss. RWTH Aachen University, [2015]) einsehbar. Die analysierten Online-Auftritte rechtsextremer Gruppierungen wurden im Umfang je eines Screenshots der jeweiligen Startseite und der Niederschrift des Selbstdarstellungstextes der jeweiligen Gruppierung (ohne Korrekturen und ein- heitlich formatiert) archiviert. Dem Untersuchungsgegenstand geschuldet widersprechen die Inhalte dieser Seiten teilweise den freiheitlich-demokratischen Grundwerten unserer Gesellschaft. Von jeglichem rechtswidrigen, rechtsextremen und menschenverachtendem Gedanken- gut distanziere ich mich an dieser Stelle ausdrücklich. Aachen, im Juli 2016 Jana Reissen-Kosch Inhalt Aktionsbund Freising ................................................................................................................. 1 Aktionsbündnis Nordoberpfalz .................................................................................................. 5 Aktionsbüro Mittelrhein ............................................................................................................. 7 Aktionsbüro -
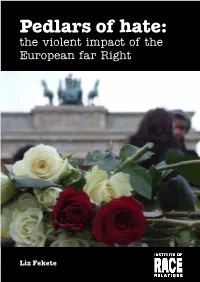
Pedlars of Hate: the Violent Impact of the European Far Right
Pedlars of hate: the violent impact of the European far Right Liz Fekete Published by the Institute of Race Relations 2-6 Leeke Street London WC1X 9HS Tel: +44 (0) 20 7837 0041 Fax: +44 (0) 20 7278 0623 Web: www.irr.org.uk Email: [email protected] ©Institute of Race Relations 2012 ISBN 978-0-85001-071-9 Acknowledgements We would like to acknowledge the support of the Joseph Rowntree Charitable Trust and the Open Society Foundations in the researching, production and dissemination of this report. Many of the articles cited in this document have been translated into English by over twenty volunteers who assist the IRR’s European Research Programme. We would especially like to thank Sibille Merz and Dagmar Schatz (who translate from German into English), Joanna Tegnerowicz (who translates from Polish into English) and Kate Harre, Frances Webber and Norberto Laguía Casaus (who translate from Spanish into English). A particular debt is due to Frank Kopperschläger and Andrei Stavila for their generosity in allowing us to use their photographs. In compiling this report the websites of the Internet Centre Against Racism in Europe (www.icare.to) and Romea (www.romea.cz) proved invaluable. Liz Fekete is Executive Director of the Institute of Race Relations and head of its European research programme. Cover photo by Frank Kopperschläger is of the ‘Silence Against Silence’ memorial rally in Berlin on 26 November 2011 to commemorate the victims of the National Socialist Underground. (In Germany, white roses symbolise the resistance movement to the Nazi -

Rechtsextremismus in Deutschland
argumente · rechtsextremismus in deutschland Rechtsextremismus in Deutschland spd-bundestagsfraktion platz der republik 1 11011 berlin www.spdfraktion.de argumente · rechtsextremismus in deutschland Vorwort .......................................................................................................................................... Rechtsextremismus und rechte Gewalt sind in Deutschland keine Randerscheinungen. Rechtsextreme Einstellungen sind in allen gesellschaftlichen Gruppen verankert, verletzen die sozialdemokratischen Grund- werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und bedrohen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Bekämpfung des Rechtsextremismus in all seinen Ausprä- gungen – Neonazismus, Rassismus, und Antisemitismus – ist uns ein zentrales Anliegen. Wir setzten uns konsequent für Demokratie und Toleranz ein und begegnen dem vielschich- tigen Phänomen mittels eines mehrdimensionalen Ansatzes, der sowohl präventive als auch repressive Elemente beinhaltet. Ziel dabei ist die Stärkung einer demokratischen Kultur und des zivilgesellschaftlichen Engagements sowie die Förderung von Toleranz und Empathie vor allem bei jungen Menschen in strukturschwachen Regionen. Gerade in diesen Regionen ist es der Neonaziszene gelungen, über den Vertrieb von Hassmusik und rechtsaffinen Kleidungsmarken oder Nazi-Konzerten eine führende Position im soziokulturellen Bereich aufzubauen. Das dadurch geschaffene Netzwerk und dessen Aktivität haben zu einer verstärkten Präsenz der extremen Rechten im Alltag geführt, die sich -

Rechtsextremismus? Nicht Mit Mir! Grundwissen Und Handwerkszeug Für Demokratie in Hessen Das 1X1 Zur Zivilcourage in Bedrohungs- Situationen 1
ISBN 978-3-95861-841-1 Rechtsextremismus? Nicht mit mir! Grundwissen und Handwerkszeug für Demokratie in Hessen Das 1x1 zur Zivilcourage in Bedrohungs- situationen 1. Sei vorbereitet Begleitheft 2. Bleib ruhig zur Ausstellung 3. Handle sofort „Demokratie stärken – 4. Hole Hilfe / Erzeuge Aufmerksamkeit Rechtsextremismus 5. Halte zum Betroffenen 6. Verunsichere den/die Täter_in bekämpfen“ 7. Wende keine Gewalt an 8. Provoziere den/die Täter_in nicht 9. Halte Abstand / Immer „siezen“ 10. Ruf die Polizei Quelle: Netzwerk für Demokratie und Courage Die Friedrich-Ebert-Stiftung: Noch ein paar Worte zu der Institution, die dieses Heft erdacht und herausgegeben hat. Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) wurde 1925 als politisches Vermächtnis des ersten demokratisch gewählten deutschen Reichspräsidenten Friedrich Ebert gegründet. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert – vom einfachen Handwerker in das höchste Staatsamt aufgestiegen – regte vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen in der politischen Aus- einandersetzung die Gründung einer Stiftung mit folgenden Zielen an: die politische und gesellschaftliche Bildung von Menschen aus allen Lebens- bereichen im Geiste von Demokratie und Pluralismus zu fördern, begabten jungen Menschen unabhängig von den materiellen Möglichkeiten der Eltern durch Stipendien den Zugang zum Hochschulstudium zu ermöglichen, zur internationalen Verständigung und Zusammenarbeit beizutragen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, von den Nationalsozialisten 1933 verboten und 1947 wieder- begründet, verfolgt mit ihren umfangreichen Aktivitäten