Forschungen Zur Baltischen Geschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

In the Lands of the Romanovs: an Annotated Bibliography of First-Hand English-Language Accounts of the Russian Empire
ANTHONY CROSS In the Lands of the Romanovs An Annotated Bibliography of First-hand English-language Accounts of The Russian Empire (1613-1917) OpenBook Publishers To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/268 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. In the Lands of the Romanovs An Annotated Bibliography of First-hand English-language Accounts of the Russian Empire (1613-1917) Anthony Cross http://www.openbookpublishers.com © 2014 Anthony Cross The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt it and to make commercial use of it providing that attribution is made to the author (but not in any way that suggests that he endorses you or your use of the work). Attribution should include the following information: Cross, Anthony, In the Land of the Romanovs: An Annotated Bibliography of First-hand English-language Accounts of the Russian Empire (1613-1917), Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2014. http://dx.doi.org/10.11647/ OBP.0042 Please see the list of illustrations for attribution relating to individual images. Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omissions or errors will be corrected if notification is made to the publisher. As for the rights of the images from Wikimedia Commons, please refer to the Wikimedia website (for each image, the link to the relevant page can be found in the list of illustrations). -

Full Article in PDF Format
Acta Historica Tallinnensia, 2020, 26, 79–102 https://doi.org/10.3176/hist.2020.1.04 ESTONIAN MODERN HISTORY IN THE TWENTYFIRST CENTURY Karsten BRÜGGEMANNa and Bradley D. WOODWORTHb a Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Narva mnt 25, 10120 Tallinn, Estonia; [email protected] b History Program, University of New Haven, 300 Boston Post Road, West Haven, CT 06516 USA; [email protected] This article presents a short overview of Estonian and international research on the nineteenth century in Estonia during the decades since the reestablishment of independence in 1991, with a focus on work published in the twentyfirst century. The authors discuss the most important directions of re search – socioeco nomic history in rural and urban environments, Estonian nationalism and the devel opment of ethnic milieus of Baltic Germans and Russians, the history of Estonia as part of a larger empire and, albeit very briefly, also cultural history. The authors also identify a number of topics still in need of attention by scholars. For historians writing in European languages, the notion of writing about the nine teenth century as the period 1800 to 1900 has for several decades been supplanted by the argument that as a temporal framework, the period from the beginning of the French Revolution in 1789 to the outbreak of war in 1914 simply makes much more sense. Even for the present authors, writing about the historiography of a land which the first of these events did not immediately affect, it is a bit artificial to cut the “long nineteenth century” short since there is hardly any study on Estonian history that uses exactly the time frame from 1800 to 1900.1 For the purpose of this article, as requested by the editor, we nevertheless focus on this “arithmetic” period in order to avoid overlaps with the contributions in this special issue on early modern and twentieth century history. -
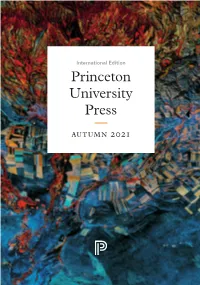
153 Mathematics 155 Audiobooks 156 Subrights Information 157 International Rights 158 Best of the Backlist 162 Index 164 Order Information
Princeton University Press 6 Oxford Street, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TR United Kingdom 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540-5237 United States International Edition Princeton University Press autumn 2021 autumn autumn Cover image: Cubism—Landsat Style: startling red patches sprout from an agricultural landscape that looks almost like a Cubist painting. The fields in this part of eastern Kazakhstan follow the contours of the land—long and narrow in mountain valleys, and large and rectangular over the plains. 2021 Landsat imagery courtesy of NASA Goddard Space Flight Center and U.S. Geological Survey. Contents 1 Featured Books 43 Zone Books 46 Featured Nature 55 Paperbacks 90 Art 94 Architecture 95 Literature 100 Poetry 102 Media Studies 104 Education 106 History 115 Ancient History 116 Jewish Studies 118 Religion 119 Philosophy 125 Political Science 132 Middle East Studies 133 Sociology 138 Anthropology 139 Psychology 141 Economics 144 Nature 148 Biology 151 Earth Science 152 Physics 153 Mathematics 155 Audiobooks 156 Subrights Information 157 International Rights 158 Best of the Backlist 162 Index 164 Order Information Featured Books 2 Featured Books Twelve Caesars: Images of Power from the Ancient World to the Modern Mary Beard From the bestselling author of SPQR: A History of Ancient Rome, the fascinating story of how images of Roman autocrats have influenced art, culture, and the representation of power for more than 2,000 years What does the face of power look like? Who gets a simple repetition of stable, blandly conservative commemorated in art and why? And how do we react images of imperial men and women, Twelve Caesars is to statues of politicians we deplore? In this book Mary an unexpected tale of changing identities, clueless or Beard tells the story of how portraits of the rich, deliberate misidentifications, fakes, and often ambiva- powerful, and famous in the western world have been lent representations of authority. -

FELIKS GORNISCHEFF Venemaa Suhted Preisimaaga Napoleoni Sõdade Ajal Baltisaksa Päritolu Diplomaatide Tegevuse Näitel
FELIKS GORNISCHEFF DISSERTATIONES HISTORIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 49 Venemaa suhted Preisimaaga Napoleoni sõdade ajal baltisaksa tegevuse näitel ajal sõdade suhted diplomaatide Preisimaaga päritolu Napoleoni Venemaa FELIKS GORNISCHEFF Venemaa suhted Preisimaaga Napoleoni sõdade ajal baltisaksa päritolu diplomaatide tegevuse näitel (1806–1812) Tartu 2020 1 ISSN 1406-443X ISBN 978-9949-03-314-0 DISSERTATIONES HISTORIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 49 DISSERTATIONES HISTORIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 49 FELIKS GORNISCHEFF Venemaa suhted Preisimaaga Napoleoni sõdade ajal baltisaksa päritolu diplomaatide tegevuse näitel (1806–1812) Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Tartu Ülikool Käesolev väitekiri on lubatud kaitsmisele 18. veebruaril 2020 toimunud Humani- taarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu koosoleku otsusega. Juhendaja: professor Tõnu Tannberg Oponent: PhD Bradley Woodworth Kaitsmine: 16. aprill 2020, kell 16:15, TÜ senati saal Ülikooli 18–204. Doktoritöö valmimist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Üli- kooli ASTRA projekt PER ASPERA). ISSN 1406-443X ISBN 978-9949-03-314-0 (trükis) ISBN 978-9949-03-315-7 (pdf) Autoriõigus: Feliks Gornischeff, 2020 Tartu Ülikooli Kirjastus www.tyk.ee TÄNUSÕNAD Minu huvi ajaloo vastu sai alguse, kui koolis hakati õpetama Vana-Egiptuse ajalugu. Siis ei osanud ma veel arvata, et minust saab ajaloolane. Veel vähem oskasin arvata, et hakkan süvitsi tegelema Napoleoni ajastuga. Astudes 2006. aastal Inglismaale Bradfordi Ülikooli kaasaaegset Euroopa ajalugu -

Friend Or Femme Fatale?: Olga Novikova in the British Press, 1877-1925
FRIEND OR FEMME FATALE?: OLGA NOVIKOVA IN THE BRITISH PRESS, 1877-1925 Mary Mellon A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of History Chapel Hill 2010 Approved by: Louise McReynolds Donald J. Raleigh Jacqueline M. Olich i ABSTRACT MARY MELLON: Friend or Femme Fatale?: Olga Novikova in the British Press, 1877-1925 (Under the direction of Dr. Louise McReynolds) This thesis focuses on the career of Russian journalist Olga Alekseevna Novikova (1840-1925), a cosmopolitan aristocrat who became famous in England for her relentless advocacy of Pan-Slavism and Russian imperial interests, beginning with the Russo- Turkish War (1877-78). Using newspapers, literary journals, and other published sources, I examine both the nature of Novikova’s contributions to the British press and the way the press reacted to her activism. I argue that Novikova not only played an important role in the production of the discourse on Russia in England, but became an object of that discourse as well. While Novikova pursued her avowed goal of promoting a better understanding between the British and Russian empires, a fascinated British press continually reinterpreted Novikova’s image through varying evaluations of her nationality, gender, sexuality, politics and profession. ii TABLE OF CONTENTS FRIEND OR FEMME FATALE?: OLGA NOVIKOVA IN THE BRITISH PRESS, 1877-1925……………….…………...……………………….1 Introduction……………………………………………………………….1 The Genesis of a “Lady Diplomatist”…………………………………...11 Novikova Goes to War…………………………………………………..14 Novikova After 1880…………………………………………………….43 Conclusion……………………………………………………………….59 Epilogue: The Lady Vanishes..………………………………………….60 BIBLIOGRAPHY……………………………………………………………….63 iii The removal of national misunderstandings is a task which often baffles the wisdom of the greatest statesmen, and defies the effort of the most powerful monarchs. -

German Historical Institute London Bulletin Vol 38 (2016)
BOOK REVIEWS FIONA J. GRIFFITHS and JULIE HOTCHIN (eds.), Partners in Spirit: Women, Men, and Religious Life in Germany, 1100–1500, Medieval Wo - men: Texts and Contexts, 24 (Turnhout: Brepols, 2014), x + 430 pp. ISBN 978 2 503 54096 2. €100.00 This collection of essays is dedicated to the question of how men and women lived and worked together in medieval religious houses. This starting point may surprise some readers, given the common as - sumption that religious women in particular lived in strict enclosure and that men were not allowed to enter their convents, except, that is, for clerics who said mass for the women, spiritual fathers who heard their confessions and gave them pastoral guidance, and male relatives who had a special right to visit their sisters and daughters. All of which brings us directly to the heart of the matter. The issue addressed in this volume originates in the prohibition on women tak- ing higher orders and in the close connections between religious women and their secular relatives which arose not least from their financial affairs. Considering that cohabitation was a common and everyday situation in female monasteries and collegiate churches, the subject has hitherto received insufficient attention from researchers. Yet the problems of cohabitation, particularly the threat it posed to the women’s celibacy, were repeatedly addressed in medieval letters, hagiographical and historical texts, charters, sermons, visitation records, and the normative texts of monasticism, as Fiona J. Griffiths (New York) and Julie Hotchin (Canberra) show in their introduction (pp. 1–46). The volume gathers together essays which investigate the every- day routine of male–female relations within male and female monas- teries which were not double houses, using case studies from German-speaking Europe between the twelfth and the sixteenth cen- turies. -

Dorothea Lieven and Russia's Informal Diplomacy Between 1812 and 1834
The Princess Stateswoman: Dorothea Lieven and Russia’s Informal Diplomacy Between 1812 and 1834 Julia ten Bos Master thesis Supervisor: Dr. J. H. C. Kern Russian and Eurasian studies Leiden University Word count: 20 751 Table of content 1. Introduction 2 2. Dorothea’s upbringing, marriage and personality 7 3. Interpretations of Dorothea’s role and influence 16 4. The Russian Empire and foreign affairs in Europe 23 5. Dorothea’s diplomatic techniques 29 6. Political Results and Processes 39 Conclusion 50 Bibliography 54 1 Introduction “There never figured on the Courtly stage a female intriguer more restless, more arrogant, more mischievous, more ... odious and insufferable than this supercilious Ambassadress.”1 - The Times This fragment described Dorothea Lieven (Дарья Христофоровна Ливен, 1785- 1857), a nineteenth century figure. She was notorious in both Russia and Great Britain for a variety of reasons. Considering her reputation in 19th century diplomatic circles, it is surprising that Dorothea is not a well-known figure today. Her husband Christopher Andreyevich Lieven (Христофор Андреевич Ливен, 1774 – 1838) was the Russian ambassador to England and represented Russia in London between 1812 and 1834. Dorothea joined him in the move to England, where she established herself as a diplomatic force in the Russian embassy. Beside diplomatic involvement, she was a sensation in England’s high society and an esteemed patroness of Almack’s, London’s exclusive social club. Here she introduced the waltz in England in 1813. However, it is unlikely that the anonymous author from the Times would have described her as “mischievous” and “ supercilious” for introducing a dance to the ballrooms of English high society. -

Athens Journal of Mediterranean Studies
Athens Journal of Mediterranean Studies Quarterly Academic Periodical, Volume 7, Issue 2, April 2021 URL: https://www.athensjournals.gr/ajms Email: [email protected] e-ISSN: 2407-9480 DOI: 10.30958/ajms Front Pages GREGORY T. PAPANIKOS The European Union’s Recovery Plan: A Critical Evaluation JUAN JOSÉ MORILLAS GUERRERO Global Impact of Digital Transformation on Entrepreneurship: Present Position in Spain NICHOLAS PAPPAS European Officers and the Mainland Irregular Forces on the Ionian Islands, 1798–1814: A Comparison of Command and Tactics MOHAMED EL KHOULI Examining the Trends of Educational Variables in the Past Affecting Egypt’s Ability to Becoming Future-Proof in Facing Unemployment i ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH A World Association of Academics and Researchers 8 Valaoritou Str., Kolonaki, 10671 Athens, Greece. Tel.: 210-36.34.210 Fax: 210-36.34.209 URL: https://www.athensjournals.gr/ajms Email: [email protected] Mission ATINER is an Athens-based World Association of Academics and Researchers based in Athens. ATINER is an independent and non-profit Association with a Mission to become a forum where Academics and Researchers from all over the world can meet in Athens, exchange ideas on their research and discuss future developments in their disciplines, as well as engage with professionals from other fields. Athens was chosen because of its long history of academic gatherings, which go back thousands of years to Plato‟s Academy and Aristotle‟s Lyceum. Both these historic places are within walking distance from ATINER‟s downtown offices. Since antiquity, Athens was an open city. In the words of Pericles, Athens“…is open to the world, we never expel a foreigner from learning or seeing”. -

A Numerous Company Sat Down to Dinner, Composed of the Inmates Of
A numerous company sat down to dinner, Still composed of the inmates of the palace, and of The Banqueting people invited from Brighton itself, for this town is Room © Brighton Pavilion frequented by brilliant society in the winter months. Dur: 0.13 The prince had a band of musicians, playing horns and other noisy instruments, which gave a Still maddening performance in the vestibule, during the Portrait King dinner and throughout the evening. (IN FRENCH) George IV, 1828 B&W the prince delighted in it, and often joined in, Dur: 0.05 beating time on the dinner gong. John Evans Baptist Minister and Schoolmaster (Voice of Richard Elfyn) I have gone through the apartments of the royal pavilion, and witnessed the recent improvements, but I dare not trust my pen on so delicate a subject. I shall transcribe an original account of the royal banqueting room, taken from the Bright Herald, on January the 27th 1821. This most splendid and beautiful apartment, Music: 0.58 presents a design, the most striking, involving the intricacies of invention from the minutest objects to the harmonised combinations of the whole. The walls of this apartment are divided into compartments, containing illustrations, of the manners and elegant costumes of the higher order of the Chinese people. These pictures possess great variety, and team with domestic episodes, which are familiar to us. This dome is constructed to represent an eastern sky, partially obscured by the broad and branching foliage of a luxuriant plantain tree. From its truncated centre, Chinese symbols depend, and characterise its apparent use, that of connecting it with the grand lustre, rising thirty feet and, assuming the shape of lotus flowers. -

Dealing with Russia: As in 1907, Wrong Again
Click here for Full Issue of EIR Volume 33, Number 7, February 17, 2006 With Russia chairing the Group of Eight industrialized nations for the first time, the London Economist (“he is not the partner the West once hoped for”) and the Wall Street Dealing With Russia: Journal, chief mouthpieces of the London and New York financial oligarchy, also piled on demands that Russia be As in 1907, Wrong Again blocked from trying to accomplish anything substantial through the G-8. Putin has declared his G-8 agenda priorities by Rachel and Allen Douglas to be global energy security, combating the spread of infec- tious diseases, and education. There is some reflection of what is afoot in the fact that Five months ago,1 we told you how the career of Alexander Putin has gone out of his way, since the end of January, to Helphand “Parvus” sheds light on what the neo-con war party, stage a running joke at the expense of some British intelli- grouped around Vice President Dick Cheney, has really been gence operatives, caught in a Moscow park with a malfunc- up to. That is because the hereditary roots of the neo-cons’ tioning electronic dead drop concealed in a rock. “Putin current doctrine and practice of permanent warfare and prolif- knows the British are the problem,” Lyndon LaRouche com- erating regime changes trace back to the Anglo-Venetian op- mented on Feb. 6, “but he has shown no sign of understanding erative Parvus’s early-20th-Century theory and practice of the deeper aspects of the global strategic problem. -

Full Article in PDF Format
Acta Historica Tallinnensia 2021, 27/1 https://doi.org/10.3176/hist.2021.1.04 Pedagogical Innovations and Estonian Education at the Beginning of the Nineteenth Century: Transnational Influences and Historical Roots Aivar Põldvee Tallinn University, School of Humanities, Centre of History, Archaeology and Art History, Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn, [email protected] Abstract: The article focuses on Estonian schools’ first contacts with the educational innovations of the Enlightenment at the beginning of the nine- teenth century. New pedagogical ideas and methods of teaching, which spread through transnational networks of intellectuals and the written word, reached Estonian (and Latvian) peasants, mainly via clergymen. The ideas of Johann Heinrich Pestalozzi were highly valued by Georges Frédéric Parrot, adviser to emperor Alexander I. The vocational school founded by Ferdinand Kindermann served as an example for the parish school opened by Johann Philipp von Roth, pastor at Kanepi. Otto Wilhelm Masing, pas- tor at Äksi, tried to adapt the Bell-Lancaster method first launched in India and England to Estonian schools. In addition to a transnational perspective, the article makes comparisons with the seventeenth century, when attempts were made to solve similar problems when educating peasants in Estland and Livland. Keywords: Enlightenment; Reformpädagogik; progressive education; pedagogical innovations; Pestalozzi; Industrieschule; Bell-Lancaster system; phonic method; Estonian school; Otto Wilhelm Masing © 2021 Author. This is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Pedagogical Innovations and Estonian Education 95 Introduction Educational institutions characteristic of the European societies of the modern period were formed on the territory of the present-day Estonia during the Lutheran Swedish rule of the seventeenth century. -

Full Conference Program
Sunday, 23 August 1st General Assembly; Opening Session Detailed Schedule Sunday 23 August/Dimanche 23 août 1st General Assembly/1ère Assemblée générale 9:15 AM-10 AM Rigistration 10 AM-12 and 1:30 PM-3:20 PM/ 10 h-12 h et 13 h 30-15 h 30 Shandong High Speed Hall, Shangdong Hotel - Opening Statement: Marjatta HIETALA, president of the ICHS/Ouverture : Marjatta Hietala, présidente du CISH - General Secretary‟s Report (2010-2015)/Rapport moral du Secrétaire general (2010-2015) : Robert Frank - Treasurer‟s report/Rapport financier du Trésorier : Laurent Tissot - New members: Presentation of the candidates to ICHS (National Committees and International Affiliated Organizations); discussion and vote /Nouveaux membres : présentation des candidats au CISH (comités nationaux et organisations internationals affiliées) ; discussion et vote - Venue of the General Assembly of 2017: Moscow‟s application; discussion and vote / Lieu de l‘Assemblée générale du CISH en 2017, candidature de Moscou ; discussion et vote - Members of the new Board: outline of the procedure and introduction of the members proposed by the Nominating Committee/ Membres du nouveau bureau : rappel de la procedure et présentation des membres proposés par la commission de nomination - International Prize of History: outline of the procedure 2014-2015; presentation of the result; presentation of the rules governing the future prizes/ Prix international de l‘histoire, présentation de la procédure 2014-2015 et du résultat ; présentation du règlement d‘attribution des prochains prix