Heimat Auf Zeit. Hans Mayer an Der Universität Leipzig
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nachlässe Von Germanistinnen Und Germanisten Aus Derddr
Erschienen in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes Jg. 64 (2017) H. 2, S. 171-180. Nachlässe von Germanistinnen und Germanisten aus der DDR: eine Beständeübersicht Simone Waidmann / Frederike Teweleit / Ruth Doersing Die nachfolgende Beständeübersicht ist als heuristisches Arbeitsinstrument zu verstehen, das keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie beruht auf Re cherchen in öffentlich zugänglichen Nachweisinstrumenten und Selbstauskünften bestandshaltender Institutionen. Neben Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern wurden in Auswahl auch germanistische Linguistinnen und Linguisten berücksichtigt. Auf nahme in die Übersicht fanden nur Bestände (Nachlässe und Vorlässe), die von den genannten Personen bzw. deren Erben gebildet wurden. Instituts- und Gremien unterlagen, Promotions- und Habilitationsakten, Personalakten von Arbeitgebern und andere durch Dritte gebildete Bestände, u. a. Stasiakten, bleiben unberück sichtigt. Die Heterogenität der Angaben ist auf die sehr unterschiedlichen Er schließungsstände in den jeweiligen Archiven zurückzuführen. Becker, Henrik (1902-1984) Universitäts rchiv Jena Nachlass(5,25 lfm, erschlossen, Findbuch) Inhalt:Lehrtätigkeit, hier Unterlagen über die Tätigkeit an der Volkshochschule und der ABF in Leipzig sowie am Germanistischen Institut und dem Institut für Sprachpflege und Wortforschung der FSU Jena. Mitarbeit in Arbeitsgemein schaften und Kommissionen, hauptsächlich Sprachlehrbücher des Sprachlehr- buchausschusses der Gewerkschaft der Lehrer und Erzieher -

Werner Krauss
Krauss, Werner akademischer Titel: Prof. Dr. phil. habil. Dr. phil. h. c. mult. Prof. in Leipzig: 1947-58 Professor mit Lehrstuhl für Romanische Philologie. 1958-61 Honorarprofessor für Romanische Philologie. Fakultät: 1947-1951 Philosophische Fakultät - Philologisch-Historische Abt., Institut für Romanistik. 1951-1958 Philosophische Fakultät - Institut für Romanistik. Lehr- und Romanische Philologie. Französische Literatur und Gesellschaftsgeschichte. Hispanistik. Forschungsgebiete: Spanische Literatursprache und Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. weitere Vornamen: Rudolf Lebensdaten: geboren am 07.06.1900 in Stuttgart. gestorben am 28.08.1976 in Berlin. Vater: Dr. phil. Rudolf Krauss (Geh. Archivrat) Mutter: Ottilie Krauss geb. Schüle (Hausfrau) Konfession: ev.-luth. Lebenslauf: 1906-1915 Volks- und Realschule in Stuttgart. 1915-1918 Humanistisches Eberhard-Ludwigs-Gymnasium zu Stuttgart mit Abschluss Abitur. 7/18-1/19 Wehrdienst als Kanonier bei der 4. Ersatz-Batterie beim Feldartillerie-Regiment Nr. 13. 1918-1919 Studium der Rechte, Wirtschafts-, Literatur-, Kunstgeschichte u. Philosophie in München. 1919-1921 Studium der Rechte, Wirtschafts-, Literatur-, Kunstgeschichte u. Philosophie in Berlin. 1921-1922 Studium der Literaturwissenschaften (Romanistik) u. Kunstgeschichte an der Univ. Berlin. 1922-1923 Aufenthalt in Spanien zum Sprach- u. Literaturstudium sowie Übersetzertätigkeiten 1923-1926 Studium der Hispanistik an der Universität Madrid. 1926-1929 Studium an der Universität München mit Abschluss des romanistischen Studienganges. 1929-1931 Studien an der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin, in München und Paris. 1931-1935 apl. Assistentenstelle am Romanistischen Seminar der Philipps-Universität Marburg. 2.05.1932 Zulassung als Privatdozent an der Philosophischen Fakultät der Philipps-Universität Marburg. 1932-1940 Privatdozent für Romanische Philologie an der Philipps-Universität Marburg. 16.10.1935 Beauftragung zur Vertretung des Lehrstuhls für Romanische Philologie in Marburg. -

ARTIST - TONY OURSLER Born in New York, NY, USA, in 1957 Lives in New York, NY, USA
ARTIST - TONY OURSLER Born in New York, NY, USA, in 1957 Lives in New York, NY, USA EDUCATION - 1979 : BFA, California Institute for the Arts, Valencia, CA, USA SOLO SHOWS - 2020 Magical Variations, Lehmann Maupin Gallery, (Online) Experimentum Cruscis, Match Gallery, Ljubljana, Slovenia 2019 Current, Nanjing Eye Pedestrian Bridge, Nanjing, China Eclipse, Jardin de la Fondation Cartier Water Memory, Guild Hall, East Hampton, New York, USA The Volcano, Poetics Tattoo & UFO, Dep Art Gallery, Milan, Italy 2018 TC: The most interesting man alive, Lisson Gallery, New York, NY, USA Predictive empath, Baldwin Gallery, Aspen, CO, USA 2017 Unidentified, Redling Fine Art, Los Angeles, CA, USA Space men R my friended, Faurshou Fondation, Beijing, China 2016 The Influence Machine, George Square Gardens, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland Galería Moisés Pérez De Albéniz, Madrid, Spain The Imponderable Archive, CCS Bard Galleries, NY, USA Imponderable, MOMA, NY, USA Hans Mayer Gallery, Dusseldorf, Germany TC: The Most Interesting Man Alive, Chrysler Museum, VA, USA Lehmann Maupin, Hong Kong, Honk Kong 2015 Bernier Eliades, Athens, Greece Imponderable: the Archives of Tony Oursler, LUMA Foundation, Arles, France Lehmann Maupin, New York, NY template/variant/friend/stranger, Lisson Gallery, London, UK Influence Machine, Blinc Festival Adelaide, Pink Flats, Adelaide, Australia 2014 Lisson Gallery, London, UK Oude Kerk, Amsterdam, Netherlands Tony Oursler: Obscura, Galerie Hans Mayer, Dusseldorf, Germany Passe-Partout, Baldwin Gallery, Aspen, -

Libertas Schulze-Boysen Und Die Rote Kapelle Libertas Schulze-Boysen Und Die Rote Kapelle
Libertas Schulze-Boysen und die Rote Kapelle Libertas Schulze-Boysen und die Rote Kapelle Der Großvater, Fürst Philipp Eulenburg zu Hertefeld, Familie genießt als Jugendfreund des Kaisers lange Zeit des- sen Vertrauen und gilt am Hofe als sehr einflussreich. und Nach öffentlichen Anwürfen wegen angeblicher Kindheit homosexueller Neigungen lebt der Fürst seit 1908 zurückgezogen in Liebenberg. Aus der Ehe mit der schwedischen Gräfin Auguste von Sandeln gehen sechs Kinder hervor. 1909 heiratet die jüngste Tochter Victoria den Modegestalter Otto Haas-Heye, einen Mann mit großer Ausstrahlung. Die Familie Haas- Heye lebt zunächst in Garmisch, dann in London und seit 1911 in Paris. Nach Ottora und Johannes kommt Libertas am 20. November 1913 in Paris zur Welt. Ihr Vorname ist dem „Märchen von der Freiheit“ entnom- men, das Philipp Eulenburg zu Hertefeld geschrieben hat. Die Mutter wohnt in den Kriegsjahren mit den Kindern in Liebenberg. 1921 stirbt der Großvater, und die Eltern lassen sich scheiden. Nach Privatunterricht in Liebenberg besucht Libertas seit 1922 eine Schule in Berlin. Ihr Vater leitet die Modeabteilung des Staatlichen Kunstgewerbemu- seums in der Prinz-Albrecht-Straße 8. Auf den weiten Fluren spielen die Kinder. 1933 wird dieses Gebäude Sitz der Gestapozentrale. Die Zeichenlehrerin Valerie Wolffenstein, eine Mitarbeiterin des Vaters, nimmt sich der Kinder an und verbringt mit ihnen den Sommer 1924 in der Schweiz. 4 Geburtstagsgedicht Es ist der Vorabend zum Geburtstag des Fürsten. Libertas erscheint in meinem Zimmer. Sie will ihr Kästchen für den Opapa fertig kleben[...] „Libertas, wie würde sich der Opapa freuen, wenn Du ein Gedicht in das Kästchen legen würdest!“ Sie jubelt, ergreift den Federhalter, nimmt das Ende zwischen die Lippen und läutet mit den Beinen. -

The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals In
Writing in Red: The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 Thomas William Goldstein A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2010 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher Browning Chad Bryant Karen Hagemann Lloyd Kramer ©2010 Thomas William Goldstein ALL RIGHTS RESERVED ii Abstract Thomas William Goldstein Writing in Red The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 (Under the direction of Konrad H. Jarausch) Since its creation in 1950 as a subsidiary of the Cultural League, the East German Writers Union embodied a fundamental tension, one that was never resolved during the course of its forty-year existence. The union served two masters – the state and its members – and as such, often found it difficult fulfilling the expectations of both. In this way, the union was an expression of a basic contradiction in the relationship between writers and the state: the ruling Socialist Unity Party (SED) demanded ideological compliance, yet these writers also claimed to be critical, engaged intellectuals. This dissertation examines how literary intellectuals and SED cultural officials contested and debated the differing and sometimes contradictory functions of the Writers Union and how each utilized it to shape relationships and identities within the literary community and beyond it. The union was a crucial site for constructing a group image for writers, both in terms of external characteristics (values and goals for participation in wider society) and internal characteristics (norms and acceptable behavioral patterns guiding interactions with other union members). -

Tony Oursler CV
Tony Oursler Lives and works in New York, NY, USA 1979 BFA, California Institute for the Arts, Valencia, CA, USA 1957 Born in New York, NY, USA Selected Solo Exhibitions 2021 ‘Tony Oursler: Black Box’, Kaohsiung Museum of Fine Arts, Kaohsiung City, Taiwan 2020 ‘Hypnose’, Musée d’arts de Nantes, Nantes, France Lisson Gallery, East Hampton, NY, USA 2019 ‘电流 (Current)’, Nanjing Eye Pedestrian Bridge, Nanjing, China ‘Tony Oursler: Water Memory’, Guild Hall, East Hampton, NY, USA ‘The Volcano & Poetics Tattoo’, Dep Art Gallery, Milan, Italy 2018 ‘predictive empath’, Baldwin Gallery, Aspen, CO, USA ‘Tear of the Cloud’, Public Art Fund, Riverside Park South, New York, NY, USA ‘TC: the most interesting man alive’, Lisson Gallery, New York, NY, USA 2017 ‘Paranormal: Tony Oursler vs. Gustavo Rol’, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Turin, Italy ‘Sound Digressions: Spectrum’, Galerie Mitterand, Paris, France ‘Tony Oursler: b0t / flOw - ch@rt’, Galerie Forsblom, Stockholm, Sweden ‘Tony Oursler: L7-L5 / Imponderable’, CaixaForum, Barcelona, Spain ‘Unidentified’, Redling Fine Art, Los Angeles, CA, USA 2016 ‘Tony Oursler: The Influence Machine’, University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom ‘A*gR_3’, Galería Moisés Pérez De Albéniz, Madrid ‘M*r>0r’, Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Sweden ‘Tony Oursler: The Imponderable Archive’ Hessel Museum of Art, Bard College, Annandale-On-Hudson, NY, USA ‘Imponderable’, Museum of Modern Art, New York, NY, USA ‘TC: The Most Interesting Man Alive’ Chrysler Museum, Norfolk, -

German Videos - (Last Update December 5, 2019) Use the Find Function to Search This List
German Videos - (last update December 5, 2019) Use the Find function to search this list Aguirre, The Wrath of God Director: Werner Herzog with Klaus Kinski. 1972, 94 minutes, German with English subtitles. A band of Spanish conquistadors travels into the Amazon jungle searching for the legendary city of El Dorado, but their leader’s obsessions soon turn to madness.LLC Library CALL NO. GR 009 Aimée and Jaguar DVD CALL NO. GR 132 Ali: Fear Eats the Soul Director: Rainer Werner Fassbinder. with Brigitte Mira, El Edi Ben Salem. 1974, 94 minutes, German with English subtitles. A widowed German cleaning lady in her 60s, over the objections of her friends and family, marries an Arab mechanic half her age in this engrossing drama. LLC Library CALL NO. GR 077 All Quiet on the Western Front DVD CALL NO. GR 134 A/B Alles Gute (chapters 1 – 4) CALL NO. GR 034-1 Alles Gute (chapters 13 – 16) CALL NO. GR 034-4 Alles Gute (chapters 17 – 20) CALL NO. GR 034-5 Alles Gute (chapters 21 – 24) CALL NO. GR 034-6 Alles Gute (chapters 25 – 26) CALL NO. GR 034-7 Alles Gute (chapters 9 – 12) CALL NO. GR 034-3 Alpen – see Berlin see Berlin Deutsche Welle – Schauplatz Deutschland, 10-08-91. [ Opening missing ], German with English subtitles. LLC Library Alpine Austria – The Power of Tradition LLC Library CALL NO. GR 044 Amerikaner, Ein – see Was heißt heir Deutsch? LLC Library Annette von Droste-Hülshoff CALL NO. GR 120 Art of the Middle Ages 1992 Studio Quart, about 30 minutes. -

The Interpreters of Europe and the Cold War: Interpretive Patterns in French, German, and Polish Historiography and Literary Studies
The Interpreters of Europe and the Cold War: Interpretive patterns in French, German, and Polish historiography and literary studies Barbara Picht / Europa-Universität iadrina Fran!furt #$der% &his postdoctoral project e(amines the "irst two postwar decades, as many societies gradually found their European and national *places* and had to legitimi+e these culturally and historically against the backdrop of the ,old -ar rivalry of systems and ideologies. It investigates academic self-designs in postwar Europe, with the focus on literature and historiography as the central discourses in constructing national identities. &he project selects a historian and a literary scholar each from France, the Federal /epublic, the G0/ and Poland, whose wor! figured signi"icantly in the discursive processes of the postwar period1 Fernand Braudel and /obert 2inder in France, -erner ,on+e and Ernst /obert ,urtius in -est Germany, -alter 2ar!ov and -erner 3rauss in East Germany, and $s!ar 4alecki and ,+esła) 2iłos+ in Poland and, respectively, in U6 e(ile. 6tri!ingly, we find that the ,old -ar played a rather marginal part in these historians7 and literary scholars7 agendas. Even into the 89:;s, they argued ta!ing the idea of an undivided Europe for granted. -hat BERLI=ER 3$<<EG KALTER KRIEG > BERLI= ,EN&ER FOR ,$<0 -?R 6&U0IES @;8A Barbara Picht The Interpreters of Europe and the Cold War !ind of historical thin!ing *encountered* the ,old -ar in their wor!B 4ow could they hold fast to understandings of Europe and the nation that, from today7s perspective, seem far more suited to either the pre- and interwar periods or even the decades following 89C9 than to the height of he ,old -arB In star! contrast to what one might e(pect, these thin!ers sought neither to undermine the systems7 frontiers nor to construct a political alternative to the bipolar logic of the time. -

Downloaded340028 from Brill.Com09/26/2021 12:36:12PM Via Free Access “Tout Comprendre, C’Est Tout Pardonner?” 389
philological encounters � (�0�7) 388-40� brill.com/phen “Tout comprendre, c’est tout pardonner?” The “Case of Jauss” Ottmar Ette Universität Potsdam [email protected] Abstract Hans Robert Jauss cannot simply be excluded from the history of Romance Studies, or from the history of literary science in 20th century Germany: the attractive power of his style of thought, writing and scholarship was too profound, his machine de guerre too powerful. If the “case of Jauss” is now on its way to becoming the “paradigm of Jauss,” it is time to examine scientifically the text and work, the impact and the recep- tion of the author of Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik (“Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics”), and to illuminate them from the perspective of Romance Studies. The considerations put forth in this essay should in no way dimin- ish the undeniable merits of the founder of “Reader-response criticism”. With him and with his words, one may surely hold on to the hope that “the triadic relationship of technology, communication, and world view” can be brought “once more into equilib- rium.” Hans Robert Jauss—to use the words of Jorge Semprún—traveled the very short, and at the same time very long, path from Buchenwald to Weimar: a path that first led him into the most abysmal, reprehensible, and rational form of human barba- rism, which he wished to leave behind him as quickly as possible after the end of the war. His path to Weimar, as the symbol of a “refined” western culture, was extremely short: indeed, all too short. -
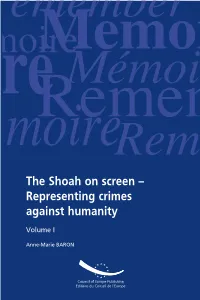
The Shoah on Screen – Representing Crimes Against Humanity Big Screen, Film-Makers Generally Have to Address the Key Question of Realism
Mémoi In attempting to portray the Holocaust and crimes against humanity on the The Shoah on screen – representing crimes against humanity big screen, film-makers generally have to address the key question of realism. This is both an ethical and an artistic issue. The full range of approaches has emember been adopted, covering documentaries and fiction, historical reconstructions such as Steven Spielberg’s Schindler’s List, depicting reality in all its details, and more symbolic films such as Roberto Benigni’s Life is beautiful. Some films have been very controversial, and it is important to understand why. Is cinema the best way of informing the younger generations about what moire took place, or should this perhaps be left, for example, to CD-Roms, videos Memoi or archive collections? What is the difference between these and the cinema as an art form? Is it possible to inform and appeal to the emotions without being explicit? Is emotion itself, though often very intense, not ambivalent? These are the questions addressed by this book which sets out to show that the cinema, a major art form today, cannot merely depict the horrors of concentration camps but must also nurture greater sensitivity among increas- Mémoire ingly younger audiences, inured by the many images of violence conveyed in the media. ireRemem moireRem The Shoah on screen – www.coe.int Representing crimes The Council of Europe has 47 member states, covering virtually the entire continent of Europe. It seeks to develop common democratic and legal princi- against humanity ples based on the European Convention on Human Rights and other reference texts on the protection of individuals. -

German Videos Use the Find Function to Search This List
German Videos Use the Find function to search this list Aguirre, The Wrath of God Director: Werner Herzog with Klaus Kinski. 1972, 94 minutes, German with English subtitles. A band of Spanish conquistadors travels into the Amazon jungle searching for the legendary city of El Dorado, but their leader’s obsessions soon turn to madness.LLC Library CALL NO. GR 009 Aimée and Jaguar DVD CALL NO. GR 132 Ali: Fear Eats the Soul Director: Rainer Werner Fassbinder. with Brigitte Mira, El Edi Ben Salem. 1974, 94 minutes, German with English subtitles. A widowed German cleaning lady in her 60s, over the objections of her friends and family, marries an Arab mechanic half her age in this engrossing drama. LLC Library CALL NO. GR 077 All Quiet on the Western Front DVD CALL NO. GR 134 A/B Alles Gute (chapters 1 – 4) CALL NO. GR 034-1 Alles Gute (chapters 13 – 16) CALL NO. GR 034-4 Alles Gute (chapters 17 – 20) CALL NO. GR 034-5 Alles Gute (chapters 21 – 24) CALL NO. GR 034-6 Alles Gute (chapters 25 – 26) CALL NO. GR 034-7 Alles Gute (chapters 9 – 12) CALL NO. GR 034-3 Alpen – see Berlin see Berlin Deutsche Welle – Schauplatz Deutschland, 10-08-91. [ Opening missing ], German with English subtitles. LLC Library Alpine Austria – The Power of Tradition LLC Library CALL NO. GR 044 Amerikaner, Ein – see Was heißt heir Deutsch? LLC Library Annette von Droste-Hülshoff CALL NO. GR 120 Art of the Middle Ages 1992 Studio Quart, about 30 minutes. Masterpieces of the Hermitage – Museum of St. -

Ehs Otheraustrians.Pdf
table of contents Thomas Gergen: Regionalsprachen in Frankreich: Zersplitterung der einheitlichen Republik? . .2 Sebastian Krafzik: Licet iuris – Gefecht um die Macht zwischen Kaiser und Papst . 6 Christoph Schmetterer: Rechtsvorschriften zur Hausnummerierung in Österreich von 1770 bis heute . 11. Tamara Ehs: The Other Austrians . 16. Tamás Nótári: Some Remarks on ius vitae ac necis and ius exponendi . 28. Magdolna Gedeon: Juristische Regelung der Einführung und der Organisation der Zirkusspiele im alten Rom bis zur Prinzipatszeit . .39 . Eszter Cs. Herger: Alimony in Hungarian Family Law in the 19th Century . 43. Gábor Schweitzer: Legal Education and Ethos of the Legal Profession in Hungary in the Civil Era . 51. Norbert Varga: The Codification of the Law of Conflict of Interest (incompatibilitas) in Hungary in the 19th Century . 55. Alberto Iglesias Garzón: Reformation of Law Administration in Jean Domat‘s Masterworks . 59. Magdolna Szűcs: “Creditor rem sibi oppignoratam a debitore emere non potest” (Brev . IP . 2, 12, 6) . .65 . Mirela Krešić: Entitlement of Female Descendants to Property of Croatian Communal Household . .73 . Przemysław Dąbrowski: Union of Brest and its Dissolution on the Territories of the Congress Kingdom of Poland, Belarusian and Lithuanian Lands . 86. Anna Klimaszewska: General Principles in the Commercial Code of France of 1807 . 91. Jakub H. Szlachetko: The Geopolitical Thought of Józef Piłsudski and his Political Camp Concerning Central Europe in Comparison to the Achievements of Other Political Centers . 95. Kamila Kędzierska: The Internal Organization and Supervision as Vital Issues in Post-War County Administration in Poland . 100. Michaela Uhlířová: Punishments Connected with Person of Offender in Selected Countries Editorial staff JOURNAL of Ancient World .