Dissertation.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Complex Dynamics Between German Citizens and Turkish Immigrants
The Complex Dynamics between German Citizens and Turkish Immigrants Jesse Jones, West Texas A&M University abstract: This article examines the latest immigration trends into Western Europe, particularly the immigration of Turks to Ger- many. The origins of Turkish immigration and German immigration law are reviewed. Turkey’s bid for European Union membership is examined historically and opinions about how this potential European Union member has caused controversy and how Turkey could change the face of the European Union will be discussed. Attitudes of German citizens toward immigrants are examined using data from the European Values Survey (EVS). Tests show that religion and possibly education level play a role in determining the attitude of German citizens toward immigrants, the majority of whom are Turkish. Introduction1 Turkey in particular, but will also examine attitudes to- ward Turkey’s proposed ascension as a member state of Immigration has always raised concerns for sovereign the European Union itself. If accepted, Turkey would dra- states. Among these concerns: immigrants may refuse matically alter the demography of the European Union to assimilate, they may decrease the standard of living, and redefine what it means to be European. crime rates might increase, or they may take jobs away from non-immigrant citizens. One famous focal point of these concerns is along the southern border of the History of Turkish Immigration, German United States and Mexico, but in other areas of the world Immigration Laws, and Reform immigration is just as controversial an issue as it is on the North American Continent. As the twentieth century progressed, incentives for in- Western Europe has been experiencing an immigra- creased immigration to Europe began to be felt in the tion surge, primarily individuals from underdeveloped Middle East and in Turkey. -

1476620137807.Pdf
Since the middle of the twentieth century Africa, and Sub-Saharan Africa in particular, has been dogged by war and its ever present partners; conquest, famine and death. Much debate can be, and is, had about who or what is to blame for this sorry state of affairs, and what is certain is that there are no shortage of political commentators who are all too happy to tell you their theories. In B’Maso I have attempted, but not always succeeded, to avoid any such postulating. Instead of politics, what the gamer will find inside is lots of information that will, I hope, allow him to refight a selection of African wars, stretching from the 1950s up to the 1990s across thousands of miles and hundreds of cultures. There are rule changes and additions that will help the gamer produce games that capture the feel of the various conflicts – some generic to Africa, others specific to one conflict. As will be seen, so much of the fighting in Africa was, in effect, the embodiment of the cold war fought by proxies. This can mean that all sorts of weird and wonderful equipment can turn up, from pre-WWII armoured trucks to the most modern technology. In many places it is impossible to provide detailed orders of battle, as formations operated on an entirely ad hoc basis, using anything that they could lay their hands on. What we have done throughout, however, is provide information on organisational structures and equipment that was used by the various nations, factions, tribes and groups. -

The Evolution of German Media Coverage of Migration
The Evolution of German Media Coverage of Migration Gualtiero Zambonini Commissioner for Integration Westdeutscher Rundfunk (WDR) The Migration Policy Institute is an independent, nonpartisan, nonprofit think tank dedicated to the study of the movement of people worldwide. About the Transatlantic Council on Migration This paper was commissioned by the Transatlantic Council on Migration for its meeting held in May 2009 in Bellagio, Italy. The meeting’s theme was “Public Opinion, Media Coverage, and Migration” and this paper was one of several that informed the Council’s discussions. The Council is an initiative of the Migration Policy Institute undertaken in cooperation with its policy partner, the Bertelsmann Stiftung. The Council is a unique deliberative body that examines vital policy issues and informs migration policymaking processes in North America and Europe. For more on the Transatlantic Council on Migration, please visit: www.migrationpolicy.org/transatlantic © 2009 Migration Policy Institute. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopy, or any information storage and retrieval system, without permission from the Migration Policy Institute. A full-text PDF of this document is available for free download from www.migrationpolicy.org. Permission for reproducing excerpts from this report should be directed to: Permissions Department, Migration Policy Institute, 1400 16th Street NW, Suite 300, Washington, DC 20036, or by contacting [email protected] Suggested citation: Zambonini, Gualtiero. 2009. The Evolution of German Media Coverage of Migration. Washington, DC: Migration Policy Institute. I. Executive Summary The German media has helped reinforce the image of immigrants as “foreigners” and “aliens” — sometimes even in exaggerated terms — since the first guest workers came to Germany in the 1950s and 1960s. -

Third Migration Mirjam Karoly
PROJECT EDUCATION OF ROMA | HISTORY ROMA CHILDREN COUNCIL CONSEIL OF EUROPE DE L´EUROPE IN EUROPE THIRD 7.0 MIGRATION Third Migration Mirjam Karoly Migration in the Course of Recruiting “Foreign Workers” | Going West – The Fall of the Iron Curtain | Looking for Political Asylum – Migration since the Mid-90s | Fleeing War in Former Yugoslavia | Being a Migrant in a Foreign Country After the first appearance of Roma in Europe and the wave of emigration after slavery was abolished in Romania (“Second Migration”, around 1850), the last migratory movement of Roma from Eastern to Western Europe took place in the second half of the 20th century. This “third migration” has to be considered in connection with external factors: war, political changes and the resulting economic crises made many people leave their country of origin; in the Roma’s case, massive racism and discrimination in all areas of everyday life have to be added. THE NETHERLANDS 1 SWEDEN REFUGEES FROM HUNGARY IN 1956 MAIN ROUTES OF THE During the Hungarian Uprising in 1956, 150.000 peo- GERMANY ple fled Hungary, among them many Roma, particularly GRAT BRITAIN RD 3 MIGRATION Lovara families, who were received mainly in Austria. Ill. 1 FOREIgn WORKERS, 2 1960s AND 1970s Yugoslavian Roma, mostly from the poorer regions of FRANCE Serbia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Bosnia-Herzegovina emigrated to Western Europe, the AUSTRIA strongest migration taking place in Italy, Austria, Ger- SWITZERLAND many, France, and the Netherlands. USA 1 3 HUngARY ROMANIA REFUGEES FROM 3 ROMANIA, 1990-1995 ITALY ASYLUM-SEEKERS FROM 4 BOSNIA-HERCEGOVINA, 1991-1995 4,2 Ten thousand Roma fled the war in Bosnia-Herzegovina BOSNIA SERBIA from 1991 to 1995, and demanded political asylum in Aust- 2 ria, Italy, Sweden, Great Britain, Germany and Switzerland. -

Workshop Programme Labour Migration in the Cold War and Beyond
Workshop Programme Labour Migration in the Cold War and Beyond: New Questions, Methods and Sources 28th-30th June 2021 Online: Zoom Platform. Please register at the link below to receive the link https://www.eventbrite.co.uk/e/workshop-labour-migration-in-the-cold-war-and-beyond-tickets-159481189531 Monday, June 28th 2021 (12:00 to 16:00 BST) 12:00 – 12:15 Welcome Organisers: Sara Bernard (University of Glasgow) Yannis G. S. Papadopoulos (University of Brasilia) Rory Archer (University of Konstanz & University of Graz) 12:15 - 13:00 Panel 1. Research on migration at the University of Glasgow Chair: Sara Bernard (University of Glasgow) Francesca Stella (University of Glasgow). Glasgow Refugee Asylum and Migration Network (GRAMNET) Rebecca Kay (University of Glasgow). Postsocialist Migrations: geopolitical transformations, social in/securities and the search for a ‘better life’ Panos Theodoropoulos (University of Glasgow). Using covert participant observation to understand experiences of labour migration, precarity, and resistance David Smith (University of Glasgow). Europe-Asia Studies journal 13:00-13:15 short break 13:15-14:15 Panel 2. Guestworker Migration, Colonialism and Development: European and American experiences Chair: Rory Archer (University of Konstanz & University of Graz) Ismael Garcia Colon (College of Staten Island and CUNY Graduate Center). Regulating Colonial Migration: The Farm Labor Program of the Government of Puerto Rico 1940-1990s Michelle Lynn Kahn (University of Richmond). Third World Development Aid and the Politics of Return Migration: The case of Turkish Guest Workers in West Germany, 1970s-1980s Discussant: Emmanuel Comte (CIDOB Barcelona) 14:15-14:30 short break 14:30-15:30 Panel 3. -

Bibliografie Zum Staatssicherheitsdienst Der DDR
Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR – 2018 .bstu.de w ww Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR Stand: Dezember 2018 BStU Bibliografie zum Fachbibliothek Staatssicherheitsdienst der DDR Stand: Dezember 2018 BStU Bibliografie zum Fachbibliothek Staatssicherheitsdienst der DDR Inhalt Vorbemerkung 4 1. Hilfsmittel (Bibliografien, Nachschlagewerke, Quellenkunde und Archivberichte) 5 2. Apparat und Tätigkeit des MfS 15 2.1. Vor 1990 erschienene Literatur 15 2.2. Allgemeine und Überblicksdarstellungen 19 2.3. Vorgeschichte des MfS 35 2.4. Apparat des MfS 41 2.5. Inoffizielle Mitarbeit und operative Methoden 66 2.6. Internationale Verbindungen 111 3. Einzelne staatliche und gesellschaftliche Bereiche 118 3.1. Spionage und Westarbeit 118 3.2. Politische Justiz 166 3.3. Opposition und Verfolgung 210 3.4. Staatssicherheit und Kirche 279 3.5. Staatssicherheit in Wissenschaft, Kultur und Medien 310 3.6. Staatssicherheit in der Wirtschaft 357 3.7. Sonstige Bereiche 371 3.8. Wendegeschehen und Auflösung des Staatssicherheitsdienstes 414 4. Angrenzende Themenbereiche 442 4.1. Andere Sicherheitsorgane und sicherheitspolitische Gremien der DDR 442 4.2. Sonstige Literatur zu Geheimdiensten (Auswahl) 457 5. Aktuelle Themen 467 5.1. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz und seine Anwendung 467 5.2. Juristische Aufarbeitung 506 5.3. Weitere politische Aufarbeitung 541 6. Biografien 591 6.1. Sammelbiografien (auch biografische Handbücher) 591 6.2. Einzelbiografien und biografische Schriften 597 Autoren- und Herausgeberregister 640 Stand: Dezember -

Archive Und Migration
Archive und Migration Vorträge des 73. Südwestdeutschen Archivtags am 21. und 22. Juni 2013 in Stuttgart Herausgegeben von Roland Deigendesch und Peter Müller Verlag W. Kohlhammer Stuttgart 2014 F-01.indd 1 10.04.2014 13:55:04 Titelbild: Italienische Gastarbeiter im Zug am Freiburger Hauptbahnhof im Dezember 1966, darüber die Informationen für und über Ausländer vom März 1987 und ein Plakat für ein internationales Fußballturnier in Stuttgart-Hausen im Jahr 1980 (Fotomontage). Vorlagen: Landesarchiv Baden-Württemberg Staatsarchiv Freiburg Fotosammlung Willy Pragher W 134 Nr. 072192d sowie Stadtarchiv Stuttgart Bestand 1062 A.R.C.E.S. e. V. Stuttgart Nr. 6 und Nr. 7. P Gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier Alle Rechte vorbehalten © 2014 by Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart Gestaltung: satzwerkstatt Manfred Luz, Neubulach Druck: Asterion Germany GmbH, Viernheim Kommissionsverlag: W. Kohlhammer Stuttgart GmbH, Stuttgart Printed in Germany ISBN 978-3-17-025766-5 F-01.indd 2 14.04.2014 12:11:55 Inhalt 4 Vorwort Gerhard Melinz 51 Archive und Migration. Roland Deigendesch Ein Bericht aus Österreich 6 Einführung Nasrin Saef 58 Bettina Severin-Barboutie Das Dokumentationsprofi l Migration. 10 Historische Mi gra tionsforschung auf dem Pluralität der Kommune auch im Prüfstand Archivbestand Sandra Kostner Jürgen Lotterer 69 Vereinsüberlieferung als Zugang zur lokalen 18 Partizipation durch Diversitätsorientierung. Mi gra tionsgeschichte Öff nung kultureller Einrichtungen für bislang unterrepräsentierte Gruppen Anja Dauschek 78 Meine Stadt – mein Museum. Michael Stephan Städtische Mi gra tionsgeschichte sammeln in 25 Archive und Migration. Ein Sachstandsbericht einem Museum. Daniel Peter 94 Die Autorinnen und Autoren 38 Archive und Mi gra tionsgeschichte aus französischer Sicht 3 F-01.indd 3 10.04.2014 13:55:45 Robert Kretzschmar Vorwort Vorwort Der 73. -

From Sons of Gastarbeita to Songs of Gastarbeiter Migrant and Post-Migrant Integration Through Music and German Musical Diplomacy from the 1990S to the Present
From Sons of Gastarbeita to Songs of Gastarbeiter Migrant and Post-Migrant Integration through Music and German Musical Diplomacy from the 1990s to the Present Gesa zur Nieden “Rap was communication-music as opposed to reference-music.” This is how sociologist of music, Antoine Hennion, describes early US-American and European rap in one of his articles on mediators of music. By examining espe- cially non-human mediators such as “scores, texts, sound, instruments, reper- toires, staging, concert venues, and media,” Hennion emphasizes the fact that the concern of rap “was not with music as a beautiful object or a purveyor of musi- cal truth in a reconstituted collectivity […]. Instead what counted was the individual performance in the present with whatever means at hand and with success measured by how that performance is judged relative to the performanc- es of one’s rivals” (432). According to this communication-based description, which highlights the dimension of battle and rivalry, rap music and hip-hop culture would not seem to be useful media of communication within transnational public diplomacy. Due to their centering of individuals and their competitive dimensions, rap and hip-hop seemingly oppose the diplomatic purpose of purveying a positive cultural image of a certain state based on “reference-music,” even if recent public diplomacy scholars have pointed out the importance of direct and individual exchange with 278 | Gesa zur Nieden a “strong human factor” by focusing on so-called people-to-people exchange.1 But despite the fact that rap music and lyrics might convey negative cultural images and “bad policies” that have to be avoided in public diplomacy (Scott- Smith 55), rap and hip-hop have been frequently employed in German public diplomacy of the last 20 years. -

The Aeronautical and Space Industries of the Community Compared with Those of the United Kingdom and - the United States
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES The aeronautical and space industries of the Community compared with those of the United Kingdom and - the United States GENERAL REPORT Volume 4 COMPETITION INDUSTRY - 1971 - 4 I Survey carried out on behalf of the Commission of the European Communities (Directorate- General for Industry) Project coordinator: Mr Felice Calissano, with the assistance of Messrs Federico Filippi and Gianni Jarre of Turin Polytech nical College and Mr Francesco Forte of the University of Turin SORIS Working Group : Mr Ruggero Cominotti Mr Ezio Ferrarotti Miss Donata Leonesi Mr Andrea Mannu Mr Jacopo Muzio Mr Carlo Robustelli Interviews with government agencies and private companies conducted by : Mr Felice Calissano Mr Romano Catolla Cavalcanti Mr Federico Filippi Mr Gianni Jarre Mr Carlo Robustelli July 1969 I No. 7042 SORIS spa Economic studies, market research 11, via Santa Teresa, Turin, Italy Tel. 53 98 65/66 The aeronautical and space industries of the Community compared \ with those of the United Kingdom and the United States STUDIES Competition Industry No.4 BRUSSELS 1971 THE AERONAUTICAL AND SPACE INDUSTRIES OF THE COMMUNITY COMPARED WITH THOSE OF THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES VOLUME 1 The aeronautical and space research and development VOLUME 2 The aeronautical and space industry VOLUME 3 The space activities VOLUME 4 The aeronautical market VOLUME 5 Technology- Balance of payments The role of the aerospace industry in the economy Critical assessment of the results of the survey CHAPTER 3 The aeronautical market ! Contents PART 1 THE MARKET FOR CIVIL AIRCRAFT 1 • INTRODUCTION 675 2. TYPES OF AIRCRAFT 675 NUMBERS OF AIRCRAFT 680 3.1 Total Number 680 3.2 Breakdown by Type of Aircraft and by Country 688 4. -

The Gastarbeiter Policy in Post-War Germany
Dimitrios K. Apostolopoulos Senior Researcher – Academy of Athens http://www.academyofathens.gr/researchers/apostolopoulos [email protected] / +30-6972095840 Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος Κύριος Ερευνητής Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) Ακαδημία Αθηνών The Gastarbeiter policy in post-war Germany Paper presented in the 3rd International Conference in Economic and Social History “Labour History: production, markets, relations, policies (from the late Middle ages to the early 21st century)”, which organized by the Greek Economic History Association and the Department of History & Archaeology of the University of Ioannina (Ioannina, 24-27 May 2017). Posted in the website www.hdoisto.gr, May 2018. Summary This paper is based on primary sources from German archives and focuses on the organisation and development of the migration flow from Mediterranean countries to Western Germany during the early post-war period, with particular regard to the Greek example as it is documented in the German archives. This emigration flow took place after the official interstate agreements (i.e. of March 1960 for the Greek-German agreement) and those emigrants were called “guest-workers”-“Gastarbeiter”. The migrant workers believed that the German Federal Republic would offer higher living standards to themselves and their children. In reality however, their lives were determined by the needs and interests of the country of origin and the host country. The former hurried to unburden itself from labour workforces it could not absorb, -
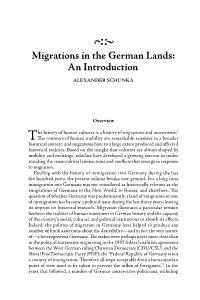
Migrations in the German Lands: an Introduction ALEXANDER SCHUNKA
12 Migrations in the German Lands: An Introduction ALEXANDER SCHUNKA Overview he history of human cultures is a history of migrations and movements.1 TThe contours of human mobility are remarkably sensitive to a broader historical context, and migrations have to a large extent produced and affected historical realities. Based on the insight that cultures are always shaped by mobility and exchange, scholars have developed a growing interest in under- standing the cross-cultural connections and conflicts that emerge in response to migration. Dealing with the history of immigration into Germany during the last five hundred years, the present volume breaks new ground. For a long time, immigration into Germany was not considered as historically relevant as the emigrations of Germans to the New World, to Russia, and elsewhere. The question of whether Germany was predominantly a land of emigration or one of immigration has become a political issue during the last thirty years, leaving its imprint on historical research. Migration illustrates a particular tension between the realities of human movement in German history and the capacity of the country’s social, cultural, and political institutions to absorb its effects. Indeed, the politics of migration in Germany have helped to produce any number of frank assertions about the desirability—and in fact the very nature of—a heterogeneous Germany. The stakes were perhaps never more clear than in the political statements originating in the 1982 federal coalition agreement between the West German ruling Christian Democrats (CDU/CSU) and the liberal Free Democratic Party (FDP): the “Federal Republic of Germany is not a country of immigration. -

Germany's Guestworkers
_.. • _fi--· ---------- - Germany's Guestworkers PHILIP L. MARTIN t It is a myth that guestworkers represent a labor subsidy . to some employers, with'out cost to society as a whole. \'Temporary migration" soon becomes Permanent, and bytlie all costs taxpayers. of integrating new minority families are borne Au,lander rpu,! 'l'he ~ogau appe.,, fre<Juently in streetside graffiti. The right-wing NationaJ-demokra. tische Partei Deutschland (NPD) made "Foreigners number of Mexicans to work in this country six out. Germany for the Germans!" its slogan during months each year. President Reagan is known to be the October 1980 election. Expert opinion says that farn,,bJe to sech a VCogc,n,, He ceported/y di~ a maiority of Germans would prefer to see most of cussed a migrant worker program with Mexico's the foreigners leave. Most Germans now believe l're,ident ,Jo,, LOpez Portillo sho,tly before lakiog that the 20-year attempt to spur economic growth office in January 1981, and renewed these discus benefits.with foreign workers is producing more costs than sions during the Mexican President's visit to Wash ington in June. Given our illegal immigration, what The German mi1m1nt labor experiment is going solution?can we learn from the Germans about a guest worker awry just when the United States may begin a mi grant worker program with Mexico. Senators Raya. 'fhe 4.5 millioo foreigne,s io Ge,maoy a,e lf,e kawa (R-Ca.) and Schmitt (R-NM) have proposed last vestige of the waves of Gastarbeiter imported a "companero" program to permit an unspecified between 1960 and 1973 to help fuel noninflation a.ty economic growth.