Pariser Historische Studien Bd. 82 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

H-France Review Volume 18 (2018) Page 1
H-France Review Volume 18 (2018) Page 1 H-France Review Vol. 18 (February 2018), No. 31 Julien Léonard, Le pasteur David Ancillon (1617-1692). De Metz à Berlin, de la France au Refuge. Metz: Éditions des Paraiges, 2017. 363 pp. Illustrations, bibliography, and index. 20 € (pb). ISBN 978-2- 37535-039-3. Review by Raymond Mentzer, University of Iowa. While scholars have long studied the ministers of the French Reformed Churches during the early modern period, attention has tended to focus on their theological treatises and published sermons. Organizational endeavors, pastoral care, and the relationship between ministers and their congregations have drawn less interest. Only in the past several decades have historians begun to redress the imbalance. Various projects seek to identify the members of the Reformed pastorate, most of whose names appear but fleetingly in the scattered manuscript documents. Constructing brief biographies of the myriad of individuals has proven even more challenging. Albert Sarrabère, who has taken the first tentative steps, offers one of few examples.[1] Accordingly, Julien Léonard’s research and publication program is especially welcome. He has rapidly established himself among the leading scholars of the Reformed Church of Metz and its pastorate during the seventeenth century. Léonard’s doctoral dissertation, subsequently published as Être pasteur au XVIIe siècle. Le ministère de Paul Ferry à Metz (1612-1669), is a comprehensive and illuminating study of the Protestant ministry under the provisions of the Edict of Nantes (1598-1685).[2] Paul Ferry, Reformed pastor at Metz from 1612 until his death in 1669, was, in Léonard’s view, the very model of the pastoral ministry. -
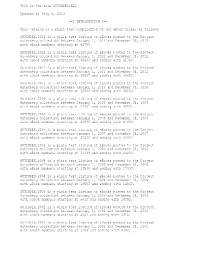
This Is the File GUTINDEX.ALL Updated to July 5, 2013
This is the file GUTINDEX.ALL Updated to July 5, 2013 -=] INTRODUCTION [=- This catalog is a plain text compilation of our eBook files, as follows: GUTINDEX.2013 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2013 and December 31, 2013 with eBook numbers starting at 41750. GUTINDEX.2012 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2012 and December 31, 2012 with eBook numbers starting at 38460 and ending with 41749. GUTINDEX.2011 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2011 and December 31, 2011 with eBook numbers starting at 34807 and ending with 38459. GUTINDEX.2010 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2010 and December 31, 2010 with eBook numbers starting at 30822 and ending with 34806. GUTINDEX.2009 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2009 and December 31, 2009 with eBook numbers starting at 27681 and ending with 30821. GUTINDEX.2008 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2008 and December 31, 2008 with eBook numbers starting at 24098 and ending with 27680. GUTINDEX.2007 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2007 and December 31, 2007 with eBook numbers starting at 20240 and ending with 24097. GUTINDEX.2006 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2006 and December 31, 2006 with eBook numbers starting at 17438 and ending with 20239. -

Edmund Burke's German Readers at the End of Enlightenment, 1790-1815 Jonathan Allen Green Trinity Hall, University of Cambridg
Edmund Burke’s German Readers at the End of Enlightenment, 1790-1815 Jonathan Allen Green Trinity Hall, University of Cambridge September 2017 This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Declaration This dissertation is the result of my own work and includes nothing which is the outcome of work done in collaborations except as declared in the Declaration and specified in the text. All translations, unless otherwise noted or published in anthologies, are my own. It is not substantially the same as any that I have submitted, or, is being concurrently submitted for a degree or diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University of similar institution except as declared in the Declaration and specified in the text. I further state that no substantial part of my dissertation has already been submitted, or, is being concurrently submitted for any such degree, diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Declaration and specified in the text. It does not exceed the prescribed word limit for the Faculty of History Degree Committee (80,000 words). Statement of Word Count: This dissertation comprises 79,363 words. 1 Acknowledgements Writing this dissertation was a challenge, and I am immensely grateful to the many friends and colleagues who helped me see it to completion. Thanks first of all are due to William O’Reilly, who supervised the start of this research during my MPhil in Political Thought and Intellectual History (2012-2013), and Christopher Meckstroth, who subsequently oversaw my work on this thesis. -

The Eroticism of Emasculation: Confronting the Baroque Body of the Castrato Author(S): Roger Freitas Freitas Source: the Journal of Musicology, Vol
The Eroticism of Emasculation: Confronting the Baroque Body of the Castrato Author(s): Roger Freitas Freitas Source: The Journal of Musicology, Vol. 20, No. 2 (Spring 2003), pp. 196-249 Published by: University of California Press Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.1525/jm.2003.20.2.196 Accessed: 03-10-2018 15:00 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms University of California Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Journal of Musicology This content downloaded from 146.57.3.25 on Wed, 03 Oct 2018 15:00:19 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms The Eroticism of Emasculation: Confronting the Baroque Body of the Castrato ROGER FREITAS A nyone who has taught a survey of baroque music knows the special challenge of explaining the castrato singer. A presentation on the finer points of Monteverdi’s or Handel’s art can rapidly narrow to an explanation of the castrato tradition, a justification 196 for substituting women or countertenors, and a general plea for the dramatic viability of baroque opera. As much as one tries to rationalize the historical practice, a treble Nero or Julius Caesar can still derail ap- preciation of the music drama. -

The Law of Nations and Natural Law 1625–1800
The Law of Nations and Natural Law 1625– 1800 Simone Zurbuchen - 978-90-04-38420-0 Downloaded from PubFactory at 09/19/2019 09:19:14AM via University of Lausanne Early Modern Natural Law STUDIES & SOURCES Series Editors Frank Grunert (Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg) Knud Haakonssen (University of St Andrews and Universität Erfurt) Diethelm Klippel (Universität Bayreuth) Board of Advisors Maria Rosa Antognazza (King’s College London) John Cairns (University of Edinburgh) Thomas Duve (Max- Planck- Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main) Ian Hunter (University of Queensland) Martin Mulsow (Universität Erfurt) Barbara Stollberg- Rilinger (Westfälische Wilhelms- Universität Münster and Wissenschaftskolleg zu Berlin) Simone Zurbuchen (Université de Lausanne) VOLUME 1 The titles published in this series are listed at brill.com/ emnl Simone Zurbuchen - 978-90-04-38420-0 Downloaded from PubFactory at 09/19/2019 09:19:14AM via University of Lausanne The Law of Nations and Natural Law 1625– 1800 Edited by Simone Zurbuchen LEIDEN | BOSTON Simone Zurbuchen - 978-90-04-38420-0 Downloaded from PubFactory at 09/19/2019 09:19:14AM via University of Lausanne This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC-ND 4.0 License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. The publication of this book has been made possible with the support of the Swiss National Science Foundation. Cover illustration: Portrait of Emer de Vattel. © Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Switzerland. The Library of Congress Cataloging- in- Publication Data is available online at http:// catalog.loc.gov LC record available at http:// lccn.loc.gov/2019023142 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. -

Les Huguenots Du Pays Messin Sur Les Chemins De L'exil
les huguenots du pays messin sur les chemins de l’exil 50 philippe hoch Le départ, à partir de l’automne 1685, d’un quart environ des quelque 800 000 protestants que comptait alors le royaume de France constitue l’un des grands phénomènes migratoires en Europe à la période moderne. En effet, dans les semaines et les mois qui suivirent la révocation de l’édit de Nantes, entre 170 000 et 200 000 huguenots prirent le chemin de l’exil, poussés par des raisons de nature évidemment religieuse, mais auxquelles se joignaient parfois aussi des motivations économiques et, dans un second temps, un désir de regroupement familial, le chef de famille exilé faisant venir auprès de lui les siens demeurés « prisonniers de Babylone » [ill. 1]. De ce tableau, les huguenots messins ne sont pas absents. En effet, très (1) – Gérard MICHAUX, « Les tôt, les idées nouvelles de Luther, puis de Calvin et de ses disciples, Réformés messins aux XVIe et XVIIe en particulier Guillaume Farel [ill. 2], pénétrèrent dans la cité épisco- siècles », dans Philippe HOCH (dir.), pale et dans son plat pays. Au moment de son apogée, dans la seconde huguenots. de la moselle à berlin, moitié du XVIe siècle, et avant de connaître un relatif déclin, la les chemins de l’exil, Metz, communauté réformée messine occupa une place de premier plan, Éd. Serpenoise, 2006, p. 37. notamment au sein des élites ; ainsi, dans le cercle des échevins ou dans la bourgeoisie marchande. Comme le souligne Gérard Michaux, « puissante par le nombre, l’Église de Metz l’est aussi par son assise sociale (1) ». -

Hugenotten Und Deutsche Territorialstaaten Les Etats Allemands Et Les Huguenots
Hugenotten und deutsche Territorialstaaten Les Etats allemands et les huguenots deutsches historisches institut historique allemand paris Pariser Historische Studien herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris Band 82 R. Oldenbourg Verlag München 2007 Hugenotten und deutsche Territorialstaaten Immigrationspolitik und Integrationsprozesse r Les Etats allemands et les huguenots Politique d'immigration et processus d'integration herausgegeben von Guido Braun und Susanne Lachenicht R. Oldenbourg Verlag München 2007 Pariser Historische Studien Herausgeber: Prof. Dr. Werner PARAVICINI Redaktion: Veronika VOLLMER Institutslogo: Heinrich PARAVICINI, unter Verwendung eines Motivs am Hotel Duret-de-Chevry Anschrift: Deutsches Historisches Institut (Institut historique allemand) Hötel Duret-de-Chevry, 8, rue du Parc-Royal, F-75003 Paris Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. © 2007 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München Rosenheimer Straße 145, D-81671 München Internet: oldenbourg.de Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzu- lässig und strafbar. Dies gilt insbesondere fur Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover- filmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen. -

Pariser Historische Studien Bd. 82 2007
Pariser Historische Studien Bd. 82 2007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hi- nausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. VIVIANE ROSEN-PREST HISTORIOGRAPHIE ET INTÉGRATION CULTURELLE L'exemple des »Mémoires des Réfugiés« d'Erman et Reclam Pour observer le degré d'intégration d'une communauté, l'un des moyens dont on dispose est d'observer quelle historiographie elle a produite. Or, en Prusse, c'est à la fin du XVIIIe siècle, un siècle environ après la proclamation de l'édit de Potsdam, qu'est apparue une historiographie extrêmement intéressante. Il s'agit des »Mémoires pour servir à l'Histoire des Réfugiés François dans les Etats du Roi«, des pasteurs berlinois Erman et Reclam, neuf petits volumes in-octavo, publiés à Berlin entre 1782 et 1799 1• Cet ouvrage fameux constitue un important indicateur de l'acculturation accomplie en un siècle par les hu guenots de Prusse. En effet, si le livre a pour objet les premiers temps du Re fuge et leurs effets sur le Brandebourg-Prusse, les auteurs s'adressent à leurs contemporains, dont ils veulent être à la fois les archivistes et la conscience. -

Zwei Schlüssel
Zwei Schlüssel Zur Geschichte des Französischen Gymnasiums Herausgegeben von Bernhard Frank und Rolf Gehrmann Berlin 2014 ISBN 978-3-00-047294-7 Selbstverlag R.G. Titelbild: Truhe aus dem Hugenottenmuseum Berlin, mit freundlicher Genehmigung des Museums aufgenommen von Fabian Gehrmann Mot de la Direction En complément d’un premier volume consacré pour l´essentiel aux souvenirs des anciens, en voici un second à l´occasion du 325e anni- versaire du Collège français / Französisches Gymnasium. Celui-ci élargit l´horizon historique et temporel et nous fait prendre con- science qu´aucun autre lycée berlinois n´est doté d’une structure si spécifique et d´une histoire aussi longue alors que les débuts furent si fragiles. Aucun lycée ou collège du réseau de l´AEFE ne présente une tradition comparable. Notre établissement est une institution unique, mais tout à la fois un lycée berlinois et un établissement français, ce qui lui confère deux apparences sous une même réalité. Et pourtant c’est une unité, fruit d´un travail commun de plus de soixante ans. Le développer pour le bien des élèves, telle est notre mission. Ce jubilé ne sera donc pas le dernier, puisque les conditions essentielles sont remplies : „L´une est la possession en commun d´un riche legs de souvenirs; l´autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l´héritage qu´on a reçu indivis“ (Renan). Dans cet esprit – puisse le regard sur le passé nous encourager à construire un avenir com- mun. Grußwort Nach dem ersten Teil der Festschrift zur 325-Jahr-Feier des Franzö- sischen Gymnasiums / Collège français, welche aus den Erinnerun- gen der Ehemaligen erwachsen ist, eröffnet dieser zweite Band eine tiefere historische Dimension. -

ELIE BENOIST, HISTORIAN of the EDICT of NANTES by Charles F
ELIE BENOIST, HISTORIAN OF THE EDICT OF NANTES by Charles F. Johnston | 1 The revocation in I685 by Louis XIV of the Edict of Nantes resulted in the immediate exile of all ministers of the Reformed Churchepiot amenable to conversion, the illegal flight of several hundred thousand of their fellow-believers to neighbour ing Protestant lands, and the nominal conversion under duress of the rest to the Roman Catholic Church. It also precipitated a literary polemic in which Protestant writers protested vigorously the injustice of revoking an "irrevocable" edict, and the cruel and oppressive measures preceding and accompanying it, while Roman Catholic counter parts asserted that on the contrary the Edict had been a temporary expedient to end civil strife, extorted forcibly by a naturally rebellious and turbulent minority. This issue was indeed the culmination of a controversy of long standing. In a recent book Elizabeth Israels Perry has pointed out that after more than a century in which the Protestant-Catholic polemic had focussed upon disputed points of doctrine the arena of battle had shifted. Between 1671 and I69I history replaced theology as the focus of debate in France: Perry has examined more than a hundred books and pamphlets comprising this literature which appeared in those two decades. It includes works by Nicole, Claude, Maimbourg, Bayle, Varillas, Jurieu, Bossuet, and Ancillon.^ It was in response to the Revocation auid the questions it aroused that Elie Benoist, former minister of Alenin, at the time Refugee minister of the Walloon Church in Delft, undertook the task of writing a history of the Edict of Nauates itself: out of what circumstances it arose, how it was obtained, what its terms were and under what guarantees, how and in what degree it was implemented, how it was circumvented, under mined, eroded, and finally annihilated. -

N N Rlf D" . D D D O 0 Miiih 00 00 0 00 D O Il T:I 0 000 000 00 Lao D.= D D D 0 , '1"1 Il 1"1 ~
EVP 0,50 M Hefte aus Burgscheidungen • Gerhard Fischer Die Hugenotten in Berlin Zum 300. Jahrestag des Edikts von Potsdam " .-+. n n n n n n n rlf D" . D D D o 0 mIIIH 00 00 0 00 D o Il t:I 0 000 000 00 lAO D.= D D D 0 , '1"1 Il 1"1 ~ ..- 229/230 Herausgegeben vom Sekretariat ßes Hauptvorstandes der Christlich..,Demokratischen Union Deutschlands Hefte aus Burgscheidungen Gerhard Fischer Die Hugenotten in BerIin / 'Zum 300, Jahrestag des Edikts von Potsdam • • 19,85 Herausgegeben vom Sekretariat des Hauptvorstandes der Christlich-De.mokratischen ... Union Deutschlands ." V~14-B Ag 224n2l85 354 "Ein Segen für Stadt und Land" Am 29. Oktober 1685 unterzeichnete der brandenburgische Kurfürst F r.i e d r ich W i I hel m (1640-1688) in seinem Potsdamer Stadtschloß das' Edikt, mit dem er die in ihrer fran'" zösischen Heimat um ihres Glaubens wilfen verfolgten Huge notten in sein Land rief. Deren Ansiedlung in Brandenburg.,. Preußen - so urteilte zwei Jahrhunderte später Theodor Fon t a n e, selber einer Hugenottenfamilie entstammend ..... wirkte sich in der Folgezeit als "ein Segen für Stadt und Land" aus. Aus einem der ökonomisch am weitesten voran geschrittenen europäischen Länder jener Zeit kommend, för• derten die französischen Einwanderer in ihrer neuen Heimat die ' industrielle und landwirtschaftliche Entwicklung, gaben dem gesellschaftlichen und namentlich auch dem geistigen Fortschritt bedeutende Impulse. Wesentlich trugen sie dazu bei, ·im feudalabsolutistisch beherrschten .Brandenburg bür• gerlich-rationale Ideen zu verbreiten, die auf ihre Weise hal fen, der Aufklärung den Weg zu bereiten. Als Bekenner des refonnierten Glaubens vertraten die Hugenotten strikte moralische Prinzipien; sie galten als.sitten streng, als arbeitsam und auf das Gemeinwohl bedacht. -
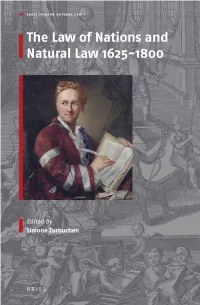
Download: Brill.Com/Brill- Typeface
The Law of Nations and Natural Law 1625– 1800 Early Modern Natural Law STUDIES & SOURCES Series Editors Frank Grunert (Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg) Knud Haakonssen (University of St Andrews and Universität Erfurt) Diethelm Klippel (Universität Bayreuth) Board of Advisors Maria Rosa Antognazza (King’s College London) John Cairns (University of Edinburgh) Thomas Duve (Max- Planck- Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main) Ian Hunter (University of Queensland) Martin Mulsow (Universität Erfurt) Barbara Stollberg- Rilinger (Westfälische Wilhelms- Universität Münster and Wissenschaftskolleg zu Berlin) Simone Zurbuchen (Université de Lausanne) VOLUME 1 The titles published in this series are listed at brill.com/ emnl The Law of Nations and Natural Law 1625– 1800 Edited by Simone Zurbuchen LEIDEN | BOSTON This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC-ND 4.0 License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. The publication of this book has been made possible with the support of the Swiss National Science Foundation. Cover illustration: Portrait of Emer de Vattel. © Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Switzerland. The Library of Congress Cataloging- in- Publication Data is available online at http:// catalog.loc.gov LC record available at http:// lccn.loc.gov/2019023142 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill- typeface. issn 2589- 5982 isbn 978- 90- 04- 38419- 4 (hardback) isbn 978- 90- 04- 38420- 0 (e- book) Copyright 2019 by the Authors. Published by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.