Synchronisierte Verbundformate
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Contemporary Bulgarian Prose 2018
Contemporary Bulgarian Prose 2018 Представянето на проекта на Международния панаир на книгата във Франкфурт 2018 е реализирано с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Contemporary Bulgarian Prose 2018 Compilers: Mihaela Petrova, Head of the National Book Centre The Advisory Board: Prof. Dr. Amelia Licheva, Prof. Milena Kirova, Dr. Darin Tenev, Assoc. Prof. Dr. Dariya Karapetkova, Dr. Mitko Novkov © Design: Damyan Damyanov, Rostislav Marinov | Editor: Angela Rodel © National Palace of Culture – Congress Centre Sofia 2018 CONTENTS National Palace of Culture | 9 Ivan Dimitrov | 62 Theodora Dimova | 125 Nikolay Terziysky | 184 National Book Centre | 10 The Power of Words The First Birthday Excommunication CONTEMPORARY BULGARIAN PROSE 2018 Kristin Dimitrova | 67 Vessella Lyutzkanova | 130 Petar Krumov | 189 Call Me When You Get There The First Birthday Hearse, Two Rhinos Alek Popov | 12 The Palaveev Sisters: On the Road to the New World Lea Cohen | 73 Vladimir Poleganov | 136 Tanya Shahova | 195 Raphael The Other Dream The German’s Girl Alexander Chobanov | 19 Not Over and Done Lyubomir Nikolov | 78 Vladislav Todorov | 141 Velislav Ivanov | 203 Happy People The Spinning Top Images and Reflections Angel Igov | 24 Fine Dust Particles Maria Stankova | 83 Yanitza Radeva | 148 Let’s See If God Will Laugh The Road to Threbes Deyan Enev | 29 The Carpenter Mikhail Veshim | 89 Yordanka Beleva | 154 When I Was an Army General Keder Dimana Trankova | 33 The Empty Cave Milen Ruskov | 95 Zachary Karabashliev | 158 Chamkoriya Havra (Fallow Lands) -

Reality TV in Bulgaria: Social and Cultural Models and National Peculiarities
International Web Journal Revue internationale www.sens-public.org Reality TV in Bulgaria: Social and Cultural Models and National Peculiarities MARIA POPOVA Abstract: The Reality TV appearance results from the media content changes, the infotainment development, the media use enlargement, the creation of quality, mass, thematic universal media products, sold at for low costs and for big profits. The Reality TV significant contribution is the discrepancy between public and private, the viewers’ possibility to see themselves and their problems into participants’ behavior. Although the Reality TV shows present voyeurism, scandal and conflict, media audience may control the program narrative. These programs are entertainment form, but they engage the society with charity, define the media agenda setting, and present definitive socio-cultural models, national peculiarities, which answer to the media audience needs, which are general as cultural sense and social behavior. There are different Reality TV forms worldwide. Most of them represent local edition for the local media audience. In Bulgaria the Reality TV started in 2004 and it has had significant influence of the media content ever since. The Reality TV places substantial problems at the media sphere, connected with media reliability, media post-colonialism, media manipulation, and media pluralism. Keywords: media – Reality TV – media content – media audience – Bulgarian television Contact : [email protected] Reality TV in Bulgaria: Social and Cultural Models and National Peculiarities Maria Popova Media content – between media audience interest and social needs The changes in European media environment have been flowing in parallel directions in the last years. On one hand, the media fragmentarization increases in accordance with primarily declared and explored target media audience needs. -
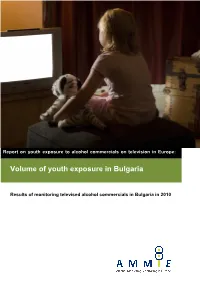
Bulgaria AMMIE Volume Report Track Changes V3
Report on youth exposure to alcohol commercials on television in Europe: rt on youth exposure to alcohol commercials on television Volume of youth exposure in Bulgaria Results of monitoring televised alcohol commercials in Bulgaria in 2010 1 Report on youth exposure to alcohol commercials on television in Europe: Volume of youth exposure in Bulgaria Results of monitoring televised alcohol commercials in Bulgaria in 2010 Author: Daniela Alexieva Foundation ‘Horizonti 21’ Sofia ‘Bolgrad’ Str. 5 Phone: +359(02)963 32 80 Fax: +359(02)963 32 80 Email: [email protected] Editing and contact person: Avalon de Bruijn ( [email protected] ) European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM) Utrecht, the Netherlands, November 2011 Conducted as part of the Alcohol Marketing Monitoring in Europe (AMMIE) project. AMMIE is coordinated by the Dutch Institute for Alcohol Policy (STAP). Contact details: Dutch Institute for Alcohol Policy (STAP) Postbus 9769 3506 ET Utrecht +31306565041 [email protected] www.stap.nl This report arises from the project Alcohol Marketing Monitoring in Europe which has received funding from the European Union, in the framework of the Health Program. 2 Index of contents Summary .............................................................................................................................. 4 1.Introduction ...................................................................................................................... 9 1.1 Effects of alcohol advertising ....................................................................................................... -

A Great Year How Many RTL Group’S Channels Increased Their Market Position in 2011
12 January 2012 week 02 A great year How many RTL Group’s channels increased their market position in 2011 Luxembourg Germany RTL Group to exit Greek RTL Television presents broadcasting market fi fth ‘Commit Award’ France United States Nicolas de Tavernost on M6’s Melanie Amaro wins performance in 2011 The X Factor US week 02 the RTL Group intranet Cover: Montage with channels’ ratings increases year-on-year (in per cent). 2 week 02 the RTL Group intranet Winner of the year RTL Group’s fl agship channels in Germany and the Netherlands increased their audience shares once more in 2011. Other profi t centres recorded strong performances as well. Luxembourg - 12 January 2012 In 2011, almost all of RTL Group’s families of channels and fl agship channels were once again able to increase their – already good – ratings. RTL Television in Germany recorded its best yearly average since 1997. M6 was the only major channel in France to increase its audience shares year-on-year. In the Netherlands, RTL 4 had its best ratings in 14 years, while RTL Belgium remained the leading family of channels in the country with audience shares stable at 35 per cent. Despite the ongoing fragmentation in Croatia, RTL Hrvatska was able to increase its combined audience share both in prime time and all day. In Hungary, RTL Klub not only was the leading channel but also broadcast all of the 100 most-watched programmes in 2011. Alpha in Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Greece continued to increase audience shares, Vox closed the year 2011 with an average while Grupo Antena 3 in Spain increased its market share of 7.3 per cent in its target combined audience share by 1.5 percentage audience of 14- to 49-year-old viewers. -

The New Press and Media Act in Hungary
The New Press and Media Act in Hungary At the end of December 2010 the Hungarian Parliament adopted a new press and media law which immediately aroused strong criticism in the EU states, OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), and European journalist organizations for contradicting European ideologies. The Act came into force at the beginning of January 2011, when Hungary also assumed the EU presidency for the subsequent six months. A basic concern is how Hungary can participate in evaluating the progress of democracy in the candidate countries when it is moving away from democracy itself. The act, comprising 230 articles, establishes in the country a new body for media control, the National Media and Communications Authority, for monitoring the contents of all media, including the internet. Media Council is an independent body of the Authority. The Authority may stipulate regulations with respect to the behavior of the media. If it regards that the published information is not balanced, it has the right to impose a heavy fine to the media in question or even suspend its activity (see article 187 below). It may also oblige the media to reveal their source of information. The Act also gives quotas to European and Hungarian programmes and music in the public media (articles 20-22). The Act stresses respecting “family values,” a fact that has made the international sexual minority organizations suspicious. The Authority, as well as several other institutions, is led by Fidesz, the leading political party. Besides the Authority, the Act also stipulates the establishment of the Public Service Foundation governing the radio, the two national TV channels, and the news agency MTI. -

Global Patterns for National Stars? Celebreality in Slovakia
Kultura – Media – Teologia 2012 nr 10 s. 103-114. Peter Mikuláš Global Patterns for National Stars? Celebreality in Slovakia STRESZCZENIE: ABSTRACT: WYKORZYSTANIE CELEBRYTÓW W KOMUNIKACJI MEDIALNEJ THE USE OF CELEBRITIES IN THE MEDIA COMMUNICATION IS NIE JEST ZJAWISKIEM NOWYM, ALE MOŻNA ZAUWAŻYĆ NOT NEW PHENOMENON, BUT FREQUENCY OF ITS USE IS ON NASILENIE TEGO ZJAWISKA. W BADANIU AUTOR SKUPIA SIĘ NA THE RISE. IN THIS STUDY, WE FOCUS ON THE USE OF WYKORZYSTANIU ZNANYCH BIEŻĄCYCH PROGRAMÓW CELEBRITIES IN CURRENT TELEVISION PROGRAMS, FOCUSING TELEWIZYJNYCH, KONCENTRUJĄC SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM NA PRIMARILY ON THE REALITY TV GENRE. WE PRESENT GATUNKACH TE;EWIZYJNYCH Z OBSZARU REALITY. PREZENTUJE A COMPARATIVE ANALYSIS OF AMERICAN AND SLOVAK ANALIZĘ PORÓWNAWCZĄ AMERYKAŃSKICH I SŁOWACKICH CELEBRITIES - PROTAGONISTS OF SELECTED REALITY TV CELEBRYTÓW - BOHATERÓW WYBRANYCH FORMATÓW FORMATS. THE FUNDAMENTAL QUESTION THAT WE ASK IS: TELEWIZYJNYCH REALITY SHOW.PODSTAWOWE PYTANIE, KTÓRE IS THERE A GLOBAL FORMULA FOR NATIONAL STARS IN ZADAJE AUTOR, BRZMI: CZY ISTNIEJE GLOBALNE FORMUŁA REALITY TV, OR IS PRESENTED DEGREE OF ORIGINALITY KRAJOWYCH GWIAZD REALITY TV, CZY TEŻ STOPIEŃ SUFFICIENT ENOUGH, SO WE CAN TALK ABOUT THE ORYGINALNOŚCI WYSTARCZA, ABY MOŻNA BYŁO MÓWIĆ O DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS LINES AT BOTH LEVELS? AUTONOMICZNOŚCI TYCH GATUNKÓW NA RÓŻNYCH POZIOMACH? KEYWORDS: SŁOWA KLUCZOWE: CELEBRITY, CELEBREALITY, REALITY TV, OSBOURNES, MOJSEJ FAMILY CELEBRYCI, REALITY TV, OSBOURNES, RODZINA MOJSEJ Kultura – Media – Teologia 10/2012 103 OBLICZA MEDIÓW he presence of celebrities in television, especially in reality TV programmes, is without a doubt an effective way of their presentation in media. Television can Tcreate celebrities out of ordinary people, as well as it can use well-known people from other media or even different areas of social life, who are trying to get more media attention. -

IRIS 2010-8 INTERNATIONAL Jan ...3
IRIS 2010-8 INTERNATIONAL The Media Agreement for 2011-2014 .................. ..18 COUNCIL OF EUROPE FR-France European Court of Human Rights: Akda¸sv. Turkey ..... ... 3 Court of Cassation Upholds Exclusive Commercialisa- European Court of Human Rights: Fatullayev v. Azerbai- tion of Orange Sports Channel ...........................19 jan .................................................... ...3 Conseil d’Etat Deliberates on Digital TV Channel Num- Committee of Ministers: Recommendation Combating bering in a Satellite Package Offer ..................... ..20 Discrimination on Grounds of Sexual Orientation or Gen- CSA Sanction Procedure and Prior Questioning of Con- der Identity ............................................ ...5 stitutionality .............................................20 Catch-up TV and Deep Hyperlinks EUROPEAN UNION ..................... ..21 European Commission: Laggard Member States Urged GB-United Kingdom to Implement AVMS Directive .......................... ...6 Broadcast’s Failure to Comply with Generally Accepted European Commission: Legislation Guaranteeing the In- Standards not a Disproportionate Interference with dependence of Slovak Telecoms Regulator ............. ...6 European Commission: Article 29 Working Party - Opin- Freedom of Expression...................................22 BBC Authorised to Add Copy Protection to High Defini- ion on Behavioural Advertising............................7 tion Freeview Broadcasts .............................. ..22 Advertisement Regulation on VOD Services ........... -

Human Rights in Bulgaria in 2014
HUMAN RIGHTS IN BULGARIA IN 2014 Annual report of the Bulgarian Helsinki Committee April 2015 2 The Bulgarian Helsinki Committee is an independent non-governmental organisation for the protection of human rights. It was founded on 14 July 1992. This report was produced with the support of the Open Society Institute – Budapest and the Oak Foundation. Human Rights in Bulgaria in 2014 Sofia, March 2015 The report can be freely quoted upon condition that the source is acknowledged. Authors: The report was written by: Antoaneta Nenkova, Atanas Atanasov, Desislava Ivanova, Gergana Yancheva, Dilyana Angelova, Elitsa Gerginova, Zhenya Ivanova, Iliana Savova, Kaloyan Stanev, Krassimir Kanev, Margarita Ilieva, Radoslav Stoyanov, Slavka Kukova, Stanimir Petrov, Yana Buhrer Tavanier. The access to information section is based on materials provided by the Access to Information Programme. English language editor: Desislava Simeonova Publisher: Bulgarian Helsinki Committee 7 Varbitsa Street, 1504 Sofia, Bulgaria Tel. 3592 944 0670 www.bghelsinki.org BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE HUMAN RIGHTS IN BULGARIA IN 2014 3 Table of contents 1. POLITICAL DEVELOPMENTS IN BULGARIA IN 2014 ................................................................... 4 2. RIGHT TO LIFE, PROTECTION FROM TORTURE, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT ... 6 3. R IG H T TO LIBERTY AND SECURITY O F P E R S O N ........................................................................ 13 4. INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY AND FAIR TRIAL ............................................................. -

IRIS 2010-8 INTERNATIONAL Gegen Die Türkei ...3
IRIS 2010-8 INTERNATIONAL Die Medienvereinbarung für 2011-2014................ ..20 EUROPARAT FR-Frankreich Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Akda¸s Revisionsgericht erklärt die exklusive Vermarktung des gegen die Türkei ....................................... ...3 Senders Orange Sports für rechtens ................... ..20 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Fatul- Urteil des Staatsrates zur Nummerierung digitaler Sen- layev gegen Aserbaidschan............................ ...3 der im Satellitenprogrammangebot ......................21 Ministerkomitee: Empfehlung zur Bekämpfung der Dis- Sanktionsverfahren des CSA und Vorfrage zur Verfas- kriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder sungsmäßigkeit..........................................22 der geschlechtlichen Identität ......................... ...5 Catch-up-TV und Deep Linking von Hypertext-Links .... ..22 EUROPÄISCHE UNION GB-Vereinigtes Königreich Europäische Kommission: Aufforderung an die Mitglied- Rüge wegen Nichteinhaltung allgemein akzeptierter staaten, die AVMD-Richtlinie umzusetzen .............. ...6 Standards kein unverhältnismäßiger Eingriff in die freie Europäische Kommission: Gesetzgebung garantiert Un- Meinungsäußerung .................................... ..23 abhängigkeit des slowakischen Telekom-Regulierers ... ... 6 BBC darf HD-Sendungen auf der Freeview-Plattform mit Europäische Kommission: Die Artikel-29-Gruppe - Stel- Kopierschutz versehen...................................24 lungnahme zum Behavioural Advertising .............. ...7 Werberegelung -

Goiânia 2011 Personagens Emolduradas: Os Discursos De Gênero E Sexualidade No Big Brother Brasil 10
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU ANTROPOLOGIA SOCIAL LINHA DE PESQUISA: Corpo, representações e marcadores sociais da diferença KATIANNE DE SOUSA ALMEIDA PERSONAGENS EMOLDURADAS: OS DISCURSOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE NO BIG BROTHER BRASIL 10 Orientador: Prof. Dr. Alecsandro José Prudêncio Ratts GOIÂNIA 2011 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU ANTROPOLOGIA SOCIAL Katianne de Sousa Almeida PERSONAGENS EMOLDURADAS: OS DISCURSOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE NO BIG BROTHER BRASIL 10 Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Antropologia Social. Linha de Pesquisa: Corpo, representações e marcadores sociais da diferença Orientador: Prof. Dr. Alecsandro José Prudêncio Ratts GOIÂNIA 2011 FICHA CATALOGRÁFICA (Elaborada por Diule Queiroz CRB 2491) Almeida, Katianne de Sousa C364p Personagens emolduradas: os discursos de gênero e sexualidade no Big Brother Brasil 10 / Katianne de Sousa Almeida. - - Goiânia: UFG / Faculdade de Ciências Sociais, 2011. 163f. ; 29 cm. Orientador: Alecsandro José Prudêncio Ratts Dissertação ± Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências Sociais, Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu / Antropologia Social, 2011. 1.Big Brother Brasil 2.Discurso 3.Gênero e Sexualidade I. Ratts, Alecsandro José Prudêncio. II. Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências Sociais. III. Personagens emolduradas: os discursos de gênero e sexualidade no Big Brother Brasil. IV. Título CDU 392:654.197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - PGAS Aluna: KATIANNE DE SOUSA ALMEIDA Número da matrícula: 2009247 Linha de Pesquisa: Corpo, representações e marcadores sociais da diferença Título da dissertação: PERSONAGENS EMOLDURADAS: OS DISCURSOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE NO BIG BROTHER BRASIL 10 Orientador: Prof. -

Derick & April Albrecht
We promise to welcome your baby into our home and our lives with open arms. We will treat them with love, dignity and respect, and raise them with high morals and values. It's important to us to let your baby will know they are adopted, just like our son will. They will know this from a young age and we are so excited that our son will have a brother or sister that he can share this special bond with. Your baby will know that their biological parents loved them enough to give them this life full of opportunities. We hope to have your contact information to provide them if they would like to reach out to you, someday, and you agree. Most importantly, we promise to love them fiercely and provide them a safe, loving home, an awesome big brother, family and friends, a great education and a great life. Derick and April Derick & April Albrecht ADOPTION PROFILE BOOK Dear EXPECTANT Parents, We are so grateful you took the time to consider our family to be the ones to welcome your child into our home. As a family who has been unable to conceive on our own, adoption has become a very special option for us to grow our family. Our son, Jackson, was adopted through the foster care and we want nothing more than for him to become a big brother to another adopted child. Our hope is that they can share that bond of being adopted siblings and be able to relate to one another throughout their lives. -

Young People in European Bulgaria a Sociological Portrait 2014
YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN BULGARIA A SOCIOLOGICAL PORTRAIT 2014 Petar-Emil Mitev and Siyka Kovacheva A SOCIOLOGICAL PORTRAIT 2014 YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN BULGARIA ISBN 978-954-2979-23-4 YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN BULGARIA A SOCIOLOGICAL PORTRAIT 2014 Petar-Emil Mitev and Siyka Kovacheva Sofia 2014 Published by: Friedrich Ebert Foundation Office Bulgaria P.O. Box 958 1000 Sofia, Bulgaria Authors: Petar-Emil Mitev, Siyka Kovacheva Responsible: Regine Schubert Final Editing: Michaela Mahler Translation: Katerina Popova DTP: Pro Creative Studio Ltd. Printed in Sofia, Bulgaria, November 2014 © Friedrich-Ebert-Stiftung ISBN 978-954-2979-23-4 The findings, interpretations and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of the Friedrich-Ebert-Stiftung. Friedrich-Ebert-Stiftung does not guarantee the accuracy of the data included in this work. YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN BULGARIA: A SOCIOLOGICAL PORTRAIT 2014 Contents Preface ............................................................................................................5 1. INTRODUCTION ........................................................................................6 1.1 Social construction of youth in scientific research................................6 1.2 Bulgaria’s young generation in a European context .............................8 1.3 The Bulgarian tradition in youth studies ............................................15 1.4 Methodological notes on this study ..................................................17 2. LEISURE TIME AND LIFESTYLES