Volltext (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin VYDRA
bulletin VYDRA Nummer 19 Sonderausgabe mit Ergebnissen des Projektes LUTRA LUTRA bulletin VYDRA Nummer 19 Sonderausgabe mit Ergebnissen des Projektes LUTRA LUTRA ISBN 978-80-86475-59-2 INHALT Vorwort ....................................................................................................................................... 5 Poledník L., Schimkat J., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K.: Vorkommen des Fischotters im Osterzgebirge und im Erzgebirgsvorland in Sachsen und in der Tschechischen Republik 2019–2020 .................................................................................................................................. 7 Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C.: Genetische Struktur der Fischotterpopulation im Erzgebirge ………………….…………………………………………...………................. 26 Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Stolzenburg U., Zápotočný Š.: Das Nahrungs- dargebot für den Fischotter im Erzgebirge und im Erzgebirgsvorland ........................................ 36 Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š.: Zusammensetzung der Nahrung des Fischotters in unterschiedlichen Gewässerhabitaten im Bereich des Erzge- birges und des Erzgebirgsvorlandes ............................................................................................ 60 Beran V., Poledníková K.: Zur Wanderausstellung „Ich bin ein vydra. Wie der Fischotter über die Grenze kam.“ ........................................................................................................................ -

Bulletin VYDRA
bulletin VYDRA Číslo 19 Speciální číslo s výsledky projektu LUTRA LUTRA bulletin VYDRA číslo 19 Speciální číslo s výsledky projektu LUTRA LUTRA ISBN 978-80-86475-58-5 OBSAH Slovo úvodem .............................................................................................................................. 5 Poledník L., Schimkat J., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K.: Výskyt vydry říční ve východní části Krušných hor a jejich podhůří v České republice a Sasku v letech 2019–2020 .................... 7 Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C.: Genetická struktura populace vydry říční v Krušných horách ………………….…………………………………………...………........................... 26 Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Stolzenburg U., Zápotočný Š.: Potravní nabídka pro vydru říční v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří ................................................ 36 Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š.: Složení potravy vydry říční v různém prostředí v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří ..................................... 60 Beran V., Poledníková K.: Putovní výstava Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla 77 7 Vydra je šelma, kořist loví obvykle ve vodě. Hlavní složkou její potravy jsou ryby, obojživelníci a raci (foto Jiří Bohdal); The otter is a carnivore. Prey usually hunt in the water. The main components of her diet are fish, amphibians and crayfish (photo by Jiří Bohdal) 2 3 Vorwort Liebe LeserInnen, Sie halten eine Sonderausgabe des Bulletin Vydra in den -

Fischotterschutz Im Sächsisch-Tschechischen Grenzgebiet
Fischotterschutz im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet Heike Bretfeld, Berit Künzelmann & Lukáš Poledník 1 Einleitung Der Fischotter (Lutra lutra), unsere größte heimische Marderart, besiedelt Land- und Wasserhabitate und gilt als Symbol einer naturnahen, lebendigen Flusslandschaft. Lange Zeit waren seine Bestände stark rückläufig, was auf die Bejagung als Pelzlieferant und Nahrungskonkurrent des Menschen sowie Eingriffe in seinen Lebensraum, z. B. durch Flussregulierungen und Verschmutzungen von Gewässern, zurückzuführen ist. In weiten Teilen Sachsens galt er zur Jahrtausendwende als vom Aussterben bedroht (Kategorie 1 der Roten Liste). Dank strenger Schutzbemühungen konnten in den letzten Jahrzehnten wieder positive Bestandsentwicklungen festgestellt werden. Heute wird der Fischotter als in seinem Bestand gefährdet eingestuft (Kategorie 3 der Roten Liste). Der Alttierbestand in Sachsen wird aktuell auf 400 bis 600 Tiere geschätzt (LFULG 2020). Das Hauptverbreitungsgebiet in Sachsen befindet sich in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Abbildung 1: Fischotter (c) Jiri Bohdal 1 2 Das sächsisch–tschechische Kooperationsprojekt „Lutra lutra“ Da der Fischotter beidseits der deutsch-tschechischen Grenzregion an Fließgewässern vorkommt und von den Lebensbedingungen beider Länder abhängig ist, wurde im Oktober 2017 das sächsisch-tschechische Kooperationsprojekt "Lutra lutra" initiiert, bei dem das NABU-Naturschutzinstitut Region Dresden e. V. mit dem Verein ALKA Wildlife in Lidéřovice und dem Museum der Stadt Ústí nad Labem eng zusammenarbeitet. Das Projekt wird von der europäischen Union mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Übergeordnetes Ziel des Projektes ist die Analyse und Bewertung der Erkenntnisse zum Fischottervorkommen und zu seinen Lebensräumen im deutschen und tschechischen Projektgebiet, in Folge die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutz des Otters und die damit einhergehende Stärkung grenzübergreifender Fischotterpopulationen. -
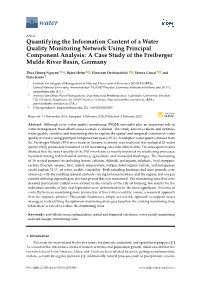
Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network
water Article Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network Using Principal Component Analysis: A Case Study of the Freiberger Mulde River Basin, Germany Thuy Hoang Nguyen 1,2,*, Björn Helm 2 , Hiroshan Hettiarachchi 1 , Serena Caucci 1 and Peter Krebs 2 1 Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), United Nations University, Ammonstrasse 74, 01067 Dresden, Germany; [email protected] (H.H.); [email protected] (S.C.) 2 Institute for Urban Water Management, Department of Hydrosciences, Technische Universität Dresden (TU Dresden), Bergstrasse 66, 01069 Dresden, Germany; [email protected] (B.H.); [email protected] (P.K.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-35189219370 Received: 11 November 2019; Accepted: 3 February 2020; Published: 5 February 2020 Abstract: Although river water quality monitoring (WQM) networks play an important role in water management, their effectiveness is rarely evaluated. This study aims to evaluate and optimize water quality variables and monitoring sites to explain the spatial and temporal variation of water quality in rivers, using principal component analysis (PCA). A complex water quality dataset from the Freiberger Mulde (FM) river basin in Saxony, Germany was analyzed that included 23 water quality (WQ) parameters monitored at 151 monitoring sites from 2006 to 2016. The subsequent results showed that the water quality of the FM river basin is mainly impacted by weathering processes, historical mining and industrial activities, agriculture, and municipal discharges. The monitoring of 14 critical parameters including boron, calcium, chloride, potassium, sulphate, total inorganic carbon, fluoride, arsenic, zinc, nickel, temperature, oxygen, total organic carbon, and manganese could explain 75.1% of water quality variability. -

B-Bericht Zum Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Bericht über die Umsetzung der Anhänge II, III und IV der Richtlinie 2000/60/EG für den Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster (B-Bericht) Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt - I - Inhaltsverzeichnis (Die in Klammern gesetzten Verweise in den Kapitelüberschriften beziehen sich auf die Anhänge der Richtlinie 2000/60/EG) Abbildungsverzeichnis III Tabellenverzeichnis IV Abkürzungsverzeichnis V Verzeichnis der Tabellen im Anhang 1 VII Verzeichnis der Karten im Anhang 2 VIII 1 Einführung 1 2 Beschreibung des Koordinierungsraumes (Anh. I) 2 2.1 Geographische Ausdehnung des Koordinierungsraumes 2 2.2 Aufteilung der Flussgebietseinheit Elbe in Koordinierungsräume 6 3 Zuständige Behörden (Anh. I i) 7 4 Analyse der Merkmale der Flussgebietseinheit und Überprüfung der Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten (Artikel 5 Anh. II) 8 4.1 Oberflächengewässer (Anh. II 1) 8 4.1.1 Beschreibung der Typen von Oberflächenwasserkörpern 9 4.1.2 Typspezifische Referenzbedingungen und höchstes ökologisches Potenzial (Anh. II 1.3 i bis iii und v bis vi) 13 4.1.3 Bezugsnetz für Gewässertypen mit sehr gutem ökologischen Zustand (Anh. II 1.3 iv) 13 4.1.4 Vorläufige Ausweisung künstlicher und erheblich veränderter Oberflächenwasserkörper (Anh. II 1.2) 14 4.1.5 Belastungen der Oberflächenwasserkörper (Anh. II 1.4) 16 4.1.5.1 Signifikante punktuelle Schadstoffquellen (Anh. II 1.4) 16 4.1.5.2 Signifikante diffuse Schadstoffquellen (Anh. II 1.4) 17 4.1.5.3 Signifikante Wasserentnahmen (Anh. II 1.4) 18 4.1.5.4 Signifikante Abflussregulierungen (Anh. -

A-Bericht FGG Elbe
Zusammenfassender Bericht der Flussgebietsgemeinschaft Elbe über die Analysen nach Artikel 5 der Richtlinie 2000/60/EG (A-Bericht) Herausgeber: Flussgebietsgemeinschaft Elbe Freistaat Bayern Land Berlin Land Brandenburg Freie und Hansestadt Hamburg Land Mecklenburg-Vorpommern Land Niedersachsen Freistaat Sachsen Land Sachsen-Anhalt Land Schleswig-Holstein Freistaat Thüringen Bundesrepublik Deutschland - I - Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis IV Tabellenverzeichnis VI Abkürzungsverzeichnis VIII Verzeichnis der Tabellen im Anhang 1 X Verzeichnis der Karten im Anhang 2 XI 1 Einführung 1 1.1 Grundsätze 1 1.2 Vorgehensweise 2 1.3 Beschreibung der bisherigen nationalen und internationalen Arbeiten und Aktivitäten zum Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe 3 1.4 Berichtsaufbau 6 2 Beschreibung des deutschen Teils der Flussgebietseinheit Elbe 7 2.1 Geographischer Überblick der Flussgebietseinheit (Anh. I ii) 7 2.2 Aufteilung des deutschen Teils der FGE Elbe in Koordinierungsräume 15 3 Zuständige Behörden (Anh. I i) 16 3.1 Rechtlicher Status der zuständigen Behörden (Anh. I iii) 16 3.2 Zuständigkeiten (Anh. I iv) 18 3.3 Koordinierung mit anderen Behörden (Anh. I v) 19 4 Analyse der Merkmale der Flussgebietseinheit und Überprüfung der Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten (Art. 5 Anh. II) 20 4.1 Oberflächengewässer (Anh. II 1) 20 4.1.1 Beschreibung der Typen der Gewässer und der Ausweisung der Wasserkörper 20 4.1.1.1 Ausweisung der Wasserkörper 20 4.1.1.2 Grundlagen der Typisierung nach EG-WRRL 20 4.1.2 Typspezifische Referenzbedingungen und höchstes ökologisches Potenzial (Anh. II 1.3 i bis iii und v bis vi) 24 4.1.3 Bezugsnetz für Gewässertypen mit sehr gutem ökologischen Zustand (Anh. II 1.3 iv) 26 4.1.4 Vorläufige Ausweisung künstlicher und erheblich veränderter Wasserkörper 27 4.1.5 Belastungen der Oberflächenwasserkörper (Anh. -
Radiochemische Untersuchungen Natürlicher Radionuklide in Umweltproben
Radiochemische Untersuchungen natürlicher Radionuklide in Umweltproben Masterarbeit am Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Leibniz Universität Hannover, Naturwissenschaftliche Fakultät Studiengang M.Sc. Analytik von Maruta Bunka geb. am 04.08.1984 Hannover, September 2009 Die Arbeit wurde im Zeitraum vom 01.04.2009 bis zum 28.09.2009 am ZSR der Leibniz Universität Hannover durchgeführt. Die vorgelegte Arbeit ist von mir selbstständig angefertigt und verfasst. In der Arbeit wurden keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt. ____________________ (Maruta Bunka) Hannover, den 28.September 2009 Erstprüfer: Herr Prof. Dr. R. Michel Zweitprüferin: Frau Prof. Dr. C. Vogt 2 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 5 Tabellenverzeichnis 7 1 Einleitung und Aufgabenstellung 8 1.1 Einleitung 8 1.2 Aufgabenstellung 9 1.3 Weitere Arbeiten des Projektes 10 2 Theoretischer Teil 11 2.1 Radioaktivität 11 2.2 Zerfallsarten und Zerfallsreihen 11 2.3 α-Strahlung und Wechselwirkung mit Materie 14 2.4 α-Spektrometrie 15 2.5 Natürliche Radioaktivität 17 2.5.1 Natürliche Radionuklide 17 2.5.2 Natürliche Strahlenbelastung 18 2.5.3 Natürliche Radionuklide im Wasser 20 2.6 Uran 21 2.7 Polonium 22 2.8 Das Muldesystem 22 2.9 Uranbergbau in Deutschland 23 2.10 Frühere Untersuchungen 24 3 Experimenteller Teil 27 3.1 Probenahme 27 3.2 Probenvorbereitung 29 3.2.1 Analysegang 29 3.2.2 Pb-Austauscher 32 3.2.3 Chemische Trennung Pb-Austauscher 33 3.2.4 Autodeposition von Polonium 35 3.2.5 UTEVA-Austauscher 37 3.2.6 Chemische Trennung UTEVA-Austauscher -

Saxon Flood Centre Within Saxon State Agency for Environment and Geology
Saxon Flood Centre within Saxon State Agency for Environment and Geology Disaster Management Landesamt für Umwelt und Geologie Autor: Abteilung 3 Heinz Gräfe Wasser und Abfall AUGUST 2002 - FLOOD - Elbe 17th August 2002 Elbe in Dresden 20. Oktober 2005 Landesamt für Umwelt und Geologie Folie 2 Autor: Abteilung 3 Heinz Gräfe Wasser und Abfall AUGUST 2002 – FLOOD – Osterzgebirge Weesenstein Müglitz Glashütte Bridge - Löbtauer Straße Freital Weißeritz Dresden – main station 20. Oktober 2005 Landesamt für Umwelt und Geologie Folie 3 Autor: Abteilung 3 Heinz Gräfe Wasser und Abfall AUGUST 2002 – FLOOD – Mulde Flöha Frankenberg Döbeln Staupitz- mühle Zschopau Grimma - Eilenburg Grimma Großmühle Vereinigte Mulde 20. Oktober 2005 Landesamt für Umwelt und Geologie Folie 4 Autor: Abteilung 3 Heinz Gräfe Wasser und Abfall The Flood claimed 21 dead and damaged 25 652 residential buildings, 200 thereof destroyed totally. 50 000 people have been evacuated. Also have been damaged: 7 hospitals 236 schools 750 km streets 540 km railway lines 180 bridges 20. Oktober 2005 Landesamt für Umwelt und Geologie Folie 5 Autor: Abteilung 3 Heinz Gräfe Wasser und Abfall Forward Looking Flood Protection – The Saxon Flood Protection Policy Sovereign Responsibility Operative (State/Municipalities) further flood defense Raising awareness precaution Warning by Operating Retention and protection by Increasing structural works (retention technical protection reservoirs, dikes, retention control) protection and by river works levels by Discharge reduction and retention in flood plains Reduce flood precaution – forest, arable land, public areas, private area – danger by in the area No further building activities in planning flood-prone areas, integration of Avoid damage flood-prone areas in regional planning precaution objects by Individual Respon- individual raise awareness, flood adapted constructions sibility precaution (citizen) (stability, building materials, operational reliability) and land use 20. -

Bäche Schutz Der Lebensadern Des Ost-Erzgebirges
– Heft 4 – BÄCHE Schutz der Lebensadern des Ost-Erzgebirges Große Wassergasse 9 01744 Dippoldiswalde Tel. 0 35 04 / 61 85 85 [email protected] www.grueneliga-osterzgebirge.de Munter plätschert der Bergbach zwischen den Erlenwurzeln, tost hier über moos- Von der Quelle bis zur Mündung bedeckte Steine, windet sich da durch eine kleine Wiesenaue. Wenn die Sonne scheint und das fließende Wasser im Gegenlicht glitzert, dann wird bereits eines Wo beginnen eigentlich Bäche und wo hören sie auf? Darauf gibt es keine deutlich – Bäche sind keine starren Gebilde, sondern dynamische Systeme, die einfache Antwort. Sowohl an Quellen zu Tage tretendes Grundwasser als auch eigentlich nie still stehen. abfließendes Oberflächenwasser bilden Bächlein, die durch stetige Wasserzu- Lebensadern gleich bewegen sie das wichtigste Lebensmittel, nicht nur für uns, tritte dann zu Bächen werden. Und später, wenn immer wieder neue Bäche sondern für alle Lebewesen. Bachauenwälder, Uferstaudenfluren und Feuchtwie- und Bächlein zugeflossen sind, werden daraus irgendwann kleine Flüsse, deren sen können eine außerordentlich reiche Tier- und Pflanzenwelt beherbergen. Wasser von großen Flüssen aufgenommen und Richtung Meer getragen wird. Auch unter der Wasseroberfläche tummeln sich viele interessante Organismen. Diese Abfolge der verschiedenen Fließgewässertypen, die Längszonierung, lässt Vom Laub, das in die Wellen fällt, ernähren sich winzige Bachflohkrebse, die sich nach den jeweiligen Leitfisch-Arten darstellen: selbst die Nahrungsgrundlage für die Larven von Feuersalamandern und Libellen und zahlreichen anderen kleinen Bachbewohnern bilden. Diese wiederum werden Fließ- Struktur/ Fach- Leitfisch- Beispiel von Groppen und Forellen gefressen, und von denen holen sich unter anderem richtung Abschnitt begriff Art Graureiher und Schwarzstörche ihren Anteil. Großer Potamal Barbe, Elbe Fluss Blei Nur ist diese „Biologische Vielfalt“ an und in den Fließgewässern nichts Selbst- verständliches. -

Hydrologisches Handbuch Gebietskennzahlen Teil 2 08/2017
Hydrologisches Handbuch Gebietskennzahlen Teil 2 08/2017 1 Inhalt 1 Vorbemerkung .......................................................................................................................................................... 3 2 Erläuterung der Bezeichnungen und Abkürzungen .............................................................................................. 4 3 Gebietskennzahlen ................................................................................................................................................... 5 3.1 Elbe und Nebenflüsse (Obere Elbe) ........................................................................................................................... 5 3.2 Schwarze Elster ......................................................................................................................................................... 8 3.3 Zwickauer Mulde ........................................................................................................................................................ 12 3.4 Freiberger Mulde ........................................................................................................................................................ 17 3.5 Vereinigte Mulde ........................................................................................................................................................ 21 3.6 Weiße Elster ..............................................................................................................................................................