Ursula Pellaton – Tanz Verstehen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TÁNCMŰVÉSZET ÉS INTELLEKTUALITÁS TÁNCMŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY a Magyar Táncművészeti Egyetem Kiadványsorozata X
TÁNCMŰVÉSZET ÉS INTELLEKTUALITÁS TÁNCMŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY A Magyar Táncművészeti Egyetem kiadványsorozata X. Sorozatszerkesztő: Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár Konzultatív szerkesztőbizottság: Fodor Antal professzor emeritus Fodorné Molnár Márta főiskolai tanár Fügedi János főiskolai tanár Lőrinc Katalin egyetemi tanár Macher Szilárd főiskolai tanár Major Rita főiskolai tanár Mizerák Katalin főiskolai tanár Németh András egyetemi tanár Szakály György egyetemi tanár TÁNCMŰVÉSZET ÉS INTELLEKTUALITÁS VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen 2017. november 17−18. Magyar Táncművészeti Egyetem Budapest, 2018 TARTALOM A KONFERENCIA PROGRAMJA ..................................................................................... 7 Bolvári-Takács Gábor: Megnyitó beszéd ................................................................................ 11 PLENÁRIS ELŐADÁS Németh András: „Karalábé” apostolok, művészpróféták, táncos papnők – Fejezetek az életreform és a modern táncművészet kapcsolatának „titkos” történetéből ................................................................................................... 13 SZEKCIÓ-ELŐADÁSOK Adamovich Ferenc: Az affektív mozgáspedagógia alapjai ..................................................... 23 Balaskó Enikő: A Lendva-vidéki táncok visszatanításának lehetőségei és módszerei ............................................................................................................... 29 Barna Mónika – Schanda Beáta: A nemzetközi versenyek szerepe a A kötetet -

MV Casa Anatta.Indd
museocomplesso museale monte verità di casa anatta Il Museo di Casa Anatta è attraverso video, interviste parte integrante del com- e documentari, la biografia plesso Museale del Monte e il lavoro del celeberrimo Verità. Dopo un restauro curatore, analizzando le conservativo, ha riaperto tappe della creazione della nel 2017 con la storica mo- sua mostra sul Monte Verità. stra “Monte Verità. Le mam- melle della verità”, curata da Casa Anatta è un suggestivo Harald Szeemann nel 1978 e edificio in legno presumibil- già ospitata nella stessa sede mente costruito negli anni tra il 1981 e il 2008. 1908—1909. Esposizione di importanza Di probabile ispirazione internazionale, racconta la teosofica, la casa fu costruita storia utopica del Monte come dimora e luogo di rap- Verità e il fermento intellet- presentanza dai fondatori tuale che ha caratterizzato della colonia “vegetabiliana” tutta la regione a partire dal di Monte Verità. Dal 1926 fu XIX secolo. La narrazione residenza del barone Eduard si snoda attraverso diversi von der Heydt, il quale la nuclei tematici – le cosid- ampliò e la arricchì con la dette “mammelle“ – ovvero sua eterogenea collezione l'anarchia, l'utopia sociale, d'arte. Gli angoli arrotonda- la riforma della vita, dello ti, i soffitti a volta, l'ampio spirito e del corpo, la psicolo- e moderno tetto piatto e le gia, la mitologia, la danza, la grandi finestre con vista sul musica, la letteratura e l'arte. paesaggio rendono la stessa La mostra, dopo il restauro, costruzione una suprema è stata riallestita così opera d'arte. Il restauro come concepita da Harald conservativo è stato con- Szeemann, proposta oggi dotto sotto la supervisione come installazione artistica. -

Themenpfad: Sprechakte!
SCHOOL OF DADA PRÄSENTIERT: DADA-EREIGNIS- THEMENPFAD: SPRECHAKTE! Zur Vermittlung des historischen Kontextes und Cabaret Voltaire Aneignung von Dada. Unterlagen für Schulen Spiegelgasse 1, CH-8001 Zürich zum Runterladen unter: www.cabaretvoltaire.ch www.cabaretvoltaire.ch/schulen.html +41 43 268 08 44 SPRECHAKTE! ST ATIO N EN C 2 3 5 4 C CABARET VOLTAIRE Spiegelgasse 1 2 ZUNFTHAUS ZUR WAAG Münsterhof 8 3 ZUNFTHAUS ZUR MEISEN Münsterhof 20 4 GALERIE DADA / GALERIE Bahnhofstr. 19 / Eingang Tiefenhöfe 12 CORAY/ SPRÜNGLI HAUS 5 PSYCHOTHERAPEUTISCHE Steinwiesstrasse 38, 8032 Zürich RAXIS CHARLOT & EVA STRASSER-EPPELBAUM Dieses Symbol definiert Aufträge, die zusammen- hängend und aufeinander aufbauend sind. IMPRESSUM SC HOO L OF D D DADA-ERE IGN IS- THE MEN PFA DE Herausgeber Kunstvermittlung Herzlichen Dank an das © 2016, Cabaret Voltaire Cabaret Voltaire Eva Gattiker Landesmuseum Zürich für Cynthia Luginbühl die beratende Unterstützung Cabaret Voltaire Konzept und Realisation von Prisca Senn und Spiegelgasse 1, CH-8001 Zürich Adrian Notz, Laura Sabel Gestaltung Rebecca Sanders. www.cabaretvoltaire.ch Marlon Ilg, Zürich Recherche und Text Unterstützung: Tanja Trampe Lektorat Else v. Sick Stiftung Beat Gloor (Textcontrol) SPRECHAKTE! «[...] Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben möglichst ohne Worte und ohne die Sprache, als: auf die Sprache zu verzichten. Dada Johann a der Schmutz klebt wie von Maklerhaenden, die Fuchsgang Goethe. Dada Stendhal, Dalai Lama, die Muenzen abgegriffen haben. Das Wort will Dada m'dada, Dada m'dada, Dada mhm' dada. ich haben, wo es aufhoert und wo es anfaengt. Auf die Verbindung kommt es an, und dass sie Jede Sache hat ihr Wort; da ist das Wort selber zur vorher ein bisschen unterbrochen wird. -
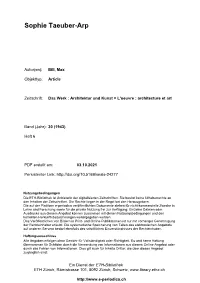
Sophie Taeuber-Arp
Sophie Taeuber-Arp Autor(en): Bill, Max Objekttyp: Article Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art Band (Jahr): 30 (1943) Heft 6 PDF erstellt am: 03.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-24277 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch v rV'*.- ä ^^ ¦ '^S ^ v. V Sophie Taeuber «König Hirsch» für das Schweizerische Marionettentheater Zürich 1918 SOPHIE TAEUBER-ARP von Max Bill ig. Januar 188g geboren in Davos. igi6—'f)39 Lehrerin an der Kunstgewerbeschule Zürich. Beteiligung an der Dada-Bewegung im Cabaret Voltaire. i() iS Inszenierung des «König Hirsch » für das schweizerische Marionettentheater. -

Durante Quarenta Anos De Sua Vida, Delsarte Observou Os Gestos
Durante quarenta anos de sua vida, Delsarte observou os gestos expressivos das pessoas em diferentes situações da vida e lugares – desde asilos até prisões –, o que lhe possibilitou concluir que “O gesto é mais que o discurso” (GARAUDY, 1980, 81). Sua busca foi pelo humano em si mesmo, como uma arte universal criada por cada ser humano a partir das condições de sua própria existência. Estes dados permitiram-lhe a catalogação de uma grande quantidade de gestos realizados por diferentes partes do corpo e suas mudanças emocionais. Criou-se, portanto, um método que conectava o movimento, a voz, a expressão e a emoção humana e relacionava essencialmente o teatro, a mímica e o canto. Delsarte devotou sua vida à descoberta de leis gerais e princípios de expressão. A análise de Delsarte sobre a anatomia e a expressão humana fundamentou-se em dois princípios: • O Princípio da Correspondência: estabelece uma relação entre corpo e alma que transpõe o dualismo ocidental, através da conexão dentro e fora (interno/externo), na qual, para Delsarte, “A toda manifestação do corpo corresponde uma manifestação interior do espírito” (GARAUDY, 1980, 82). • O Princípio de Trindade: engloba os três princípios do Ser Humano: a vida, o espírito, a alma que formam uma unidade, sendo definida como “a unidade de três coisas das quais para cada uma é essencial as outras duas, cada co-exitência no tempo, co- penetração no espaço, e cooperatividade no movimento” (PARTSCH-BERGSOHN, 1994, 13). Delsarte, partindo do Princípio de Trindade, divide o corpo em três partes: cabeça (centro do intelectual), tronco (correspondente ao emocional e a moral) e pernas (como parte menos expressiva associada ao físico ou animal). -

Monte Dada Il 10 Aprile 1917 Hugo Ball Annotava Nel Suo Diario
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della cultura UFC Monte Dada Il 10 aprile 1917 Hugo Ball annotava nel suo diario: «Sto studiando una nuova danza con cinque allieve di Laban (della scuola di danza di Rudolf Laban) travestite da africane con maschere sul viso e lunghi caffettani neri. I movimenti sono simmetrici, il ritmo fortemente marcato, la mimica volutamente brutta e deformata». Benché non sia mai stato dimostrato che Ball abbia veramente preparato personalmente la coreografia di questa danza dadaista, la citazione testimonia della collaborazione artistica instauratasi tra singoli esponenti del Dadaismo e alcuni ballerini formatisi presso le scuole di Rudolf von Laban, danzatore, maestro e riformatore della danza, in particolare presso la Schule für Bewegungskunst che fondò nel 1913 sul Monte Verità e la Laban-Schule che inaugurò nel 1915 a Zurigo. Tra di loro si annoveravano prevalentemente danzatrici, come Katja Wulff, la tedesca Mary Wigman, divenuta poi una delle massime rappresentanti della danza espressionista, la ginevrina Suzanne Perrottet, pianista e successivamente pedagogista della danza, o anche Sophie Taeuber, artista figurativa e architetta. Laban frequentava regolarmente le serate dadaiste e secondo le memorie della sua allieva Suzanne Perrottet ne era entusiasta: «Erano forme nuove, fresche». Diversamente da quanto lasciava intendere il significato internazionale conferito alla danza espressionista, al Monte Verità e al Dadaismo, queste collaborazioni artistiche tra riformatori della danza e artisti Dada non sono mai state veramente approfondite. Oggi è rimasto ben poco delle danze che le cronache e le recensioni giornalistiche dell’epoca definivano «astratte» e «cubistiche». L’obiettivo del progetto storico–documentario intitolato «Monte Dada» promosso dalla studiosa di scienze della danza Mona De Weerdt e dallo storico Andreas Schwab è quello di elaborare questi importanti impulsi forniti dai dadaisti e dai riformatori della danza. -

Sophie Taeuber-Arp Aujourd'hui C'est Demain Du 23 Août Au 16 Novembre 2014 Aargauer Kunsthaus, Aarau (CH)
Communiqué de presse Aarau, août 2014 Sophie Taeuber-Arp Aujourd'hui c'est demain du 23 août au 16 novembre 2014 Aargauer Kunsthaus, Aarau (CH) Sophie Taeuber-Arp (1889 – 1943) compte au nombre des artistes suisses les plus marquants du XXe siècle. Douée de nombreux dons et souveraine dans sa manière de travailler les formes, les couleurs et les matériaux, elle a conçu une œuvre répondant aux exigences les plus élevées en termes de qualité et de continuité dans les domaines du design, de la peinture, du textile, du dessin, de la sculpture, de l’architecture, de la danse et de la scénographie. L’exposition Sophie Taeuber-Arp. Aujourd’hui c’est demain fournit l’occasion de découvrir la pensée et l’action transdisciplinaire de cette artiste au vu de plus de 300 pièces, dans une profondeur et une amplitude inégalées, et de rendre hommage au travail de pionnier qu’elle a fourni dans l’art moderne. L’exposition Sophie Taeuber-Arp. Aujourd’hui c’est demain offre la vue d’ensemble la plus importante et la plus complète jamais consacrée à l’œuvre de cette artiste suisse d’avant-garde. Le public pourra admirer de grands groupes d’œuvres, dans tous les domaines où elle a pratiqué, qui posent les bases de la compréhension de la méthodologie artistique de Sophie Taeuber-Arp. La présentation des œuvres vit ainsi des liens mutuels existant entre elles, qui montrent qu’elle concrétisait des objectifs artistiques en fonction des problèmes et sur un mode analytique, mais aussi de manières parallèle et combinée. Elle reprenait des approches passées ou anticipait sur de nouvelles approches dans une conception en réseau. -

HANNE BERGIUS © Das Lachen Dadas in Berlin Und Seine Wirkungsgeschichten Gegen Die Macht Des Militärs Und Der Medien
HANNE BERGIUS © Das Lachen Dadas in Berlin und seine Wirkungsgeschichten Gegen die Macht des Militärs und der Medien Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zu „Weimar – Republik der Moderne“, Theater Münster, 28. Januar 2019. 1. Das Lachen als Strategie zwischen Tod und Leben 2. Der Künstlertypus als Dandy und die Gruppenkonstellationen 3. Die parodistische Umdeutung traditioneller Ikonographien 4. Das Prinzip Fotomontage 5. Wirkungsgeschichten Wir feiern in diesen Jahren viele Zentenarien der Avantgarden – wie DADA, die UFA, das Bauhaus... Wir feiern gleichzeitig damit den Beginn einer Moderne, die Literatur, Kunst und Architektur im aktuellen politischen und wirtschaftlichen, technischen Zeitgeschehen verorten wollte. Dass Dada Berlin diesen Anspruch einlösen wollte, davon handelt dieser Vortrag. Das Lachen Dadas war zunächst eine mit Verzweiflung gemischte Reaktion auf die erschütternde Kultur- und Gesellschaftskrise, die der Erste Weltkrieg auslöste. Hören wir Erwin Piscator, den dada berlin nahestehende Regisseur, über die desaströsen internationalen Endprodukte des Ersten Weltkrieges und seine unvorstellbaren massenhaften Destruktionspotentiale. Abb. Kriegsbegeisterung Abb. Kriegszerstörung im Stellungkrieg 1916 „Meine Zeitrechnung beginnt am 4. August 1914. Von da ab stieg das Barometer: 13 Millionen Tote/ 11 Millionen Krüppel/ 50 Millionen Soldaten, die marschierten/ 6 Milliarden Geschosse/ 50 Milliarden Kubikmeter Gas/ Was ist da persönliche Entwicklung? Niemand entwickelt sich da persönlich. Da entwickelt etwas anderes ihn.“ Die Überwältigungsmacht von Tod und Zerstörung löste eine Sinnkrise aus, die mit einer Subjektkrise einherging und jeden Diskurs über die Künste außer Kraft zu setzen schien. „Der Tod Gottes“ wie der „Tod der Kunst“ setzten Dada an den Anfang – so Hausmann. Im Lachen suchten die Dadaisten einen Weg, ihre Würde in einer würdelosen Zeit zu retten. -

Monte Dada Am 10. April 1917 Notiert Hugo Ball in Sein Tagebuch
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Kultur BAK Monte Dada Am 10. April 1917 notiert Hugo Ball in sein Tagebuch: «Mit fünf Laban-Damen (aus der Tanzschule Rudolf Labans) als Negressen in langen schwarzen Kaftans und Gesichtsmasken studiere ich einen neuen Tanz ein. Die Bewegungen sind symmetrisch, der Rhythmus stark betont, die Mimik von ausgesuchter, krüppelhafter Hässlichkeit.» Ob Ball diesen dadaistischen Tanz wirklich selber einstudierte und eigenständig choreografierte ist nicht eindeutig belegt. Insbesondere bezeugt wird in diesem Zitat jedoch, dass es zu künstlerischen Zusammenarbeiten zwischen einzelnen Dada-Künstler/innen und einigen beim Tänzer, Tanzpädagogen und Tanzreformer Rudolf von Laban in seiner 1913 auf dem Monte Verità gegründeten Schule für Bewegungskunst sowie der 1915 in Zürich eröffneten Laban-Schule ausgebildeten Tänzer/innen gekommen ist. Darunter befanden sich v.a. weibliche Tänzerinnen wie u.a. Katja Wulff, die später berühmt gewordene deutsche Ausdruckstänzerin Mary Wigman, die Genfer Pianistin und spätere Tanzpädagogin Suzanne Perrottet sowie die bildende Künstlerin und Architektin Sophie Taeuber. Auch besuchte Laban regelmässig die dadaistischen Soireen und gemäss seiner Schülerin Suzanne Perrottet war er begeistert von ihnen, denn – so Perrottet in ihren Memoiren „es waren neue Formen, und es war frisch.“ Doch anders als die weltweite Bedeutung von Ausdruckstanz, Monte Verità und Dada vermuten liesse, wurden diese künstlerischen Kollaborationen zwischen einzelnen Tanzreformer/innen und -

Hans Richter: Activism, Modernism, and the Avant-Garde
Cover illustrations: film still from Inflation; detail from Rhythmus 23 (Museo Cantonale d’Arte, Lugano). © Hans Richter Estate. of the early twentieth-century avant-garde and his political activism. When Richter’s work, particularly that of his earlier, European career, is viewed in its historical and political context, he emerges as an artist committed to the power of art to change the fabric of social, political, and cultural affairs. The essays in this book, which accompanied a major 1998 Richter retro- spective held in Valencia, Spain, and at HANS RICHTER the University of Iowa Art Museum, are ACTIVISM, MODERNISM, organized roughly around the expression- AND THE AVANT-GARDE ist and Dada years, Richter’s short tenure in Munich’s postwar revolutionary Second edited by Council Republic, his central involvement Few artists spanned the movements of in international constructivism and the early twentieth-century art as completely development of the abstract cinema, and as did Hans Richter. Richter was a major Stephen C. Foster the politicization of film that arose from his force in the developments of expression- anti-Nazi activities of the late twenties and HANS RICHTER HANS RICHTER ism, Dada, De Stijl, constructivism, and thirties. surrealism, and the creator, with Viking Stephen C. Foster is Professor in the Eggeling, of the abstract cinema. Along School of Art and Art History at the ACTIVISM, MODERNISM, with Theo van Doesburg, László Moholy- University of Iowa. Nagy, El Lissitzky, and a few others, he is AND THE AVANT-GARDE edited by Foster one of the artists crucial to an understand- “The articles in Stephen Foster’s skillfully Stephen C. -
Eranos Conferenza Zoom Su Monte Verità
ART ASCONA Exploring culture in Ascona February 3, 2021 CONFERENZA ZOOM SU MONTE VERITÀ Follow Intervista ad Andrea BIASCA CARONI su Monte Verità : Arcadia non Utopia ! Diversamente da come abbiamo sentito no ad oggi, il termine “utopia“, coniato da Tommaso Moro, non ha la stessa connotazione del termine Arcadia: non riprende una società ed una Natura idealizzata dall’uomo secondo le sue esigenze; l’Arcadia rappresenta il risultato spontaneo della vita vissuta naturalmente, lontano dalla corruzione della civiltà. Arcadia come un mondo perduto, di felicità perfetta e duratura, raccontato come un ricordo lontano e felice. Anche l’opera Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare è ambientata entro i limiti di un regno con le stesse caratteristiche dell’Arcadia, governato da un re fatato e una regina. Nell’ultimo decennio del XVI secolo, Sir Philip Sidney fa circolare delle copie di un suo poema eroico e Countess of Pembroke’s Arcadia, stabilendo l’Arcadia come un modello del Rinascimento. Il tema dell’Arcadia fu in gran voga anche nel XVIII secolo: celebre è il villaggio costruito a Versailles, dove la regina Maria Antonietta, smessi i panni di sovrana, aveva l’occasione di essere una felice contadinella in un mondo fatato ed idilliaco. L’idea originaria nasce in Slovenia, in un sanatorio a Bled dove si incontrano i pionieri. L’origine : Arnold Rikli (1823–1906, Canton Berna), preoccupandosi della salute dei suoi operai nel 1854 fonda un sanatorio nella cittadina ungherese di Veldes, l’odierna Bled in Slovenia. Il metodo si basava sull’idroterapia così come era praticata dagli anni Trenta dell’Ottocento dall’abate naturopata Sebastian Kneipp (1821–1897) cui Rikli abbinò successivamente una «cura atmosferica» che combinava getti d’acqua fredda e bagni di vapore con esercizi di raorzamento, allenamento sico dieta vegetariana e prolungate esposizioni al sole. -

Monte Verità, Ascona Eine Chronologie Von Harald Szeemann Mit Beiträgen Von Theo Kneubühler Und Willy Rotzler
Europäische Kunstzeitschrift V « A il0ßy;yyf Für eine Geschichte braucht es tausend Worte, für ein Wort tausend Geschichten. Ernst Frick Monte Verità, Ascona Eine Chronologie von Harald Szeemann Mit Beiträgen von Theo Kneubühler und Willy Rotzler Drei betagte Männer sitzen im Septem¬ *'<-v»îrT"N*'ft Dr. Raphael Friedeberg, Sohn des Rabbi¬ ber 1936 auf dem Monte Verità oberhalb ners von Tilsit, sozialistischer -.# wegen Ascona im Garten der Casa Ca' al Sass, ¦¦*¦ Umtriebe von der Universität Königs¬ das von der Photographin Margarethe berg relegierter Student der Geschichte, Feilerer und dem Maler Ernst Frick in Hauslehrer bis zur Aufhebung der Sozia¬ der Mitte der zwanziger Jahre über dem !$ listengesetze in Deutschland, Studium Fundament des sogenannten Liebetreu¬ der Medizin, Mitreorganisator der Kran¬ turmes, benannt nach M. Liebetreu, Di¬ kenkassenbewegung, SPD-Stadtverord¬ rektorin des Hotels, der vegetarischen neter in Berlin, wegen anarchistischer Pension und des Erholungsheimes Tendenzen (Antiparlamentarismus und Monte Verità und unglückliche Geliebte Befürwortung des Generalstreiks als kul¬ des Besitzers des Monte Verità, Henri W turelles Kampfmittel) 1907 aus der Par¬ Oedenkoven, erbaut wurde. Die Photo¬ tei ausgeschlossen, seit 1909 Rückzug graphie ist ein Schlüsselbild für die Ge¬ von der anarchistischen Bewegung, 1904 schichte nicht nur des 25000 m2 grossen erstmals als Patient auf Monte Verità, Luftparks sondern auch für eine Summe tt seit 1908 Amtsarzt von Ascona und im mitteleuropäischer Lebensentwürfe. Die Sommer Badearzt in Bad Kudowa Namen der drei Männer lauten: Ernst (Schlesien). Die Photographin Margare¬ Frick, Metallgiesser, Redaktor der anar¬ the Feilerer kam 1910 aus ihrer Heimat¬ chistischen Zeitschrift «Der Weckruf» in 4Tl<?t. stadt Linz zur Gesangsausbildung in die Zürich, Anarchist, Bildhauer, Kunstma¬ Schule der Langvara nach Ascona, 1920 ler, Archäologe, 1906 erstmals in As¬ Ernst Frick, Max Nettlau und Raphael Friedeberg verliebt sie sich in Ernst Frick.