Masterarbeit / Master´S Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“How to Teach Multiethnic and Transnational History: Ukraine”
“How to Teach Multiethnic and Transnational History: Ukraine” An academic workshop dedicated to the 100th birthday of Professor Ivan Lysiak-Rudnytsky 3-5 November 2019 Venue: School of Humanities Ukrainian Catholic University, 2a Kozelnytska str., Lviv, Ukraine Accommodation: Patriarch Josyf Slipyj Collegium Ukrainian Catholic University, 2a Kozelnytska str., Lviv, Ukraine Organizers: Department of Modern and Contemporary Ukrainian History and the Jewish Studies Program at the Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine Center for Governance and Culture in Europe at the University of St. Gallen, Switzerland Center for Interethnic Relations Research in Eastern Europe, Kharkiv, Ukraine Tymish and Genovefa Shevchuk Fund Conference Program Procedure: Presentation – 10 min., Q&A and Discussion – 30 min., Discussants Comments – 10 min. Discussants: Mayhill Fowler, Associate Professor of History, Stetson University, USA Volodymyr Sklokin, Associate Professor of History, Ukrainian Catholic University, Ukraine Guido Hausmann, Professor of East and South European History, University of Regensburg, Germany Yaroslav Hrytsak, Professor of History, Ukrainian Catholic University, Ukraine Kerstin Susanne Jobst, Professor of East European History, University of Vienna Sunday, November 3 (seminar room 424) 17:00 Keynote lecture Yaroslav Hrytsak (Ukrainian Catholic University): Historian who rethought Ukrainian history: Ivan L. Rudnytsky (1919- 1984) and his legacy Monday, November 4 (seminar room 206) 9:00 - 9:20 Opening remarks 9:20 - 9:40 Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University): Historical studies at the Ukrainian Catholic University 9:40 - 10:30 Perga Iurii (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute): Ukraine within the context of European History 10:30 - 11:00 Coffee break 11:00 - 11:50 Vadym Ilin (Kharkiv National Medical University): The anthology of historical sources for English-speaking medical students who study the course "History of Ukraine and Ukrainian Culture" 11:50- 12:40 Vladyslava Moskalets (Ukrainian Catholic University). -

The Northern Black Sea Region in Classical Antiquity 4
The Northern Black Sea Region by Kerstin Susanne Jobst In historical studies, the Black Sea region is viewed as a separate historical region which has been shaped in particular by vast migration and acculturation processes. Another prominent feature of the region's history is the great diversity of religions and cultures which existed there up to the 20th century. The region is understood as a complex interwoven entity. This article focuses on the northern Black Sea region, which in the present day is primarily inhabited by Slavic people. Most of this region currently belongs to Ukraine, which has been an independent state since 1991. It consists primarily of the former imperial Russian administrative province of Novorossiia (not including Bessarabia, which for a time was administered as part of Novorossiia) and the Crimean Peninsula, including the adjoining areas to the north. The article also discusses how the region, which has been inhabited by Scythians, Sarmatians, Greeks, Romans, Goths, Huns, Khazars, Italians, Tatars, East Slavs and others, fitted into broader geographical and political contexts. TABLE OF CONTENTS 1. Introduction 2. Space of Myths and Legends 3. The Northern Black Sea Region in Classical Antiquity 4. From the Khazar Empire to the Crimean Khanate and the Ottomans 5. Russian Rule: The Region as Novorossiia 6. World War, Revolutions and Soviet Rule 7. From the Second World War until the End of the Soviet Union 8. Summary and Future Perspective 9. Appendix 1. Sources 2. Literature 3. Notes Indices Citation Introduction -

Masterarbeit
MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit „Everyday Language Rights as a Reflection of Official Language Policies in Canada and Ukraine (1960s – present)“ Verfasser Oleg Shemetov angestrebter akademischer Grad Master (MA) Wien, 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 067 805 Studienrichtung lt. Studienblatt: Individuelles Masterstudium: Global Studies – a European Perspective Betreuerin / Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst, Privatdoz. M.A. MASTERARBEIT / MASTER THESIS Titel der Masterarbeit /Title of the master thesis Everyday Language Rights as a Reflection of Official Language Policies in Canada and Ukraine (1960s – present) Verfasser /Author Oleg Shemetov angestrebter akademischer Grad / acadamic degree aspired Master (MA) Wien, 2014 Studienkennzahl : A 067 805 Studienrichtung: Individuelles Masterstudium: Global Studies – a European Perspective Betreuer/Supervisor: Univ.-Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst, Privatdoz. M.A. 2 Table of contents 1. Introduction 3 2. Theoretical Background 2.1. Language rights as human rights 9 2.2. Language policy 12 2.3. Understanding bilingualism 2.3.1. Approaches to understanding the phenomenon of bilingualism 15 2.3.2. Bilingualism as a sociocultural phenomenon of the development of a society 22 3. Issue of Comparability 25 4. Overview of Official Language Policies 4.1. Canadian official bilingualism after the Quiet Revolution in Québec 39 4.2. Development of bilingualism in Ukraine after the Perestroika in the Soviet Union 48 5. Everyday Language Rights in Canada and Ukraine 55 6. Conclusion 70 Bibliography 72 List of Acronyms 85 Appendix 86 Abstract 3 1. Introduction The word distinguishes a man from an animal; language distinguishes one nation from another. Jean-Jacques Rousseau The tie of language is, perhaps, the strongest and most durable that can unite mankind. -

Austria Kultur International Jahrbuch Der Österreichischen Auslandskultur 2018 Austria Kultur International Jahrbuch Der Österreichischen Auslandskultur 2018
Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2018 Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2018 Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2018 Marte.Marte Architekten, Schanerlochbrücke © Marc Lins Photography Inhalt Die Österreichische Auslandskultur 2018 9 Alexander Schallenberg, Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres Vorwort 13 Teresa Indjein (BMEIA), Leiterin der Sektion für Kulturelle Auslandsbeziehungen SCHWERPUNKTJAHR ALBANIEN – GEMEINSAMES NEU ENTDECKEN Kulturjahr Österreich-Albanien: „Kultur beginnt im Herzen“ 19 Johann Sattler (BMEIA), Österreichischer Botschafter in Tirana, und Eljana Mankollari, Kulturreferentin (BMEIA), Österreichische Botschaft Tirana MIT GESCHICHTE DENKEN „Erinnerung ist eine Form der Begegnung“: Gedenkjahr 2018 29 Ulla Krauss-Nussbaumer (BMEIA), Leiterin der Abteilung für die Durch- führung kultureller und wissenschaftlicher Veranstaltungen im Ausland Grundlagen für ein freiwilliges Engagement: Gedenk-, Friedens- und 37 Sozialdienst im Ausland Wolfgang Gschliffner, Abteilung V/A/6, Gedenk- Friedens- oder Sozialdienst im Ausland, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz „Sie ist verstorben“. Erfahrungen und Überlegungen aus dem Gedenkdienst 42 Christopher Rochow, Gedenkdiener am Leo Baeck Institut in New York (Verein Gedenkdienst) Ein ganzes halbes Jahr: Mein Auslandsdienst in Rom 45 Nina Perendi, Freiwillige Mitarbeiterin an der Fondazione Museo della Shoah in Rom ARBEITEN -

Annual Report LUCIS 2014
Annual report LUCIS 2014 Text: Annemarie van Sandwijk & Petra Sijpesteijn Visiting address: Witte Singel 25 | Matthias de Vrieshof 4 room 1.06b | 2311 BZ | Leiden Postal address: P.O. Box 9515 | 2300 RA | Leiden Telephone: +31 (0)71 527 2628 Email: [email protected] Website: www.lucis.leidenuniv.nl Leiden Islam Blog: www.leiden-islamblog.nl LUCIS annual report 2014 1 Table of Contents List of abbreviations ..................................................................................................................... 3 Introduction by the director .......................................................................................................... 4 1. Annual report ..................................................................................................................... 6 1.1 Visibility ................................................................................................................................................... 6 1.1.1 Academic outreach .......................................................................................................................... 7 1.1.2 Public outreach ................................................................................................................................ 8 1.2 Internal cohesion and cooperation within Islamic studies .............................................................. 10 1.3 Publications .......................................................................................................................................... -

Sunday, November 22, 2015 Registration Desk Hours: 7:00 A.M
This version of the program was last updated on June 8, 2015 For the most up-to-date program, see http://convention2.allacademic.com/one/aseees/aseees15/ Sunday, November 22, 2015 Registration Desk Hours: 7:00 a.m. - 10:00 a.m. Registration Desk 1 and Grand Ballroom Prefunction Area - 5th Floor Cyber Café Hours: 7:00 a.m. - 1:45 p.m. – Franklin Hall Prefunction Area Exhibit Hall Hours: 9:00 p.m. – 1:00 p.m. Franklin Hall B Session 12 – Sunday – 8:00-9:45 am Committee on Libraries and Information Resources Membership Meeting - Franklin Hall A Room 4 Working Group on Cinema and Television - Meeting Room 301 12-01 Russia's Great War & Revolution: Diplomatic and Military Aspects - (Roundtable) - Franklin Hall A Room 1 Chair: Scott W. Palmer, Western Illinois U Anthony John Heywood, U of Aberdeen (UK) Bruce William Menning, U of Kansas 12-02 The 25th Anniversary of the Fall of Communist Party Rule in Albania - (Roundtable) - Franklin Hall A Room 2 Sponsored by: Society for Albanian Studies Chair: Nicholas C. Pano, Western Illinois U Fred Abrahams, Human Rights Watch Robert C. Austin, U of Toronto (Canada) Elez Biberaj, Voice of America Arolda Elbasani, Robert Schuman Center for Advanced Studies/ European U (Italy) Elton Skendaj, U of Miami 12-03 Three Histories? Revisiting Polish/Jewish Historiography - (Roundtable) - Franklin Hall A Room 3 Chair: Antony Polonsky, Brandeis U Natalia Aleksiun, Touro College Karen Auerbach, UNC at Chapel Hill Rachel L. Rothstein, U of Florida Joanna Sliwa, Clark U Sarah Ellen Zarrow, New York U 12-05 When Facts Travel: Ethnographic Explorations of Knowledge Transfer in Health, Medicine, and Science - Franklin Hall A Room 13 Chair: Jill T. -

Graduiertenschule Für Ost- Und Südosteuropastudien Jahresbericht 2014 Jahresbericht Jahresbericht 2014
Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien JAHRESBERICHT 2014 JAHRESBERICHT JAHRESBERICHT 2014 REVISITED AREA STUDIES CONNECTIVITY, COMPARISON, LATERALITY FIRST ANNUAL CONFERENCE OF THE GRADUATE SCHOOL FOR EAST AND SOUTHEAST EUROPEAN STUDIES 12 – 14 JUNE 2014, MUNICH ABOUT THE CONFERENCE The conference will discuss institu tional pathways, the relationship between political expediency and area study development and methodological innovation. Since the exploration of a particu lar region needs to highlight also its relations with other parts of the world, the conference aims at facilitating a dialogue between Area Studies focusing on different parts of the globe. The conference starts on 12 June, 6 p. m., with a round table discussion on the state of East European Studies. VENUE Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft e. V. ( Amalienstraße 38, Munich) ORGANIZATION Graduate School for East and Southeast European Studies (LMU Munich / University of Regensburg) REGISTRATION Please register until 8 June by e-mail: [email protected] GRADUIERTENSCHULE FÜR OST- UND SÜDOSTEUROPASTUDIEN WWW.GS-OSES.DE Graduate School for East and Southeast European Studies Design Sebastian Lehnert, Munich www.gs-oses.de Das zweite Jahr Inhalt Impressum Editorial — 1 Herausgeberin Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien Forschungsfelder Irina Morozova: The Debate on Progress, Social Order Ludwig-Maximilians-Universität Universität Regensburg and Economy — 7 München Landshuter Straße 4 Karina Shyrokykh: Roads to Human -

Wintersemester 2005/06
UNIVERSITÄT WIEN PHILOLOGISCH-KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT INSTITUT FÜR SLAWISTIK INSTITUTSBERICHT FÜR DAS AKADEMISCHE JAHR 2017/2018 (Berichtszeitraum: 01.10.2017 bis 30.09.2018) zusammengestellt von Mag. Sylvia Richter im Auftrag von Univ.-Prof. Dr. Fedor POLJAKOV Institutsvorstand April 2019 Inhalt 1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ....................................................................................... 3 2. Lehre .................................................................................................................................. 5 2.1. HörerInnenstatistik ...................................................................................................... 5 2.1.1. HörerInnen WS 2017 ............................................................................................... 5 2.1.2. HörerInnen SoSe 2018 ............................................................................................. 5 2.2. Lehrveranstaltungen .................................................................................................... 5 2.2.1. Wintersemester 2017 ................................................................................................ 5 Lehrveranstaltungen aus dem Bachelorprogramm ............................................................. 5 Lehrveranstaltungen aus dem Masterprogramm ................................................................ 7 Lehrveranstaltungen aus der Fachdidaktik ......................................................................... 8 Fachtutorien und -

Information About Authors
j:makieta 13-5-2019 p:183 c:1 black–text PHILOLOGICAL STUDIES. LITERARY RESEARCH [PFLIT] Warszawa 2019 PFLIT, issue 9(12), part 1 INFORMATION ABOUT AUTHORS Prof. Christoph Augustynowicz, nr ORCID: 0000-0001-5926-6207 Institut fu¨r Osteuropa¨ische Geschichte (Institute of East European History), University of Vienna email: [email protected]; tel. +43 142 774 1113 Prof. Christoph Augustynowicz is extraordinary professor at the Department of East European History (University of Vienna). His research interests include: Habsburg relations concerning Eastern Europe during the early modern period; Galician-Polish borderland studies; social history of Poland-Lithuania with special interest in the Jewish population; images and stereotypes of Eastern Europe; history of historiography (concep- tions of East Central Europe). Recent monographs: Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772–1844 (2015); Kleine Kulturgeschichte Polens. Vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert (2017). Magdalena Baran-Szołtys, PhD, nr ORCID: 0000-0001-6712-8138 Institut fu¨r Osteuropa¨ische Geschichte (Institute of East European History), University of Vienna e-mail: [email protected]; tel. +43 142 774 1101 Magdalena Baran-Szołtys, PhD, is researcher (postdoc) within the Research Cluster for the Study of East Central Europe and the History of Transformations (RECET) at the Institute of East European History (University of Vienna); research associate at the research platform Mobile Cultures and Societies (University of Vienna); currently Literar-Mechana research fellow 2018/19. She received her PhD with the comparative thesis Galizien als Archiv. Reisen nach (Post-)Galizien in der polnischen und deutsch- sprachigen Literatur nach 1989 from the University of Vienna (DP: Austrian Galicia and its Multicultural Heritage) in 2018. -
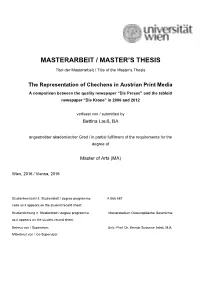
Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis The Representation of Chechens in Austrian Print Media A comparison between the quality newspaper “Die Presse” and the tabloid newspaper “Die Krone” in 2006 and 2012 verfasst von / submitted by Bettina Lauß, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2016 / Vienna, 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt / degree programme A 066 687 code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / degree programme Masterstudium Osteuropäische Geschichte as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst, M.A. Mitbetreut von / Co-Supervisor: Contents 1 Introduction .......................................................................................................... 4 1.1 State of Research .......................................................................................... 5 1.2 Central Issue of the Study (Research Questions).......................................... 6 1.3 Choice of Investigation Period ....................................................................... 7 1.4 Choice of Sample Newspapers ..................................................................... 8 1.5 Discourse and Public Opinion ..................................................................... 11 1.6 Hypotheses ................................................................................................. 15 -

Philadelphia, PA
ASSOCIATION FOR SLAVIC, EAST EUROPEAN, & EURASIAN STUDIES 47th Annual Convention November 19-22, 2015 Philadelphia Marriott Downtown Philadelphia, PA “Fact” “So the crucial issue is: how do we retain a sophisticated sense of the many ramifications of the factual, without sliding into bland generalizing relativism of a kind that plays into the hands of ideological distortions and disinformation?” Catriona Helen Moncrieff Kelly, University of Oxford ASEEES Board President 2 CONVENTION SPONSORS ASEEES thanks all of our sponsors whose generous contributions and support help to promote the continued growth and visibility of the As- sociation during our Annual Convention and throughout the year. GOLD SPONSORS: American Councils for International Education(AC- TR/ACCELS), Natasha Kozmenko Publishers SILVER SPONSOR: Institute of Modern Russia BRONZE SPONSORS: Indiana University Russian and East European In- stitute; University of Michigan Center for Russian, East European & Eur- asian Studies and Weiser Center for Europe & Eurasia; University of Tex- as-Austin Center for Russian, East European and Eurasian Studies ASSOCIATE SPONSORS: Bloomsburg University of Pennsylvania College of Liberal Arts; Bryn Mawr College Department of Russian; New York University Department of Russian and Slavic Studies; Ohio State Univer- sity Center for Slavic and East European Studies; St. Joseph’s University International Relations Program; Swarthmore College ASEEES DONORS We are grateful to our generous donors; their commitment to supporting ASEEES’ work is sincerely appreciated. BENEFACTORS- Lynda Park SUPPORTERS-UP TO $1,000+ Marilyn R. Rueschemeyer $49 Jonathan H. Bolton Christine Ann Rydel Andrew Behrendt Winson Chu Mark D. Steinberg Barbara Ann Chotiner Edith W. Clowes William Mills Todd, III Pey-Yi Chu Stephen F. -

CURRICULUM VITAE Correspondence Address: SHSS-HSG, Müller-Friedberg-Str. 8 / 52-7138, 9000 St. Gallen, Switzerland E-Mail
CURRICULUM VITAE OLEKSII CHEBOTAROV Correspondence address: SHSS-HSG, Müller-Friedberg-Str. 8 / 52-7138, 9000 St. Gallen, Switzerland e-mail: [email protected], [email protected] Tel.: +41 71 224 2561 Mob.: +41 78 82 54 336, +38 067 98 31 666 Fax: +41 71 224 2669 EDUCATION 2015 – 2020 Ph.D. Program in Cultural Theory and Organization Studies at the University of St. Gallen Thesis title: " Immigration and transmigration of the Jews from Russian empire in Habsburg Galicia, 1870 – 1914" Supervisor: Prof. Dr. Ulrich Schmid; Co-Supervisor: Prof. Dr. Yohanan Petrovsky-Shtern 2016 – 2019 Associate fellow, Doctoral Program “Austrian Galicia and its multicultural heritage”, Institute for East-European History, Vienna University Supervisor: Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst 2013 – 2015 MA Program in History at the Ukrainian Catholic University (Ukraine) Thesis title: "Jewish question in Lviv public space (late 1870s – early 1880s)" Supervisor: Prof. Dr. Yaroslav Hrytsak 2009 – 2013 BA Program in History at the V. Karazin Kharkiv National University (Ukraine) Thesis title: "Jewish question in Ukrainian National Movement of the Russian Empire (late 1850s – early 1880s)" Supervisor: Prof. Dr. Serhiy Naumov LANGUAGES Ukrainian, Russian – native; English – advanced; Polish – intermediate; German, Yiddish – pre- intermediate, Hebrew – elementary. EMPLOYMENT November Managing editor, The online open access Journal ‘Euxeinos. Governance and Culture in 2016 – the Black Sea Region’ (published by the Center for Governance and Culture in Europe at Present University of St.Gallen) http://www.gce.unisg.ch/en/euxeinos September Research Assistant, the Department of Russian Culture and Society of the School of 2015 – Humanities and Social Sciences at the University of St.