Ruprecht - Karls - Universität Heidelberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2017 09 08 Catalog
LANCASTER MENNONITE HISTORICAL SOCIETY ’S BENEFIT AUCTION OF RARE , OUT -OF -PRINT , AND USED BOOKS FRIDAY , SEPTEMBER 8, 2017, AT 6:30 P.M. TEL : (717) 393-9745; FAX : (717) 393-8751; EMAIL : [email protected] WEBSITE: http://www.lmhs.org/ The Lancaster Mennonite Historical Society will conduct an auction on September 8, 2017, at 2215 Millstream Road, Lancaster, Pennsylvania, one-half mile east of the intersection of Routes 30 and 462. The sale dates for the remainder of 2017 are as follows: November 10. The auction not only specializes in local and denominational history and genealogy of southeastern Pennsylvania, but also includes theological works and other types of material of interest to the nationwide constituency. Please refer to the last page of the catalog for book auction procedures. Individual catalogs are available from the Society for $5.00 + $3.00 postage and handling. Persons who wish to be added to the mailing list for the rest of 2017 may do so by sending $8.00 with name and address to the Society. Higher rates apply for subscribers outside of the United States. All subscriptions expire at the end of the calendar year. The catalog is also available for free on our web site at www.lmhs.org/auction.html . 1. The Mennonite Quarterly Review. Goshen, Ind.: Mennonite Historical Society. 28 quarterly iss: Vol. 46 (1972), no. 4; Vol. 74 (2000), no. 4; Vol. 75 (2001), no. 1-3; Vol. 77 (2003), no. 1-2; Vol. 78 (2004), no. 1, 3-4; Vol. 79 (2005), no. 1, 4; Vol. 80 (2006), no. -

Zwischen Strengem Reglement Und Freier Entfaltung Die Ersten Kapellmeister Der Kurbrandenburgischen Hofkapelle in Der Zeit Vor Dem Dreißigjährigen Krieg
Kulturgeschichte Preuûens - Colloquien 3 (2016) Detlef Giese Zwischen strengem Reglement und freier Entfaltung Die ersten Kapellmeister der kurbrandenburgischen Hofkapelle in der Zeit vor dem Dreiûigjährigen Krieg Abstract Dass es vornehmlich die Kapellmeister sind, die einem Klangkörper Gesicht und Stimme geben, gilt für die Gegenwart gleichermaûen wie für die Geschichte. Der jeweilige Stelleninhaber ist einerseits eingebunden in seine vertraglichen Verpflichtungen, besitzt andererseits aber auch gewisse Freiheiten, im Rahmen bestimmter Möglichkeiten seinen Tätigkeitsbereich für sich selbst zu definieren. Die Erwartungshaltungen der wechselnden Dienstherren wandeln sich ebenso wie das politisch-gesellschaftliche, institutionelle und allgemein kulturelle Umfeld, in der die administrative und künstlerische Arbeit des Kapellmeisters angesiedelt ist. Die Wirkung und Ausstrahlungskraft, welche die Protagonisten hierbei entfalten, sind wichtige Gradmesser für die Bedeutung sowohl der Person als auch der Institution im regionalen wie überregionalen Maûstab. Für die Frühzeit der kurbrandenburgischen Hofkapelle sind zumindest die Namen einiger Kapellmeister überliefert, die als empirische Individualitäten fassbar werden. Dem ersten namentlich bekannte Amtsträger Johann Wesalius, der bereits in den 1570er Jahren an der Spitze des Ensembles stand, kommt in diesem Zusammenhang Aufmerksamkeit und Interesse zu, desgleichen Musikern wie Johannes Eccard und Nikolaus Zangius, die in den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zu den respektablen, im Falle von Eccard sogar zu den prominenten, bis heute immer noch wertgeschätzten deutschen Komponisten ihrer Zeit zählten. Obwohl sie an jeweilige Rahmenbedingungen materieller wie personeller Art gebunden waren, besaûen sie doch ausreichend Räume zur eigenen Entfaltung, um sich künstlerisch zu profilieren. Auf der anderen Seite steht eine strenge Reglementierungen der Aufgaben und Aktivitäten von Seiten der Regenten, die nicht selten einengend wirkten, zumal die Ressourcen über den betrachteten Zeitraum von 1570 bis ca. -

Rejoice, Give Thanks, and Sing
a practical resource for Lutheran church musicians ALCM No. 2, 2015 Rejoice, Give In this issue of Thanks, and Sing in tempo : Rejoice, Give Thanks, and Sing 1 The Ostinato of the Soul 5 Through the Church the Song Goes On: Making Chorales a Evangelical Lutheran Living Tradition 6 Lutheran Service Book Composing for Worship By Paul Grime the Church: by Martin Seltz You Can Do It! 8 hen the Lutheran wChurch—Missouri Synod en years ago this summer at Five-Year began in 1997 to explore tthe 2005 Churchwide the development of a new wor - Countdown to Assembly of the Evangelical ship resource, a unique history the 500th 11 Lutheran Church in America was very much at play. Lutheran (ELCA) held in Orlando, Florida, Worship (1982) had at that point Spruce Up Those this deliberative body commend - been in service for only 15 years. Chorale Preludes 12 ed Evangelical Lutheran Worship for The fact that fully one-third of use in the ELCA. The Evangelical LCMS congregations were still Singing the Lutheran Church in Canada took using the 1941 The Lutheran Church's Song at a similar action that year. Many Hymnal , and 10 percent were congregations have been using Christmas 14 using Lutheran Book of Worship, the “new” worship book now for said it all: the LCMS had signifi - In Review: Ein Neues over eight years. So, what’s been cant divisions when it came to the happening—especially from the Lied - A New Song 16 resources for use in worship. standpoint of musicians and Music in Season: singing assemblies? What aspira - Fast-forward nearly a decade to The Christmas tions for new principal worship August 2006. -

Mitteilungen
Mitteilungen Freundes- und Förderkreis des Händel-Hauses zu Halle e.V. 1 / 2017 WERDEN SIE MITGLIED Der »Freundes- und Förderkreis des Händel-Hauses zu Halle e.V.« unterstützt die Arbeit der Stiftung Händel-Haus ideell und finanziell in allen Belangen, die im Zusammenhang mit dem Geburtshaus von Georg Friedrich Händel stehen. Dazu gehören die Aufgaben als Musik- und Instrumentenmuseum, die Pflege der Musik des Meisters mit Konzerten und Veranstaltungen, die Erhaltung des Hauses selbst, die Händel-Forschung und die Forschung zur regionalen Musikgeschichte. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, werden Sie Mitglied unseres Freundes- und Förderkreises. Der Mitgliedsbeitrag beträgt e 25.00 für Einzelpersonen und e 30.00 für Familien im Jahr. Das Aufnahmeformular erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle im Händel- Haus oder Sie finden dieses unter www.haendelhaus.de/Freundes- und Förderkreis/Mitgliedschaft. 3 Inhalt 5 Editorial 45 Daniel Schad 7. Musikfest 6 Interview mit Unerhörtes Mitteldeutschland dem Chordirektor des Stadtsingechors zu Halle 46 Edwin Werner Herrn Clemens Flämig Prof. Dr. habil. Erich Neuß (1899–1982) – der erste Direktor 10 Jürgen Stolzenberg des Händel-Hauses »Singt weiter, Jungs, singt weiter« – 900 Jahre Stadtsingechor zu Halle 50 Jens Wehmann Von Seefahrern, Lumpensammlern, 13 Wolfgang Ruf tumben Liebhabern und einem von Wolff Heintz und Luther Händel inspirierten Distelfinken. Das »Pleasure Gardens«-Konvolut 22 Peter Overbeck in der Bibliothek der Stiftung 40. Internationale Händel-Haus Händel-Festspiele Karlsruhe 56 Bernhard Prokein 26 Dennis Engel und Nicole Overmann Geigenbauer Michael Ledfuß – Händel-Akademie in Karlsruhe Neubau als Aufgabe 28 Patricia Reese 60 Das Händelfestspielorchester Halle Vivica Genaux – informiert Ein Star ohne Allüren 61 Leser für Leser 30 Aktuelle Informationen zur Hallischen Händel-Ausgabe 62 Horst Fickelscher Triumph der Zeit und Wahrheit 33 Stephan Blaut Lesen, Hören, Kontrollieren, 65 Autoren Berichtigen, Übersetzen. -

Gesungene Aufklärung
Gesungene Aufklärung Untersuchungen zu nordwestdeutschen Gesangbuchreformen im späten 18. Jahrhundert Von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Fachbereich IV Human- und Gesellschaftswissenschaften – zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation von Barbara Stroeve geboren am 4. Oktober 1971 in Walsrode Referent: Prof. Dr. Ernst Hinrichs Korreferent: Prof. Dr. Peter Schleuning Tag der Disputation: 15.12.2005 Vorwort Der Anstoß zu diesem Thema ging von meiner Arbeit zum Ersten Staatsexamen aus, in der ich mich mit dem Oldenburgischen Gesangbuch während der Epoche der Auf- klärung beschäftigt habe. Professor Dr. Ernst Hinrichs hat mich ermuntert, meinen Forschungsansatz in einer Dissertation zu vertiefen. Mit großer Aufmerksamkeit und Sachkenntnis sowie konstruktiv-kritischen Anregungen betreute Ernst Hinrichs meine Promotion. Ihm gilt mein besonderer Dank. Ich danke Prof. Dr. Peter Schleuning für die Bereitschaft, mein Vorhaben zu un- terstützen und deren musiktheoretische und musikhistorische Anteile mit großer Sorgfalt zu prüfen. Mein herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Hermann Kurzke, der meine Arbeit geduldig und mit steter Bereitschaft zum Gespräch gefördert hat. Manche Hilfe erfuhr ich durch Dr. Peter Albrecht, in Form von wertvollen Hinweisen und kritischen Denkanstößen. Während der Beschäftigung mit den Gesangbüchern der Aufklärung waren zahlreiche Gespräche mit den Stipendiaten des Graduiertenkollegs „Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär“ unschätzbar wichtig. Stellvertretend für einen inten- siven, inhaltlichen Austausch seien Dr. Andrea Neuhaus und Dr. Konstanze Grutschnig-Kieser genannt. Dem Evangelischen Studienwerk Villigst und der Deutschen Forschungsge- meinschaft danke ich für ihre finanzielle Unterstützung und Förderung während des Entstehungszeitraums dieser Arbeit. Ich widme diese Arbeit meinen Eltern, die dieses Vorhaben über Jahre bereit- willig unterstützt haben. -

Hymnody of Eastern Pennsylvania German Mennonite Communities: Notenbüchlein (Manuscript Songbooks) from 1780 to 1835
HYMNODY OF EASTERN PENNSYLVANIA GERMAN MENNONITE COMMUNITIES: NOTENBÜCHLEIN (MANUSCRIPT SONGBOOKS) FROM 1780 TO 1835 by Suzanne E. Gross Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of The University of Maryland in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 1994 Advisory Committee: Professor Howard Serwer, Chairman/Advisor Professor Carol Robertson Professor Richard Wexler Professor Laura Youens Professor Hasia Diner ABSTRACT Title of Dissertation: HYMNODY OF EASTERN PENNSYLVANIA GERMAN MENNONITE COMMUNITIES: NOTENBÜCHLEIN (MANUSCRIPT SONGBOOKS) FROM 1780 TO 1835 Suzanne E. Gross, Doctor of Philosophy, 1994 Dissertation directed by: Dr. Howard Serwer, Professor of Music, Musicology Department, University of Maryland, College Park, Maryland As part of an effort to maintain their German culture, the late eighteenth-century Mennonites of Eastern Pennsylvania instituted hymn-singing instruction in the elementary community schoolhouse curriculum. Beginning in 1780 (or perhaps earlier), much of the hymn-tune repertoire, previously an oral tradition, was recorded in musical notation in manuscript songbooks (Notenbüchlein) compiled by local schoolmasters in Mennonite communities north of Philadelphia. The practice of giving manuscript songbooks to diligent singing students continued until 1835 or later. These manuscript songbooks are the only extant clue to the hymn repertoire and performance practice of these Mennonite communities at the turn of the nineteenth century. By identifying the tunes that recur most frequently, one can determine the core repertoire of the Franconia Mennonites at this time, a repertoire that, on balance, is strongly pietistic in nature. Musically, the Notenbüchlein document the shift that occured when these Mennonite communities incorporated written transmission into their oral tradition. -
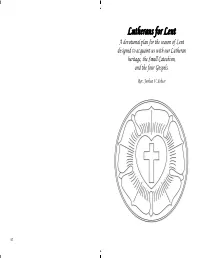
Lutherans for Lent a Devotional Plan for the Season of Lent Designed to Acquaint Us with Our Lutheran Heritage, the Small Catechism, and the Four Gospels
Lutherans for Lent A devotional plan for the season of Lent designed to acquaint us with our Lutheran heritage, the Small Catechism, and the four Gospels. Rev. Joshua V. Scheer 52 Other Notables (not exhaustive) The list of Lutherans included in this devotion are by no means the end of Lutherans for Lent Lutheranism’s contribution to history. There are many other Lutherans © 2010 by Rev. Joshua V. Scheer who could have been included in this devotion who may have actually been greater or had more influence than some that were included. Here is a list of other names (in no particular order): Nikolaus Decius J. T. Mueller August H. Francke Justus Jonas Kenneth Korby Reinhold Niebuhr This copy has been made available through a congregational license. Johann Walter Gustaf Wingren Helmut Thielecke Matthias Flacius J. A. O. Preus (II) Dietrich Bonheoffer Andres Quenstadt A.L. Barry J. Muhlhauser Timotheus Kirchner Gerhard Forde S. J. Stenerson Johann Olearius John H. C. Fritz F. A. Cramer If purchased under a congregational license, the purchasing congregation Nikolai Grundtvig Theodore Tappert F. Lochner may print copies as necessary for use in that congregation only. Paul Caspari August Crull J. A. Grabau Gisele Johnson Alfred Rehwinkel August Kavel H. A. Preus William Beck Adolf von Harnack J. A. O. Otteson J. P. Koehler Claus Harms U. V. Koren Theodore Graebner Johann Keil Adolf Hoenecke Edmund Schlink Hans Tausen Andreas Osiander Theodore Kliefoth Franz Delitzsch Albrecht Durer William Arndt Gottfried Thomasius August Pieper William Dallman Karl Ulmann Ludwig von Beethoven August Suelflow Ernst Cloeter W. -

Adobe Photoshop
Theorie und Praxis der Kasualdichtung in der Frühen Neuzeit Chloe Beihefte zum Daphnis Herausgegeben von Barbara Becker-Cantarino – Mirosława Czarnecka Franz Eybl – Klaus Garber – Ferdinand van Ingen Knut Kiesant – Ursula Kocher – Wilhelm Kühlmann Wolfgang Neuber – Hans-Gert Roloff – Alexander Schwarz Ulrich Seelbach – Robert Seidel – Jean-Marie Valentin Helen Watanabe-O’Kelly BAND 43 Amsterdam - New York, NY 2010 Theorie und Praxis der Kasualdichtung in der Frühen Neuzeit Herausgegeben von Andreas Keller, Elke Lösel, Ulrike Wels und Volkhard Wels The paper on which this book is printed meets the requirements of "ISO 9706:1994, Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence". ISBN: 978-90-420-3104-3 E-Book ISBN: 978-90-420-3105-0 ©Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, NY 2010 Printed in The Netherlands VORWORT Die hier versammelten Beiträge zur Theorie und Praxis der Kasual- dichtung in der Frühen Neuzeit sind das Ergebnis einer Tagung, die vom 27. bis 29. Juni 2008 von den Mitarbeitern des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literatur (Frühe Neuzeit) der Universität Potsdam im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam veran- staltet wurde. Die Veranstalter und damit auch die Herausgeber dieses Bandes danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finan- zielle Unterstützung der Tagung und den “Chloe”-Herausgebern für die Aufnahme in die Reihe. Wie die Tagung, so sei auch dieser Band Knut Kiesant zu seinem 65. Geburtstag gewidmet. Die Beiträge zeigen in der Vielfalt der besprochenen Texte das un- endlich wandelbare Antlitz der ‘Göttin Gelegenheit’. Dabei sind nun unversehens auch die Aufsätze dieses Bandes “Gelegenheitstexte” geworden – nämlich zu Ehren Knut Kiesants. -

Nineteenth Century Sacred Music: Bruckner and the Rise of the Cäcilien-Verein
Western Washington University Western CEDAR WWU Graduate School Collection WWU Graduate and Undergraduate Scholarship Spring 2020 Nineteenth Century Sacred Music: Bruckner and the rise of the Cäcilien-Verein Nicholas Bygate Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/wwuet Part of the Music Commons Recommended Citation Bygate, Nicholas, "Nineteenth Century Sacred Music: Bruckner and the rise of the Cäcilien-Verein" (2020). WWU Graduate School Collection. 955. https://cedar.wwu.edu/wwuet/955 This Masters Thesis is brought to you for free and open access by the WWU Graduate and Undergraduate Scholarship at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in WWU Graduate School Collection by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. Nineteenth Century Sacred Music: Bruckner and the rise of the Cäcilien-Verein By Nicholas Bygate Accepted in Partial Completion of the Requirements for the Degree Master of Music ADVISORY COMMITTEE Chair, Dr. Bertil van Boer Dr. Timothy Fitzpatrick Dr. Ryan Dudenbostel GRADUATE SCHOOL David L. Patrick, Interim Dean Master’s Thesis In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a master’s degree at Western Washington University, I grant to Western Washington University the non- exclusive royalty-free right to archive, reproduce, distribute, and display the thesis in any and all forms, including electronic format, via any digital library mechanisms maintained by WWU. I represent and warrant this is my original work and does not infringe or violate any rights of others. I warrant that I have obtained written permissions from the owner of any third party copyrighted material included in these files. -

Der Komponist Als Prediger: Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Motette Als Zeugnis Von Verkündigung Und Auslegung Vom Reformationszeitalter Bis in Die Gegenwart
DER KOMPONIST ALS PREDIGER: DIE DEUTSCHE EVANGELISCH-LUTHERISCHE MOTETTE ALS ZEUGNIS VON VERKÜNDIGUNG UND AUSLEGUNG VOM REFORMATIONSZEITALTER BIS IN DIE GEGENWART Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades vorgelegt beim Fachbereich 2 Kommunikation/Ästhetik Fach Musik/Auditive Kommunikation Carl von Ossietzky Universität Oldenburg von Jan Henning Müller Salbeistraße 22 26129 Oldenburg Oldenburg (Oldb) Juli 2002 Tag der Einreichung: 31.Juli 2002 Tag der Disputation: 29.Januar 2003 Gutachter: Prof. Dr. Peter Schleuning, Prof. Dr. Wolfgang E. Müller Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG 4 1.1 Thematische Einführung und Abgrenzung 4 1.2 Zur Darstellung 5 1.3 Gattungsspezifische Annäherung in vier Schritten 7 1.3.1 „Gattung“ als Vorstellung, Begriff und Kategorie 7 1.3.2 Musikalische Gattungen 10 1.3.3 Die Motette als musikalische Gattung 13 1.3.4 Zur Spezifität der evangelisch -lutherischen Motette 17 1.4 Konsequenzen für die Analyse und Motettenkorpus 20 1.4.1 Zur Analyse 20 1.4.2 Motettenkorpus 24 2 VORAUSSETZUNGEN IM MITTELALTER UND IM HUMANISMUS 26 2.1 Rhetorik, Homiletik und Predigt 26 2.2 Zum vorreformatorischen Musikbegriff 31 2.3 Gattungsgeschichtlicher Abriss: die Motette bis etwa 1500 34 3 „SINGEN UND SAGEN“: DIE GENESE DER GATTUNG 41 3.1 Aussermusikalische Faktoren 41 3.1.1 Theologische Voraussetzungen 41 3.1.2 Zum Musikbegriff der Reformatoren (Luther, Walter, Melanchthon) 55 3.1.3 Erste deutschsprachige Predigtmotetten 67 3.2 Innermusikalische Faktoren 82 3.2.1 Beispielfundus 82 3.2.2 Textdisposition 84 3.2.3 Modale Affektenlehre 91 3.2.4 Klausellehre und Klauselhierarchie 94 3.2.5 Musikalische Deklamation 110 3.2.6 Musikalisch-rhetorische Figuren 117 3.2.7 Analyseschema 127 4 DIE EV.-LUTH. -

Ulrich Leopold Paul Helmer
Consensus Volume 32 Article 5 Issue 1 Cultural Reception of the Gospel 5-1-2007 Ulrich Leopold Paul Helmer Follow this and additional works at: http://scholars.wlu.ca/consensus Recommended Citation Helmer, Paul (2007) "Ulrich Leopold," Consensus: Vol. 32 : Iss. 1 , Article 5. Available at: http://scholars.wlu.ca/consensus/vol32/iss1/5 This Articles is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in Consensus by an authorized editor of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. 73 Ulrich Leopold Paul Helmer Formerly Assiciate Professor of Musicology McGill University, Montréal Peering out at all passers-by from the portrait gallery of past Seminary deans in the hallway beside the chapel at Waterloo Lutheran Seminary is one Ulrich Siegfried Leupold (1909-70). In the preparatory work for a forthcoming monograph on European musicians who fled Germany prior to and shortly after World war II, I feel that I was able to learn something about this remarkable musician, theologian, and pastor, who played an important role in the education of several generations of clergy and laity and who also brought to North American religious communities a knowledge of the rich musical traditions of Continental European composers. How did someone who began his career as a musicologist in Berlin, Germany in the 1930s end up in Waterloo, Ontario, Canada as Dean of a Lutheran Seminary? Leupold’s father, Anton Wilhelm (1868-1940), was organist at the Sankt Petri church, Berlin,1 and was the first organist to perform Max Reger’s entire organ works in Berlin.2 His mother Gertrud, née Igel, was an opera singer. -

Luther's Hymn Melodies
Luther’s Hymn Melodies Style and form for a Royal Priesthood James L. Brauer Concordia Seminary Press Copyright © 2016 James L. Brauer Permission granted for individual and congregational use. Any other distribution, recirculation, or republication requires written permission. CONTENTS Preface 1 Luther and Hymnody 3 Luther’s Compositions 5 Musical Training 10 A Motet 15 Hymn Tunes 17 Models of Hymnody 35 Conclusion 42 Bibliography 47 Tables Table 1 Luther’s Hymns: A List 8 Table 2 Tunes by Luther 11 Table 3 Tune Samples from Luther 16 Table 4 Variety in Luther’s Tunes 37 Luther’s Hymn Melodies Preface This study began in 1983 as an illustrated lecture for the 500th anniversary of Luther’s birth and was presented four times (in Bronxville and Yonkers, New York and in Northhampton and Springfield, Massachusetts). In1987 further research was done on the question of tune authorship and musical style; the material was revised several times in the years that followed. As the 500th anniversary of the Reformation approached, it was brought into its present form. An unexpected insight came from examining the tunes associated with the Luther’s hymn texts: Luther employed several types (styles) of melody. Viewed from later centuries it is easy to lump all his hymn tunes in one category and label them “medieval” hymns. Over the centuries scholars have studied many questions about each melody, especially its origin: did it derive from an existing Gregorian melody or from a preexisting hymn tune or folk song? In studying Luther’s tunes it became clear that he chose melody structures and styles associated with different music-making occasions and groups in society.