Die Rheinbegradigung Durch Johann Gottfried Tulla
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
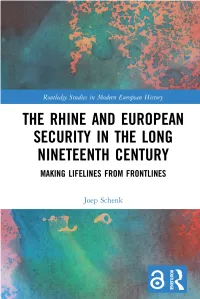
Making Lifelines from Frontlines; 1
The Rhine and European Security in the Long Nineteenth Century Throughout history rivers have always been a source of life and of conflict. This book investigates the Central Commission for the Navigation of the Rhine’s (CCNR) efforts to secure the principle of freedom of navigation on Europe’s prime river. The book explores how the most fundamental change in the history of international river governance arose from European security concerns. It examines how the CCNR functioned as an ongoing experiment in reconciling national and common interests that contributed to the emergence of Eur- opean prosperity in the course of the long nineteenth century. In so doing, it shows that modern conceptions and practices of security cannot be under- stood without accounting for prosperity considerations and prosperity poli- cies. Incorporating research from archives in Great Britain, Germany, and the Netherlands, as well as the recently opened CCNR archives in France, this study operationalises a truly transnational perspective that effectively opens the black box of the oldest and still existing international organisation in the world in its first centenary. In showing how security-prosperity considerations were a driving force in the unfolding of Europe’s prime river in the nineteenth century, it is of interest to scholars of politics and history, including the history of international rela- tions, European history, transnational history and the history of security, as well as those with an interest in current themes and debates about transboundary water governance. Joep Schenk is lecturer at the History of International Relations section at Utrecht University, Netherlands. He worked as a post-doctoral fellow within an ERC-funded project on the making of a security culture in Europe in the nineteenth century and is currently researching international environmental cooperation and competition in historical perspective. -

German History in Documents and Images
Johann Gottfried Tulla, The Rhine from Basel to Mannheim, with a Justification for the Necessity of Regulating this River (1822) Abstract Johann Gottfried Tulla (1770–1828) was a government engineer from Baden. Trained in Saxony and France, he was one of the earliest proponents of straightening the Upper Rhine through hydraulic engineering projects that aimed to control flooding and recover agricultural land. Although his interest in regulating the Rhine dated back to the Napoleonic era, he published his most famous and influential pamphlets in 1822 (below) and 1825. Tulla’s writings were published in the context of growing international cooperation to regulate river traffic along the Rhine among the bordering states—with that cooperation occurring within institutions established during Napoleon’s rule and the Congress of Vienna. Tulla’s project is often thought of in grandiose terms as an attempt to increase humankind’s power over nature by canalizing the river, but it is worth noting that he emphasized ecological thinking and the balance of natural forces in both the motivation and execution of the engineering works. In both respects, Tulla’s thinking bears comparison with that of German forest conservationists who aimed at sustainable management of natural economic resources. The rectification of the Rhine in its initial phases lasted from 1817 to 1876, but in many ways that first stage merely laid the groundwork for further engineering projects in the twentieth century that did, indeed, turn the Rhine into something akin to an artificial canal. Source The use of springs, streams and rivers for the elevation of culture and trade is among the subjects that deserve the attention of all governments. -

Daniel Isele
Alter und Herkunft der sublakustrischen Quellen in Taubergießen Daniel Isele Diplomarbeit unter Leitung von Prof. Dr. Markus Weiler Freiburg im Breisgau Januar 2010 „So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Mögliche getan hat.“ Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) Alter und Herkunft der sublakustrischen Quellen in Taubergießen Daniel Isele Erstbetreuer: Dr. Christoph Külls Zweitbetreuer: Prof. Dr. Ralph Watzel Diplomarbeit unter Leitung von Prof. Dr. Markus Weiler Freiburg im Breisgau Januar 2010 Abbildungsverzeichnis i Inhalt Abbildungsverzeichnis iii Tabellenverzeichnis v Notation vi Summary viii Zusammenfassung ix 1 Einleitung 1 1.1 Motivation und Forschungsfrage ............................................................................. 2 1.2 Stand der Forschung................................................................................................. 3 2 Theoretische Grundlagen 7 2.1 Isotope ...................................................................................................................... 7 2.1.1 Delta-Notation .............................................................................................. 7 2.1.2 Fraktionierung .............................................................................................. 8 2.1.3 Natürliche Auswirkungen ............................................................................. 9 2.2 FCKWs und SF6 .................................................................................................... -

Reconstruction of Flood Events Based on Documentary Data And
Hydrol. Earth Syst. Sci., 19, 4149–4164, 2015 www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/4149/2015/ doi:10.5194/hess-19-4149-2015 © Author(s) 2015. CC Attribution 3.0 License. Reconstruction of flood events based on documentary data and transnational flood risk analysis of the Upper Rhine and its French and German tributaries since AD 1480 I. Himmelsbach1, R. Glaser1, J. Schoenbein1, D. Riemann1, and B. Martin2 1Physical Geography, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Freiburg, Germany 2CRESAT, University of Haut-Alsace, Mulhouse, France Correspondence to: J. Schoenbein ([email protected]) Received: 1 December 2014 – Published in Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss.: 7 January 2015 Revised: 11 September 2015 – Accepted: 23 September 2015 – Published: 14 October 2015 Abstract. This paper presents the long-term analysis of flood the small rivers in Alsace compared to those on the Baden occurrence along the southern part of the Upper Rhine River side – an interesting fact – especially if the modern European system and of 14 of its tributaries in France and Germany Flood directive is taken into account. covering the period starting from 1480 BC. Special focus is given on the temporal and spatial variations of flood events and their underlying meteorological causes over time. Ex- 1 Introduction amples are presented of how long-term information about flood events and knowledge about the historical aspect of The knowledge about the occurrence of floods in histori- flood protection in a given area can help to improve the un- cal times, their meteorological causes and their distribution derstanding of risk analysis and therefor transnational risk within the (hydrological) year does provide a deeper under- management. -

Flood Risk Along the Upper Rhine Since AD 1480
Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 12, 177–211, 2015 www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/12/177/2015/ doi:10.5194/hessd-12-177-2015 © Author(s) 2015. CC Attribution 3.0 License. This discussion paper is/has been under review for the journal Hydrology and Earth System Sciences (HESS). Please refer to the corresponding final paper in HESS if available. Flood risk along the upper Rhine since AD 1480 I. Himmelsbach1, R. Glaser1, J. Schoenbein1, D. Riemann1, and B. Martin2 1Physical Geography, Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany 2CRESAT, University of Haut-Alsace, Mulhouse, France Received: 1 December 2014 – Accepted: 9 December 2014 – Published: 7 January 2015 Correspondence to: J. Schoenbein ([email protected]) Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union. 177 Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Abstract This paper presents the occurrence, cause and frequency changes of floods, their development and distribution along the southern part of the upper Rhine River and of 14 of its tributaries in France and Germany covering the period from 1480 BC. Special 5 focus is given on the temporal and spatial variations and underlying meteorological causes which show a significant change over space and time. Examples are presented how long-term information can help to improve transnational risk and risk management analysis while connecting single historical and modern extreme events. 1 Introduction 10 The knowledge about the occurrence of floods in historical times, their meteorologi- cal causes and their distribution within the (hydrological) year does provide a deeper understanding of the natural variability of the severity of flood events by providing long- term knowledge about changes in the causes, frequencies and gravities of the floods. -

The Integrated Rhine Programme Flood Control and Restoration of Former Floodplains Along the Upper Rhine
The Integrated Rhine Programme Flood control and restoration of former floodplains along the Upper Rhine MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, CLIMATE PROTECTION AND THE ENERGY SECTOR CONTENTS Dear Citizens, Preface . 1 Water is a basis of life, a habitat and a natural resource, all in one. However, it also poses inherent risks. Therefore, it is a declared objective of our state government to enhance flood prevention in The risk . 2-3 harmony with the natural environment throughout the entire state of Baden-Württemberg. The River Rhine – a wild river For this purpose, we plan to create a retention capacity of about 273 million m³ between falling prey to human intervention 4-5 the cities of Basel and Worms along the Upper Rhine. The state of Baden-Württemberg The Integrated has pledged to contribute 13 flood retention areas with an overall capacity of 167.3 million Rhine Programme (IRP) . 6-7 m³ towards accomplishing this ambitious, internationally agreed goal. For this reason, the Integrated Rhine Programme (IRP) was established back in 1996. Apart from providing The possibilities and environmentally sustainable flood control, the latter also seeks to protect and restore impact of flood retention floodplains both inside and outside the designated retention areas. on the Upper Rhine . 8 Currently, Baden-Württemberg provides the following retention areas: the cultural weir near The Upper Rhine retention areas Kehl/Strasbourg, the polders in Altenheim, Söllingen/Greffern, Rheinschanzinsel as well as parts down to Mannheim . 9 of Weil-Breisach. This already accounts for approximately 45% of the required retention capacity. Combined with the flood retention measures taken in France and Rhineland-Palatinate, these ca- Flood protection in harmony with nature . -

Flood Risk Along the Upper Rhine Since AD 1480 Table 1
Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 12, 177–211, 2015 www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/12/177/2015/ doi:10.5194/hessd-12-177-2015 HESSD © Author(s) 2015. CC Attribution 3.0 License. 12, 177–211, 2015 This discussion paper is/has been under review for the journal Hydrology and Earth System Flood risk along the Sciences (HESS). Please refer to the corresponding final paper in HESS if available. upper Rhine since AD 1480 Flood risk along the upper Rhine since I. Himmelsbach et al. AD 1480 Title Page I. Himmelsbach1, R. Glaser1, J. Schoenbein1, D. Riemann1, and B. Martin2 Abstract Introduction 1Physical Geography, Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany 2CRESAT, University of Haut-Alsace, Mulhouse, France Conclusions References Received: 1 December 2014 – Accepted: 9 December 2014 – Published: 7 January 2015 Tables Figures Correspondence to: J. Schoenbein ([email protected]) J I Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union. J I Back Close Full Screen / Esc Printer-friendly Version Interactive Discussion 177 Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Abstract HESSD This paper presents the occurrence, cause and frequency changes of floods, their development and distribution along the southern part of the upper Rhine River and of 12, 177–211, 2015 14 of its tributaries in France and Germany covering the period from 1480 BC. Special 5 focus is given on the temporal and spatial variations and underlying meteorological Flood risk along the causes which show a significant change over space and time. -
Literary Museum Badenweiler Chekhov Salon Author's Portraits
english Literary museum Badenweiler Chekhov Salon Author’s portraits and contexts Introduction Publisher and Author of the Texts: Heinz Setzer, Director of the Museum The “Chekhov Salon”, Badenweiler’s Literature Museum, originally opened in 1998 in the Kurhaus, moved to former Translators (listed in alphabetical order and with their corresponding Badenweiler town hall, located in the historical town cen- initials): tre, in 2015. The exhibition was completely refurbished, the Alain Cormont: A. C. Prof. Dr. Helmut Haas: H. H. collection expanded. The museum is accessible from Anton- Elisabeth Hartmann: E. H. Tschechow-Platz (Chekhov Square). In view of the numerous Annika Mysore: A. M. literary links between Badenweiler and the rest of the world, Prof. Dr. Dorothea Scholl: D. S. especially with Russia, France and the USA, it was consid- Prof. Dr. Olga A. Sergeyeva: O. A. S. Anna Gräfin von Sponeck: A. v. S. ered essential to provide information about the exhibition in Valeriya Vasilyeva: V. V. each of the respective languages. New brochures with texts Dr. Jana Wenzel: J. W. in German, Russian, English and French were published in Editors: Barbara Hahn-Setzer, Sabine Hochbruck, Prof. Dr. Wolfgang December 2019, with information on 28 authors on dis- Hochbruck, Dr. Regine Nohejl, Heinz Setzer as well as the translators play in the museum, detailing their literary significance, and Special thanks to Prof. Dr. Helmut Haas, Sabine Hochbruck, Prof. Dr. their connection with Badenweiler. The authors are listed in Wolfgang Hochbruck and Andreas Pahl for many night sessions for corrections and layout-arrangements. alphabetical order. Articles about the Anton Chekhov and Nominal Fee per booklet: 3.00 € Stephen Crane memorials are listed separately. -

Flood Reconstruction and Transnational Flood Risk
Flood reconstruction and transnational flood risk alonganalysis of the upper Rhine and Formatvorlagendefinition: Standard: Englisch (USA), Keine its French and German tributaries since AD 1480 Absatzkontrolle Formatvorlagendefinition: I. Himmelsbach1, R. Glaser1, J. Schoenbein1, D. Riemann1, B. Martin2 Sprechblasentext: Englisch (USA), Keine Absatzkontrolle 1 Physical Geography, Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany Formatvorlagendefinition: Kommentartext: Englisch (USA), Keine 2 CRESAT, University of Haut-Alsace Mulhouse, France Absatzkontrolle Formatvorlagendefinition: Correspondence to: J. Schoenbein ([email protected] Kommentarthema: Englisch (USA), freiburg.de)([email protected]) Keine Absatzkontrolle Formatvorlagendefinition: Listenabsatz: Englisch (USA), Keine Absatzkontrolle Formatvorlagendefinition: Kopfzeile: Englisch (USA), Keine Absatzkontrolle Formatvorlagendefinition: Fußzeile: Englisch (USA), Keine Absatzkontrolle Formatiert: Links, Einzug: Links: 0,21 cm, Rechts: -0,04 cm, Abstand Vor: 2,95 Pt., Zeilennummern unterdrücken Formatiert: Schriftart: Nicht Fett Formatiert: Deutsch (Deutschland) Formatiert: Schriftart: 7 Pt., Deutsch (Deutschland), Nicht Hochgestellt/ Tiefgestellt Formatiert: Deutsch (Deutschland) Formatiert: Schriftart: 7 Pt., Deutsch (Deutschland), Nicht Hochgestellt/ Tiefgestellt Formatiert: Deutsch (Deutschland) Formatiert: Schriftart: 7 Pt., Deutsch (Deutschland), Nicht Hochgestellt/ Tiefgestellt Formatiert: Schriftart: 7 Pt., Nicht Fett, Deutsch (Deutschland) -

BADISCHE HEIMAT Mein Heimatland 50
BADISCHE HEIMAT Mein Heimatland 50. Jahrg. 1970, Heft 4 Johann Gottfried Tulla Ein Lebensbild Von Hans G eorg Zier, Karlsruhe Der Züricher Professor für Hydraulik, der Universität (Technische Hochschule) Wasserbau und Grundbau Gerold Schmitter Karlsruhe anläßlich der 200jährigen Wieder erwähnt in seiner Abschiedsvorlesung vom kehr von Tullas Geburt in Karlsruhe ver 18. Februar 1970 „Der Wasserbau: gestern, anstalteten Symposiums, an anderer Stelle2) heute, morgen“ als große flußbauliche Auf aus der Feder von Karl Knäble, der durch gaben in Europa vier Unternehmen: Die Jahre hindurch Präsident der Wasser- und Korrektion der Linth und deren Einleitung Schiffahrtsdirektion Freiburg und damit in den Walensee (1808—1822), die Korrek in gewisser Hinsicht Nachfolger Tullas war. tion des Oberrheins (1817—1874) sowie die Nur in gewisser Hinsicht ist der Präsident 1. und 2. Juragewässerkorrektion (die erste der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Amts 1878 beendet, die zweite zur Zeit ihrem nachfolger Tullas, denn viele Gebiete, die Ende entgegengehend)1). Linthkorrektion Tulla allein bearbeitete, sind heute eigenen und Rheinkorrektion sind einem Mann zu Fachbehörden übertragen, man denke neben verdanken: Johann Gottfried Tulla, ge dem Straßenbau nur an die Vermessung, boren in Karlsruhe am 20. März 1770, an die Wetterbeobachtung und an das gestorben in Paris am 27. März 1828. technische Unterrichts wesen. Wenn man derartige Überlegungen anstellt, wird so Tullas Werk fort klar, wie umfänglich das Werk Tullas Tulla wird in erster Linie als der Schöpfer war und welche Schwierigkeiten er, der als der Korrektion des Oberrheins angesehen, einer der ersten die Vorarbeiten leistete, zu weithin unbekannt ist aber, daß er sich überwinden hatte. Gleichzeitig wird deut auch große Verdienste auf den Gebieten lich, wie umfangreich die Gebiete des täg des Straßen- und Brückenbaues erwarb. -

Historischer Atlas 4, 18-19 Von Baden-Württemberg
HISTORISCHER ATLAS 4, 18-19 VON BADEN-WÜRTTEMBERG Erläuterungen Beiwort zu den Karten 4,18-19 Die Veränderung der Kulturlandschaft durch die Rheinkorrektion seit 1817 von EUGEN REINHARD I. Der Oberrhein und seine Korrektion wird deutlich an seinem ersten Teilstück, am Alpen- rhein, der sich von seinem Ursprung bis zum Boden- Einleitend zu seinem Gutachten über die Rektifika- see erstreckt. Die beiden Quellarme, der aus dem To- tion des Oberrheins aus dem Jahr 18251 bemerkt Jo- masee östlich des St. Gotthards ausfließende Vorder- hann Gottfried Tulla treffend, daß der Rhein einer der rhein und der östlich des Rheinwaldhorns entspringen- merkwürdigsten Ströme in Europa sei. Diese Fest- de Hinterrhein sind die beiden Oberläufe des Alpen- stellung gilt nicht nur für den Flußbauingenieur des 19. rheins. Ein starkes Gefälle und zahlreiche Talstufen, Jahrhunderts, dessen Aufgabe es war, die im Jahreslauf die mit großen Gefällsknicken überwunden werden, sehr unterschiedlichen Wassermassen dieses Stromes sind für sie bezeichnend. Nach ihrer Vereinigung bei mit alpinem Abflußcharakter in einem einzigen, Reichenau im Kanton Graubünden klingt die Ero- großen Flußbett zu bändigen. Der Rheinstrom ist in sionskraft des Flusses ab und unterhalb von Sargans jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Wasserlauf. besitzt er in einem breiten, nordwärts gerichteten Auf- Nicht nur, daß er mit einer Gesamtlänge von 1320 km schüttungstal, das er mit seinen Geröllmassen zuge- und mit einem Einzugsgebiet von 224 400 qkm das schottert hat, dann alle Eigenschaften eines Unterlaufs. größte Flußsystem Mitteleuropas darstellt. Durch die Bei Rheineck mündet der Alpenrhein mit einem sich zahlreichen unterschiedlichen Landschaften, die der jährlich um 23 m vorschiebenden Delta in den Boden- Fluß auf seinem Weg aus den schweizerischen Zen- see. -

SWISS RIVER TRAINING in the 18Th and 19Th CENTURIES PUBLICATION NO. 14 of the HYDROLOGY CENTRE, CHRISTCHURCH
HYDRAULICS BRANCH OFFICIAL FILE COPY No. 84 Report WHEN BORROWED RETURN PROMPTLY of the Research Institute forHydraulics Hydrologyand Glaciology at the Zurich Federal Institute of Technology Edited by Professor Dr. D. Vischer SWISS RIVERTRAINING IN THE 18th AND 19th CENTURIES Daniel Vischer CX) -:j"' Ln I 0.. c::C c.. Zurich, 1986 AUTHORISED ENGLISH EDITION PUBLICATION NO. 14 OF THE HYDROLOGY CENTRE, CHRISTCHURCH Christchurch, New Zealand /v-11'0 �· (Y/� for �71'! JJ�·,t// ii,'fvh�V No. 84 Report of the Research Institute forHydraulics Hydrologyand Glaciology at the Zurich Federal Institute of Technology Edited by Professor Dr. D. Vischer SWISS RIVERTRAINING IN THE 18th AND 19th CENTURIES Daniel Vischer Zurich, 1986 AUTHORISED ENGLISH EDITION PUBLICATION NO. 14 OF THE HYDROLOGY CENTRE, CHRISTCHURCH /11! 3 ) Christchurch, New Zealand No. 84 Report of the Research Institute for Hydraulics, Hydrologyand Glaciology at the Zurich Federal Institute of Technology Edited by Professor Dr. D. Vischer SWISS RIVER TRAINING IN THE 18th AND 19th CENTURIES Daniel Vischer Zurich, 1986 Authorised English Edition Publication No. 14 of the Hydrology Centre Christchurch, 1988, ISSN 0112-1197 Possible reasons forriver training projects on the Swiss plateau are discussed. The training of the River Kander (1711 - 1714) is presented as the starting point of some 40 works in the 19th Century. Two examples, the Linth and the Jura, are described in detail. National Library of New Zealand Cataloguing-in-Publication data VISCHER, D. (Daniel) ( Schweizerische fluss korrektionen im 18 und 19 jahrhundert. English] Swiss river training in the 18th and 19th centuries Daniel Visher. - Authorised English ed. - Christchurch, N.Z.