Dokumentvorlage Für Wissenschaftliche Arbeiten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Youtube Stars
UNTERRICHT MATERIALPAKET KOMPETENZEN Arbeitsblätter zum Artikel im Materialheft und als 9 / 10 Materialeinheit 4 zum Download via Benutzerkonto PA 20’ In das Thema einsteigen Swap-it cards (4.1) Sprechen: Ein Gespräch oder eine Buzz groups (4.2) Diskussion beginnen, fortführen und KLASSE EA / PA 25’ YouTube-Videos analysieren YouTube stars and what they aufrechterhalten talk about (4.3) drei Filmausschnitte von YouTube stars Sehen / Hören / Sprechen: Den Inhalt min einfacher und kurzer Filmsequenzen 45 gA 20’ Ein YouTube-Video promoten Our YouTube video (4.4) x zusammenfassen und nacherzählen 2 Pl 15’ Die Ergebnisse präsentieren Giving feedback (4.5) Sprechen: Eine Präsentation zu einem ZEIT Pl 10’ Über die beste Idee abstimmen vertrauten Thema vortragen MARTIN BASTKOWSKI YouTube stars Für einen Schulwettbewerb YouTube-Videos analysieren und ein eigenes Video promoten Das Interview mit Angela Merkel hat den YouTube Star LeFloid (links im Bild) einem breiteren und älteren Publikum bekannt gemacht, seine größten Fans sind aber immer noch Jugendliche Ganz klar – mit Millionen von Klicks und zunehmend eine riesige Fangemeinde produzierten und geschnittenen Clips Abonnements sind YouTuber die neuen aufbauen, so z. B. Dner, Dagi Bee und von Modetipps, Comedy und pointierter Superstars der Jugendlichen. Wo sonst Y-Titty (ZUR SACHE). Darstellung von Weltnachrichten über kann man mit seinen Idolen direkt in Kon- Vor allem sind es wohl ihre Authenti- persönliche Tagesabläufe, Reiseberichte takt treten und fast täglich neue Informa- zität und Realitätsnähe, die dazu führen, und Produkttests bis hin zum Spielen und tionen erhalten? Es sind Menschen wie dass YouTuber millionenfach gesehen und Kommentieren von Computerspielen, den du und ich, die mit ihren YouTube-Clips gehört werden. -

Jugendliche Als Zielgruppe Von Influencer Marketing – Eine Studie Zur Wahrnehmung Von Werbeinhalten Auf Instagram
Jugendliche als Zielgruppe von Influencer Marketing – Eine Studie zur Wahrnehmung von Werbeinhalten auf Instagram Hausarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts in Erziehungswissenschaft vorgelegt dem Fachbereich 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz von Natalia Lipski aus Kirchheimbolanden Mainz 2018 Erstgutachter: Herr Prof. Dr. Stefan Aufenanger Zweitgutachterin: Dr. Petra Bauer Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................... II 1. Einleitung ................................................................................................................... 1 2. Influencer Marketing .................................................................................................. 3 3. Instagram................................................................................................................... 6 3.1 Funktionalitäten .................................................................................................. 7 3.1 Instagram als Werbeplattform ........................................................................... 8 4. Rechtliche Kennzeichnung von Werbeinhalten ...................................................... 10 5. Die mediale Jugend ................................................................................................ 12 5.1 Jugendliche als Zielgruppe .............................................................................. 12 5.2 -

Social Media Sellout - the Increasing Role of Product Promotion on Youtube
Social Media Sellout - The Increasing Role of Product Promotion on YouTube Accepted for publication at Social Media and Society, May 2018 Carsten Schwemmer1 and Sandra Ziewiecki2 Abstract Since its foundation in 2005, YouTube, which is considered to be the largest video-sharing site, has undergone substantial changes. Over the last decade, the platform developed into a leading marketing tool used for product promotion by social media influencers. Past research indicates that these influencers are regarded as opinion leaders and cooperate with brands to market products on YouTube through electronic-word-of-mouth mechanisms. However, surprisingly little is known about the magnitude of this phenomenon. In our paper, we make a first attempt to quantify product promotion and use an original dataset of 139,475 videos created by German YouTube channels between 2009 and 2017. Applying methods for automated content analysis, we find that YouTube users indeed are confronted with an ever-growing share of product promotion, particularly in the beauty and fashion sector. Our findings fuel concerns regarding the social and economic impact of influencers, especially on younger target groups. Keywords YouTube, Social Media, Product Promotion, Influencer Marketing, Topic Modeling 1University of Bamberg 2University of Bayreuth Corresponding author: Carsten Schwemmer, University of Bamberg, Chair of Political Sociology, Feldkirchenstr. 21, 96052 Bamberg Email: [email protected] Introduction In 2016, an autograph session attended by several thousand people in Germany had to be canceled as teenagers were crying and fainting due to the presence of a celebrity (dpa, 2016). While this phenomenon is not uncommon for times were boy bands fascinated millions of young females in the 1990s (Scheel, 2014), the celebrity was no music or movie star, but the YouTuber Bianca Heinicke. -

Influential Media Partners How Media Firms Can Incentivise Professional Social Media
Influential media partners How media firms can incentivise professional social media influencers to generate value for them Student Name: Thomas Stoffer Student Number: 453541 Supervisor: Matthijs Leendertse Master Media & Business Erasmus School of History, Culture and Communication Erasmus University Rotterdam Master’s Thesis June 21, 2018 ABSTRACT During recent years, a more interactive internet caused for a digital equivalent of opinion leaders to emerge: influencers. Influencers are understood to have the ability to influence a particular group of people through social media or blogs. They are different from the more traditional concept of celebrities where influencers could also be everyday people, who use the internet to reach their accumulated following through the visual and textual narration of their personal lives and lifestyles. Simultaneously along the rise of the concept of influencers, businesses also developed interest to work with them because they are considered to be the main channel of electronic word-of-mouth marketing. Existing literature on influencers primarily had an exploratory focus on including them in marketing and advertising strategies, with no attention to the principles of co-creation. Additionally, academic co-creation literature primarily resolved around firms working with consumers or other stakeholders. At the crossroads of these two gaps in the current literature, this study aimed to determine how media firms could incentivise professional social media influencers in order for them to generate value. Hence, this study carried out a qualitative research whereby twelve semi-structured expert interviews were conducted. The results derived from thematically analysing the interviews shows that companies need to incentivise influencers on the partnership creation level and on the implementation level. -
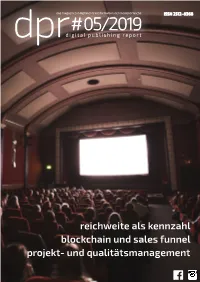
Digital Publishing Report 05/2019
das magazin zur digitalen transformation der medienbranche # 05/2019 dprdigital publishing report reichweite als kennzahl blockchain und sales funnel projekt- und qualitätsmanagement ein paar worte zum geleit Onlinemarketing ist und bleibt ein Schwerpunkt ist. Sebastian Förtsch diskutiert die möglichen in den Magazinen und Webinaren des dpr. Kürz- Auswirkungen der Blockchain für den Alltag lich haben wir im Rahmen eines Webinars nach der Menschen. Und Oliver Luser wirbt für die den bevorzugten KPIs (Key Performance Indica- Verquickung von Projekt- und Qualitätsma- tors, also Kennzahlen) gefragt, nach denen sich nagement. die Verlage in ihrem Marketing richten. Ganz An dieser Stelle sei nochmal an eine besondere oben auf der Liste stand freilich die Reichweite: Veranstaltung des digital publishing report auf Je größer die Reichweite von Mailings oder Fa- der Leipziger Buchmesse erinnert: Am Donners- cebook-Posts, desto besser, lautet die gängige tag, 21. März, 17 Uhr (Halle 5, Fachforum 1, E600) Devise. beginnt die Verleihung des erstmals ausge- In dieser Ausgabe des digital publishing report lobten digital publishing award. Wir sind nach zieht Gero Pflüger diesen Reich- wie vor begeistert angesichts der weiten-Zahn. Seine Argumentati- Quantität, aber auch Qualität der on: Reichweite sei eine Kennzahl Einreichungen. Und sind sicher, für Massenmedien. Doch die gebe dass die Jury eine würdige Aus- es gar mehr, weil sich die Nach- wahl der Preisträger vorgenom- frage geändert habe – und damit men hat. das Angebot. Und soziale Medien Apropos Interaktion: Seit dem seien kein Massenmedium, auch Start der dpr-Webinare vor über wenn massenhaft Menschen eine einem Jahr haben wir über 1.500 Plattform nutzten. „Im Gegenteil Teilnehmer verzeichnet. -

Bachelorarbeit+! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BACHELORARBEIT+! ! ! ! ! ! ! ! ! Frau! ! ! Katharina+Elisabeth+Heindl+ + + Mobile+Social+Media+Marketing+ –+eine+Übersicht+von+WerkB zeugen+und+Möglichkeiten+am+ Beispiel+von+Edeka+++ + + 2017! ! ! ! ! ! ! ! ! Fakultät:!Medien! ! BACHELORARBEIT!+ ! ! ! !+ ! ! + + + Mobile+Social+Media+Marketing+ –+ein+Überblick+von+WerkzeuB gen+und+Möglichkeiten+am+ Beispiel+von+EDEKA+ + ! Autorin:! Frau+Katharina+Elisabeth+Heindl++ ! ! ! Studiengang:! Business+Management+ ! ! Seminargruppe:! BM14wM6BB+ ! ! Erstprüfer:! Prof.+Dr.+Sebastian+Scharf! ! Zweitprüfer:! M.A.+Thorsten+Eble+ ! ! ! ! ! Einreichung:! München,!25.07.2017! ! ! ! ! ! ! ! Faculty!of!Media! ! BACHELOR+THESIS+! ! ! ! +! ! ! + + + Mobile+Social+Media+Marketing+ –+an+overview+of+tools+and+ possibilities+using+the+example+ of+EDEKA+++ + ! author:! Mr./Ms.+Katharina+Elisabeth+Heindl+ ! ! course!of!studies:! Business+Management+ ! ! seminar!group:! BM14wM6BB+ !! ! first!examiner:! Prof.+Dr.+Sebastian+Scharf+ ! ! second!examiner:! M.A.+Thorsten+Eble+ ! ! ! submission:! Munich,!25.07.2017! ! Bibliografische+Angaben+ Heindl,!Katharina!Elisabeth!! Mobile!Social!Media!Marketing! Mobile!social!media!marketing! 52!Seiten,!Hochschule!Mittweida,!University!of!Applied!Sciences,!! Fakultät!Medien,!Bachelorarbeit,!2017! ! ! ! ! ! ! ! Abstract+ Die!vorliegende!Arbeit!beschäftigt!sich!mit!Social!Media!Marketing!und!insbesondere!Mobile! Social!Media!Marketing!(MSMM)!und!seinem!Potenzial!für!Unternehmen.!Es!zeigt!sich,!dass! die!große!Stärke!von!MSMM!in!seiner!Fähigkeit!zur!Personalisierung!von!MarketingbotschafS -

Youtube Als Sozialisationsinstanz Für Kinder
YouTube als Sozialisationsinstanz für Kinder Qualitative Untersuchung an einer Magdeburger Grundschule BACHELORARBEIT von Moritz Daniel Kehr Bachelorarbeit YouTube als Sozialisationsinstanz für Kinder Qualitative Untersuchung an einer Magdeburger Grundschule Für die Prüfung zum Bachelor of Arts im Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Fachbereich Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien von Moritz Daniel Kehr vorgelegt am 10.07.2017, Magdeburg Erstgutachterin: Prof. Dr. Manuela Schwartz Zweitgutachter: Prof. Dr. Lutz Rothermel Matrikelnummer: 20142743 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ........................................................................................................ 3 2. Medienpädagogische Ansätze zur Interaktion von Mensch und Medien ......... 6 2.1. Mediatisierung der Lebenswelten .............................................................. 6 2.1.1. Digitale Medien ................................................................................... 7 2.1.2. Das Web 2.0 ....................................................................................... 8 2.1.3. Das Social Web ................................................................................ 11 2.1.4. Social Network Sites ......................................................................... 13 2.2. Medien und soziale Entwicklung ............................................................. 16 2.2.1. Mediensozialisation .......................................................................... 17 2.2.2. Digital Natives -

Product-Placement Auf Youtube Auswirkungen Auf Das Kaufverhalten Von Jugendlichen
Fakultät Medien und Informationswesen Product-Placement auf YouTube Auswirkungen auf das Kaufverhalten von Jugendlichen Masterthesis von Sabrina Leitner (muk177977) Studiengang: Medien und Kommunikation Semester: 4 Email-Adresse: [email protected] Betreuer: Prof. Dr. Thomas Breyer-Mayländer Prof. Dr. Christopher Zerres Bearbeitungszeitraum/Abgabe: Wintersemester 2015/16, 29.02.2016 Eidesstattliche Erklärung Eidesstattliche Erklärung Hiermit versichere ich eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema Product-Placement auf YouTube Auswirkungen auf das Kaufverhalten von Jugendlichen von mir selbstständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt worden ist, insbe- sondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich oder dem Gedanken nach aus Veröffentlichungen, unveröffentlichten Unterlagen und Gesprächen entnommen worden sind, als solche an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit durch Zitate kenntlich gemacht habe, wobei in den Zitaten jeweils der Umfang der entnommenen Originalzitate kenntlich gemacht wurde. Die Arbeit lag in gleicher oder ähnlicher Fassung noch keiner Prüfungsbehörde vor und wurde bisher nicht veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Versicherung rechtliche Folgen haben wird. Aus Gründen der leichten Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. In der vorliegenden Arbeit wird daher durchgehend die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes für beide Geschlechter. Ort, Datum -

Influencer Marketing – the Power of Self
Influencer Marketing – The power of self An explorative study about personal branding of beauty micro-influencers. Student Name: Vanessa Sieg Student Number: 485968 Supervisor: Dr. Vidhi Chaudhri Master Media Studies – Media and Business Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Erasmus University Rotterdam 25.06.2018 Acknowledgements The process of writing this thesis has been mostly an intense, yet overall enjoyable experience of delving deep into the still emerging environment of micro-influencers. While preparing this study was a matter of urgency for me over the last six months, I dare to say that selecting a topic that I am deeply concerned and passionate about was most important in order handle the tremendous amount of work. In this respect, many thanks go to Vidhi Chaudhri, my supervisor, who has invested a lot of patience, provided invaluable guidance while emphasized creativity all along. Without your support, I could not have done this. Furthermore, I appreciated the interest and willingness from contact persons who helped me out with recommendations when I needed them the most to assemble an appropriate number of participants. It was my pleasure to talk to 20 impressive micro-influencers who granted me a behind the scence look without restrictions – thank you very much for your openness and honesty. Special thanks go to my boyfriend, who has been one of my biggest critics but also one of my biggest supporters. I am very lucky that I could count on your counsel and experience. Last but not least, many thanks go to my Mum who gave me calm and my best friends who strengthened my confidence, as always. -

Digitale Markenführung
® Facebook Instagram YouTube WhatsApp CRM Support Homepage Digitale Transformation des Marketing Heft 01 / 2018 AfM ISSN 2509-3029 Arbeitsgemeinschaft für Marketing AfM PraxisWISSEN Marketing Arbeitsgemeinschaft für Marketing x (20xx) x eingereicht am: 11.12.2017 überarbeitete Version: 06.02.2018 Digitale Markenführung Ralf T. Kreutzer Das digitale Zeitalter bringt für die Markenführung neue Herausforderungen mit sich. Zum einen wollen die Kunden immer stärker an der Markenführung selbst mitwirken und äußern sich entsprechend in den sozialen Medien. Zum anderen stehen den Unternehmen viele weitere Gestaltungsfelder für die Markenführung zur Verfügung, die im Hinblick auf ihre Eignung für die eigene Marke zu prüfen sind. In diesem Spannungsfeld ist die digitale Markenführung auszugestalten. In diesem Beitrag geht es primär darum, das Augenmerk auf die Aspekte der Markenführung zu lenken, die in klassischen Werken zur Markenführung bisher deutlich vernachlässigt werden. Diese Aspekte sollen damit als Denkanstoß dienen, um die bestehenden Konzepte zur Markenführung an die Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen, um zu der Notwendigkeit einer holistischen Markenführung zu entsprechen. The digital age brings new challenges to brand management. On the one hand, customers want to become increasingly involved in brand management and express themselves accordingly in social media. On the other hand, companies have many other areas for brand management at their disposal, which must be examined with regard to their suitability for their own brand. In this field of tension, digital brand management has to be designed. The main purpose of this article is to focus attention on the aspects of brand management that have so far been neglected in classic branding works. -
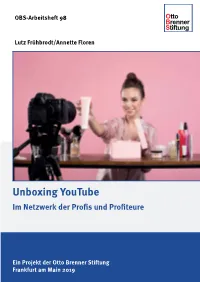
Unboxing Youtube Im Netzwerk Der Profis Und Profiteure
OBS-Arbeitsheft 98 Lutz Frühbrodt/Annette Floren Unboxing YouTube Im Netzwerk der Profis und Profiteure Ein Projekt der Otto Brenner Stiftung Frankfurt am Main 2019 OBS-Arbeitsheft 98 ISSN-Print: 1863-6934 ISSN-Online: 2365-2314 Herausgeber: Otto Brenner Stiftung Jupp Legrand Wilhelm-Leuschner-Straße 79 D-60329 Frankfurt am Main Tel.: 069-6693-2810 Fax: 069-6693-2786 E-Mail: [email protected] www.otto-brenner-stiftung.de Autor: Prof. Dr. Lutz Frühbrodt Hochschule Würzburg-Schweinfurt Münzstraße 19 D-97070 Würzburg Tel.: 0931-3511-8294 E-Mail: [email protected] Co-Autorin: Annette Floren Kommunikationsberaterin Redaktion: Hinweis zu den Nutzungsbedingungen: Benedikt Linden (OBS) Dieses Arbeitsheft darf nur für nichtkommerzielle Zwecke im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Beratung und Satz und Gestaltung: ausschließlich in der von der Otto Brenner Stiftung veröffent- think and act – lichten Fassung – vollständig und unverändert – von Dritten Agentur für strategische Kommunikation weitergegeben sowie öffentlich zugänglich gemacht werden. Titelbild: In den Arbeitsheften werden die Ergebnisse der Forschungs- YakobchukOlena/stock.adobe.com förderung der Otto Brenner Stiftung dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Für die Inhalte sind die Druck: Autorinnen und Autoren verantwortlich. mww.druck und so ... GmbH, Mainz-Kastel Bestellungen: Redaktionsschluss: Über die Internetseite der Otto Brenner Stiftung können 24.02.2019 weitere Exemplare dieses OBS-Arbeitsheftes kostenlos be- zogen werden – solange der Vorrat reicht. Es besteht dort Wir danken der Hans-Böckler-Stiftung aber auch die Möglichkeit, sowohl aktuelle als auch bereits für die Unterstützung bei der Veröffentlichung vergriffene OBS-Arbeitshefte kostenlos herunterzuladen. der Publikation. Mehr Infos: www.otto-brenner-stiftung.de Vorwort Vorwort In einem Interview mit Spiegel Online wurde die erfolgreiche YouTuberin „Dagi Bee“ einmal gefragt, ob sie überhaupt noch ungestört durch die Düsseldorfer Fußgänger zone spazieren könne. -

Kommunikation Über Influencer in Den Sozialen Medien Heft M 302
Zielgruppengerechte Ansprache in der Verkehrssicherheits- kommunikation über Influencer in den sozialen Medien Heft M 302 Berichte der Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Bundesanstalt für Straßenwesen Mensch und Sicherheit Heft M 302 ISSN 0943-9315 ISBN 978-3-95606-541-5 Zielgruppengerechte Ansprache in der Verkehrssicherheits- kommunikation über Influencer in den sozialen Medien Forschungsstand und Handlungsempfehlungen von Amelie Duckwitz Walter Funk Catherine Schliebs unter Mitarbeit von Christopher Hermanns Institut für Informationswissenschaft Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften Technische Hochschule Köln Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Mensch und Sicherheit Heft M 302 Die Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlicht ihre Arbeits- und Forschungs- ergebnisse in der Schriftenreihe Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die Reihe besteht aus folgenden Unterreihen: A - Allgemeines B - Brücken- und Ingenieurbau F - Fahrzeugtechnik M - Mensch und Sicherheit S - Straßenbau V - Verkehrstechnik Es wird darauf hingewiesen, dass die unter dem Namen der Verfasser veröffentlichten Berichte nicht in jedem Fall die Ansicht des Herausgebers wiedergeben. Nachdruck und photomechanische Wieder- gabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmi- gung der Bundesanstalt für Straßenwesen, Stabsstelle Presse und Kommunikation. Die Hefte der Schriftenreihe Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen können direkt bei der Carl Ed. Schünemann KG, Zweite Schlachtpforte 7, D-28195 Bremen, Telefon: (04 21) 3 69 03 -