Book of Abstracts
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Christians and Jews in Muslim Societies
Arabic and its Alternatives Christians and Jews in Muslim Societies Editorial Board Phillip Ackerman-Lieberman (Vanderbilt University, Nashville, USA) Bernard Heyberger (EHESS, Paris, France) VOLUME 5 The titles published in this series are listed at brill.com/cjms Arabic and its Alternatives Religious Minorities and Their Languages in the Emerging Nation States of the Middle East (1920–1950) Edited by Heleen Murre-van den Berg Karène Sanchez Summerer Tijmen C. Baarda LEIDEN | BOSTON Cover illustration: Assyrian School of Mosul, 1920s–1930s; courtesy Dr. Robin Beth Shamuel, Iraq. This is an open access title distributed under the terms of the CC BY-NC 4.0 license, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Further information and the complete license text can be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ The terms of the CC license apply only to the original material. The use of material from other sources (indicated by a reference) such as diagrams, illustrations, photos and text samples may require further permission from the respective copyright holder. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Murre-van den Berg, H. L. (Hendrika Lena), 1964– illustrator. | Sanchez-Summerer, Karene, editor. | Baarda, Tijmen C., editor. Title: Arabic and its alternatives : religious minorities and their languages in the emerging nation states of the Middle East (1920–1950) / edited by Heleen Murre-van den Berg, Karène Sanchez, Tijmen C. Baarda. Description: Leiden ; Boston : Brill, 2020. | Series: Christians and Jews in Muslim societies, 2212–5523 ; vol. -

Islam in Process—Historical and Civilizational Perspectives Yearbook of the Sociology of Islam Volume 7
Islam in Process—Historical and Civilizational Perspectives Yearbook of the Sociology of Islam Volume 7 2006-12-06 16-23-03 --- Projekt: T491.gli.arnason.yearbook7 / Dokument: FAX ID 00fb133402603594|(S. 1 ) T00_01 Schmutztitel.p 133402603618 Yearbook of the Sociology of Islam Edited by Georg Stauth and Armando Salvatore The Yearbook of the Sociology of Islam investigates the making of Islam into an important component of modern society and cultural globalization. Sociology is, by common consent, the most ambitious advocate of modern society. In other words, it undertakes to develop an understanding of modern existence in terms of breakthroughs from ancient cosmological cultures to ordered and plural civic life based on the gradual subsiding of communal life. Thus, within this undertaking, the sociological project of modernity figures as the cultural machine that dislodges the rationale of social being from local, communal, hierarchic contexts into the logic of individualism and social differentiation. The conventional wisdom of sociology has been challenged by post-modern debate, abolishing this dichotomous evolutionism while embracing a more heterogeneous view of coexistence and exchange between local cultures and modern institutions. Islam, however, is often described as a different cultural machine for the holistic reproduction of pre-modern religion, and Muslims are seen as community-bound social actors embodying a powerful potential for the rejec- tion of and opposition to Western modernity. Sociologists insist on looking for social differentiation and cultural differ- ences. However, their concepts remain evolutionist and inherently tied to the cultural machine of modernity. The Yearbook of the Sociology of Islam takes these antinomies and contradic- tions as a challenge. -

JO-ANN GROSS the College of New Jersey Department of History 609-771-2213
JO-ANN GROSS The College of New Jersey Department of History 609-771-2213 ACADEMIC APPOINTMENTS The College of New Jersey Professor of Middle Eastern and Central Eurasian History, History Department, 2002- present; Associate Professor, 1994-2002; Assistant Professor, 1988-1994 Chair, History Department, The College of New Jersey, 2004-2007 University of Pennsylvania Affiliated Faculty Member, 2013- South Asia Center Columbia University Research Associate and Adjunct Faculty Member, Middle East Institute, 1985-88 EDUCATION New York University Near Eastern Languages and Literature, Ph.D. June 1982 (with distinction) Dissertation Committee: Robert McChesney (Chair), Peter Chelkowski, Dale Eickelman Research fields: Social history of Sufism and hagiographic traditions, anthropology and history of the Middle East, post-Mongol history of Iran and Central Asia New York University Near Eastern Languages and Literature, M.A., June 1978 Rutgers University Major: Art, B.A., 1971 AWARDS AND HONORS Elected as honorary foreign member of the Academy of Science of 2012 the Republic of Tajikistan Director, Goelet Foundation Grant, Middle East and Central Eurasia Study 2012-13 Abroad Fellowship and Lecture Program, The College of New Jersey Department of Education Undergraduate International Studies and Foreign 2008-10 Language Programs Title VI Grant (UISFL), “Iran and Beyond: Strengthening the International Studies and Foreign Language Curriculum in Middle Eastern and Central Eurasian Studies (Principle Investigator) International Research and Exchanges -

Around 12,000 Citizens Over Age of 100 Live in Iran Away
Art & Culture AUGUST 26, 2014 3 This Day in History Around 12,000 Citizens (August 26) This Day in History (August 26) Today is Tuesday; 4th of the Iranian month of Shahrivar 1393 solar hijri; corresponding to 26th of the Islamic month of Shawwal 1435 lunar hijri; and August 26, 2014, of the Christian Gregorian Calendar. Over Age of 100 1509 lunar years ago,on this day, 72 years before hijra (corresponding to 549 AD), Imran IbnShayba (Abdul-Muttaleb), known as Abu Taleb, the beloved uncle and guardian of Prophet Mohammad (SAWA) was born in Mecca. He was the consanguineous brother of Abdullah, the father of the Prophet, and had taken charge of his 8-year orphaned nephew on the death of his own father, Abdul-Muttaleb. He became head of the noble BaniHashem clan following the death of his elder brother, ZubayrIbn Abdul-Muttaleb. He subsequently became known Live in Iran as “Shaikh al-Bat-ha” (Senior-Most Chief of Mecca). As follower of the monotheistic creed TEHRAN (CHN) - The head of respectively. of his ancestor, Prophet Abraham, he firmly believed in the message of Islam when God formally appointed his 40-year old nephew as the Last and Greatest Messenger to mankind. secretariat of the National Coun- However, Sistan and Balu- He thereafter protected the Prophet against the taunts and plots of the pagan Arabs. When the cil for the Elderly said that 11,722 chestan Province holds the Meccans imposed the social-economic boycott on the Prophet, he took his nephew and the whole neo-Muslim community under his protection to the safety of the gorge outside Mecca senior citizens over the age of 100 least number of senior citizens which is still called “She’bAbiTaleb”. -

Persian As Koine: Written Persian in World-Historical Perspective
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Department of Anthropology Papers Department of Anthropology 2012 Persian as Koine: Written Persian in World-Historical Perspective Brian Spooner University of Pennsylvania, [email protected] William L. Hanaway University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/anthro_papers Part of the Anthropology Commons, Near Eastern Languages and Societies Commons, and the Reading and Language Commons Recommended Citation (OVERRIDE) Spooner, B. and Hanaway, W. (2012). Persian as Koine: Written Persian in the perspective of World History. In B. Spooner and W. Hanaway (Eds.), Literacy in the Persianate World: Writing and the Social Order (pp. 1-68). Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/anthro_papers/86 For more information, please contact [email protected]. Persian as Koine: Written Persian in World-Historical Perspective Abstract Persian emerged as the common language of court life and administration in the Islamic world east of Baghdad in the 8th and 9th centuries (2nd and 3rd centuries into the Islamic era). The process began in Khurasan, the large historical region of southwest-central Asia, which besides the northeast quadrant of modern Iran included most of modern Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan, and northern Afghanistan. Persian radiated out from the pre-Islamic cities that became new power centers, filling the vacuum left by the declining political (as distinct from symbolic) role of the Caliphate in Baghdad. Persian spread to its greatest extent five centuries later, under Mongol and Turkic administrations, when it stretched from the Balkans in the west to southern India in the south and along the trade routes into central China in the east. -

2015 Williams Richard 113649
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Hindustani music between Awadh and Bengal, c.1758-1905 Williams, Richard David Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 09. Oct. 2021 Hindustani music between Awadh and Bengal, c.1758-1905 RICHARD DAVID WILLIAMS Submitted in FulFilment of the requirements For the degree of Doctor oF Philosophy KING’S COLLEGE LONDON DECEMBER 2014 ABSTRACT This thesis explores the interaction between Hindustani and Bengali musicians and their patrons over the eighteenth and nineteenth centuries, and the convergence of Braj, Persianate, and Bengali musical cultures in Bengal after 1856. -

Narratives of Kingship in Eurasian Empires, 1300-1800 Van Leeuwen, R
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Narratives of kingship in Eurasian empires, 1300-1800 van Leeuwen, R. DOI 10.1163/9789004340541 Publication date 2017 Document Version Final published version License CC BY-NC-ND Link to publication Citation for published version (APA): van Leeuwen, R. (2017). Narratives of kingship in Eurasian empires, 1300-1800. (Rulers & Elites; Vol. 11). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004340541 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:02 Oct 2021 Narratives of Kingship in Eurasian Empires, 1300–1800 Richard van Leeuwen - 978-90-04-34054-1 Downloaded from Brill.com03/22/2019 10:15:22AM via UvA Universiteitsbibliotheek Rulers & Elites Series -

H Word List-2 (Jul 01, 2021)
WORD LIST-1 (JUL 01, 2021) H 1. dose (noun) – an amount/quantity of something. 2. stimulus (noun) – impetus, boost, incentive, fillip. 3. stimulus/relief package (noun) – an attempt by the government to boost economic growth and save their country from a financial crisis by involving tax cuts, lowering interest rates and increasing government spending. 4. fall short of (phrase) – fail to meet/reach; be deficient/inadequate/insufficient. 5. assert (verb) - state, claim, announce, declare. 6. trickle down (phrasal verb) – pass on benefits to the people at the bottom of the pyramid (by those at top of the system). 7. seek (verb) – ask for, request, call on, appeal for. 8. cope with (verb) – deal with, grapple with, handle/manage. 9. pandemic (noun) – the worldwide spread of a new disease; The illness spreads around the world and typically affects a large number of people across a wide area. 10. unveil (verb) – present, announce, disclose/make public. 11. of sorts (phrase) – of a kind; not exactly the same as something. 12. implications (noun) – consequence/outcome, ramification, repercussion. 13. measure (noun) – action, step, procedure. 14. small-ticket (noun as modifier) - inexpensive (thing/items). 15. entrepreneur (noun) – businessman, businesswoman, business person. 16. project (verb) – forecast, predict, estimate, calculate. 17. Credit Guarantee Scheme (CGS) (noun) – Credit Guarantee Scheme (CGS) was launched to strengthen credit delivery system and to facilitate flow of credit to the MSE sector, create access to finance for unserved, under-served and underprivileged, making availability of finance from conventional lenders to new generation entrepreneurs. 18. add to (phrasal verb) – increase, boost, augment. -
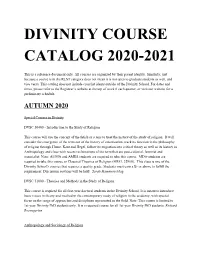
Divinity Course Catalog 2020-2021
DIVINITY COURSE CATALOG 2020-2021 This is a reference document only. All courses are organized by their parent identity. Similarly, just because a course is in the RLST category does not mean it is not open to graduate students as well, and vice versa. This catalog does not include crosslist idents outside of the Divinity School. For dates and times, please refer to the Registrar’s website at the top of week 6 each quarter, or visit our website for a preliminary schedule. AUTUMN 2020 Special Courses in Divinity DVSC 30400 - Introduction to the Study of Religion This course will use the concept of the fetish as a lens to treat the history of the study of religion. It will consider the emergence of the term out of the history of colonisation, track its function in the philosophy of religion through Hume, Kant and Hegel, follow its migration into critical theory as well as its history in Anthropology and close with recent reclamations of the term that are post-colonial, feminist and materialist. Note: All MA and AMRS students are required to take this course. MDiv students are required to take this course or Classical Theories of Religion (HREL 32900). This class is one of the Divinity School's courses that requires a quality grade. Students must earn a B- or above to fulfill the requirement. Discussion sections will be held. Sarah Hammerschlag DVSC 51000 - Theories and Methods in the Study of Religion This course is required for all first-year doctoral students in the Divinity School. It is meant to introduce basic issues in theory and method in the contemporary study of religion in the academy, with special focus on the range of approaches and disciplines represented in the field. -

The Silk Road Vol 12 2014
ISSN 2152-7237 (print) ISSN 2153-2060 (online) The Silk Road Volume 12 2014 Contents Silk Road Dress in a Chinese Tomb: Xu Xianxiu and Sixth-Century Cosmopolitanism, by Kate A. Lingley .......................................................................................................................... 1 Images of the Early Turks in Chinese Murals and Figurines from the Recently-Discovered Tomb in Mongolia, by Sergey A. Yatsenko ................................................................................................................... 13 Connections between Central Asia and the Northern Littoral of the Black Sea: the Evidence from Objects with Tamgas, by Sergey V. Voroniatov ................................................................................................................. 25 Some Examples of Central Asian Decorative Elements in Ajanta and Bagh Indian Paintings, by Matteo Compareti ................................................................................................................... 39 The Afrasiab Murals: a Pictorial Narrative Reconsidered, by Guitty Azarpay ........................................................................................................................ 49 The Performance of Pain and Remembrance in Late Ancient Iran, by Touraj Daryaee and Soodabeh Malekzadeh ..................................................................... 57 Russo-Polovtsian Dynastic Contacts as Reflected in Genealogy and Onomastics, by Anna Litvina and Fjodor Uspenskij ............................................................................. -

Adab As Ethics of Literary Form and Social Conduct: Reading the Gulistān in Late Mughal India
Adab as Ethics of Literary Form and Social Conduct: Reading the Gulistān in Late Mughal India Mana Kia1 Abstract: This essay examines the role and meaning of Shaykh Mushrif al-Dīn “Saʻdī” Shīrāzī’s Gulistān in late Mughal India. As the prose primer for a Persian education, the Gulistān encompassed the double meaning of adab, as exemplar both of literary form and of proper conduct. I explore instances in which the original text is cited in the work of Sirāj al-Din ʻAli Khān Ārzū (1689-1756 CE), a scholar and poet, who also wrote a commentary on the text. I then explore the larger context of Ārzū’s life and work in the context of mid- eighteenth-century Delhi, to situate the stakes of social and literary adab in a time of political fragmentation and social upheaval. Patronized by high-ranking Mughal officials, Ārzū was engaged in a larger project of recouping the cultural prestige of the imperial capital as political power devolved to regional centers in the face of factional politics and external invasion. Such an analysis seeks to historicize particular readings of classical texts of Persianate education. In addition to training several generations of scholars in a number of languages, Wheeler Thackston’s numerous translations of Persian and Turkish texts from all over the Islamicate world have made them accessible to readers without language training. These translations are in pithy, precise English that is contemporary, yet captures the tone and tenor of the original. Among his recent efforts is an English translation of the most important prose work in the Persian language, Shaykh Mushrif al-Dīn Muṣliḥ Saʻdī Shīrāzī’s Gulistān, presented alongside an easy to read typeset of the Persian original.2 While it is widely accepted that for centuries Shaykh Mushrif al-Dīn Muṣliḥ Saʻdī Shīrāzī’s Gulistān was the most commonly read Persian prose work, we still know little about how historically it was read and understood. -
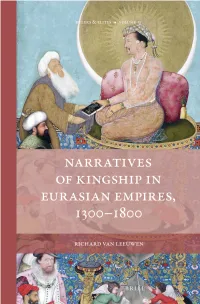
Download: Brill.Com/Brill-Typeface
Narratives of Kingship in Eurasian Empires, 1300–1800 Rulers & Elites Series Editor Jeroen Duindam (Leiden University) Editorial Board Maaike van Berkel (Radboud University Nijmegen) Yingcong Dai (William Paterson University) Jean-Pascal Daloz (University of Strasbourg) Jos Gommans (Leiden University) Jérôme Kerlouégan (University of Oxford) Dariusz Kolodziejczyk (Warsaw University) Metin Kunt (Sabanci University) volume 11 The titles published in this series are listed at brill.com/rule Narratives of Kingship in Eurasian Empires, 1300–1800 By Richard van Leeuwen leiden | boston This is an open access title distributed under the terms of the cc-by-nc-nd License, which permits any non-commercial use, and distribution, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Cover illustration: Jahangir preferring a Sufi shaikh to kings from the St. Petersburg Album, by Bichitr, 1615– 1618. Courtesy of the Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington, d.c.: Purchase – Charles Lang Freer Endowment, f1942.15a. The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://lccn.loc.gov/2017028405 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill-typeface. issn 2211-4610 isbn 978-90-04-34053-4 (hardcover) isbn 978-90-04-34054-1 (e-book) Copyright 2017 by Richard van Leeuwen. This work is published by Koninklijke Brill nv. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. Koninklijke Brill nv reserves the right to protect the publication against unauthorized use and to authorize dissemination by means of offprints, legitimate photocopies, microform editions, reprints, translations, and secondary information sources, such as abstracting and indexing services including databases.