Die Tattoo- Legende
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ZUWACHS FÜR HAUPTQUARTIERE Immer Mehr Unternehmen Verlagern Ihre Zentralen in Die Hafencity
NR. 6 JUNI 2006 NFAKTEN, MEINUNGEN,E VISIONENWS WWW.HAFENCITY.COM INFRASTRUKTUR: KREUZFAHRTSTANDORT: SOMMERTHEATER: Ein engmaschiges Wegenetz S. 2 Neue Halle für Cruise Center S. 2 Thalia in der HafenCity S. 4 ZUWACHS FÜR HAUPTQUARTIERE Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Zentralen in die HafenCity. Jetzt kommt auch Unilever mit 1.200 Büroarbeitsplätzen STRANDKAI Der Weltkonzern zieht mit wird moderner, schneller, noch kundenorien- seiner Deutschland-Zentrale ans Wasser: Uni- tierter, dynamischer. Was liegt da näher, als in lever, bekannt für Marken wie Axe, Becel, Coral, das modernste, dynamischste Umfeld dieser Langnese oder Rama, verlässt seinen Stamm- schönen Stadt zu ziehen? – In die HafenCity.“ sitz am Dammtorwall. Beim Bau vor 40 Jahren Insgesamt hatte Unilever zwölf verschiedene hatte das Gebäude noch zu den modernsten Standorte in Hamburg in Betracht gezogen weltweit gezählt; mit dem neuen „Unilever – und sich dann für einen Standort in der Ha- Haus HafenCity“ will das Unternehmen jetzt fenCity entschieden. wieder ein architektonisches Ausrufungszei- Hier, an der Straße Großer Grasbrook, chen setzen. wird Unilever in Zukunft in unmittelbarer 90 Millionen Euro sind für das neue Gebäu- Nachbarschaft von SAP, Kühne + Nagel und de veranschlagt, über 1.200 Büroarbeitsplätze Jungheinrich sitzen. Nach einem Architekten- werden entstehen. Damit wappnet sich Unile- wettbewerb will Unilever 2007 mit dem Bau ver auch für die Anforderungen der kommen- beginnen und so schnell wie möglich in die den Jahrzehnte. neue Zentrale am Wasser einziehen. -

Wer in Der Hansestadt an Der Spitze
Ausgabe 2018 >> Euro 4,90 HAMBURGS BESTE ARBEITGEBER 2018 ARBEITGEBER BESTE HAMBURGS PORTRÄTS, INFORMATIONEN, HINTERGRÜNDE Wer in der Hansestadt an der Spitze ist 349 Unternehmen im Test www.abendblatt.de/beste Extra: die besten Dienstleister aus 49 Branchen Verlags-Sonderpromotion mit Poleposition Menschen Mit Leidenschaft gesucht! VORWORT Liebe Leserinnen, liebe Leser, ieses Magazin ist ein Kompass. Ein Kompass durch die Hamburger Wirtschafts- und Arbeits- welt. Es soll Ihnen helfen – auf dem Weg von einem Arbeitgeber zur nächsten Position ebenso wie bei der täglichen Auswahl aus der Flut tau- sender Dienstleister an Alster und Elbe. dAuf den folgenden knapp 100 Seiten geht es um nicht starten sie jetzt durch als führungs- weniger als die elementaren Fragen: Wer sind die besten kraft oder Mitarbeiter im Retail und Arbeitgeber der Stadt? Und: Welches sind die besten Dienstleister Hamburgs? Aber es gibt natürlich auch reichlich Service: für die Bewer- nehmen sie an unserem individuellen bung ebenso wie für den persönlichen Gehaltscheck oder die Orientierung über inno- entwicklungsprogramm teil. vative Arbeitszeitmodelle. Die Auszeichnung „Hamburgs beste Arbeitgeber“ blickt bereits auf eine stolze Geschichte zurück: Die Studie vom Hamburger Faktenkontor, der Helmut-Schmidt- Oder steigen sie als spezialist Universität und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) wird bereits zum 10. Mal vergeben – und vom Hamburger Abendblatt sowie Alster- in einem unserer Zentralbereiche ein: radio 106,8 unterstützt. Neu vergeben wird in diesem Jahr das Siegel „Hamburgs Beste“. In dem Sonder- teil dieses Magazins werden knapp 350 Firmen aus 50 unterschiedlichen Branchen einkauf an Alster und Elbe bewertet. Das Spektrum der Unternehmen reicht von A wie Apo- theke über Banken und Restaurants bis W wie Weinhändler. -

Kjetil Ansgar Jakobsen NORWEGIAN AUTUMN
Equality is not a uniquely Norwegian or Scandinavian In the nineteenth century, Hammersborg, the Following Jens Arup Seip’s famous lecture From Kjetil Ansgar Jakobsen characteristic. Historically, the di"ferences in income small hill above Oslo, was given the nickname ‘the The Public Servant State to the One-party State, and wealth have been as great in Norway as in Norwegian Acropolis’. The so called Public Servant the history of Norwegian democracy is customarily NORWEGIAN AUTUMN other European countries; this is true whether you state (embetsmannstaten) of that era built a hospital divided into three ‘regimes’: the Public Servant look at the Viking era or the nineteenth century. there and located three churches on the hill: the state from 1814 until 1884; the bourgeois multi- Kjetil Ansgar Jakobsen is a Norwegian historian Scandinavian equality emerged from the struggles Trinity Church, Saint Olav’s Cathedral and the party or Liberal state from 1884 until 1935 and and writer, and specialist in recent French, of the labour movement around the middle of the Johannes Church. The style and materials of the the Social Democratic order or Labour Party state German and Norwegian culture and history 20th century. In the 1920s, less than a century churches marked "irm a""iliations with a Lutheran from 1935 or 1945.1 I use the word ‘regime’ here, of ideas. In this essay he situates Erling Viksjø!s buildings in the Government Quarter in a ago, British newspapers warned their readers culture with its centre in northern Germany. The as do biologists, to indicate a relatively stable Norwegian architectural history characterized against what they called the ‘Norwegian condition’, churches – including the Roman Catholic Saint Olav’s dynamic system. -

Williams College/Clark Art Institute
GRADUATE PROGRAM IN THE HISTORY OF ART Williams College/Clark Art Institute Summer 2001 NEWSLETTER ~ '" ~ o b iE The Class of 2001 at their Hooding Ceremony. From left to right: Mark Haxthausen, Jeffrey T. Saletnik, Clare S. Elliott, Jennifer W. King, Jennifer T. Cabral, Karly Whitaker, Rachel Butt, Elise Barclay, Anna Lee Kamplain, and Marc Simpson LETTER FROM THE DIRECTOR CHARLES W. (MARK) HAx'rHAUSEN Faison-Pierson-Stoddard Professor of Art History, Director of the Graduate Program With this issue we are extremely pleased to revive the Graduate Program's ANNuAL NEWSLETTER, in a format that is greatly expanded from its former incarnation. This publication will appear once a year, toward the end of the summer, bringing you news about the program, Williams, the Clark, our faculty, students, and graduates. The return of the newsletter is a fruit of one of the happy developments of a remarkably successful year-the creation of the position ofAsSOCIATE DIRECTOR of the Graduate Program. In recent years, with the introduction of the QualifYing Paper and Annual Symposium, the workload in the Graduate Program had seriously outgrown the capacities of its small staff. With the naming ofMARc SIMPSON to the new post, we have the resources not only to handle existing administrative demands but to expand our activities into neglected areas, one ofwhich is the publication of this newsletter, for which Marc serves as editor. We feel especially fortunate to have added Marc to the Program. A leading scholar of American art, he received his Ph.D. from Yale and served from 1985 to 1994 as Ednah Root Curator ofAmerican Paintings at the Fine Arts Museums of San Francisco. -

14 09 21 Nordics Gids 200Dpi BA ML
1 Impressies Oslo Vigelandpark Architecten aan het werk bij Snohetta Skyline in stadsdeel Bjørvika Stadhuis Oeragebouw (Snohetta) Noors architectuurcentrum Gyldendal Norsk Forlag (Sverre Fehn) Vliegveld Gardemoen (N.Torp) Mortensrud kirke (Jensen Skodvin) Ligging aan de Oslo Fjord Vikingschip Museum Nationaal museum 2 Impressies Stockholm Husbyparken Bonniers Konsthalle Royal Seaport Bibliotheek Strandparken Medelhavsmuseet HAmmersby sjostad Riksbanken Markus Kyrkan Arstabridge Terminal building Vasaparken 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Programma 5 Contactgegevens 7 Deelnemerslijst 8 Plattegronden Oslo 9 Plattegronden Stockholm 11 Introductie Oslo 13 Noorse architectuur 15 Projecten Oslo 21 Introductie Stockholm 48 Projecten Stockholm 51 4 Programma Oslo OSLO, vrijdag 12 september 2014 6:55 KLM vlucht AMS-OSL 9:46 transfer met reguliere trein van vliegveld naar CS (nabij hotel) 10:10 bagage drop Clarion Royal Christiania Hotel, Biskop Gunnerus' gate 3, Oslo 10:35 reistijd metro T 1 Frognerseteren van Jernbanetorget T (Oslo S) naar halte Holmenkollen T 11:10 Holmenkollen ski jump, Kongeveien 5, 0787 Oslo 12:00 reistijd metro T 1 Helsfyr van Holmenkollen T naar halte Majoerstuen T 12:40 Vigelandpark, Nobels gate 32, Oslo 14:00 reistijd metro T 3 Mortensrud van Majorstuen T naar halte Mortensrud T 14:35 Mortensrud church, Mortensrud menighet, Helga Vaneks Vei 15, 1281 Oslo 15:20 reistijd metro 3 Sinsen van Mortensrud naar halte T Gronland 16:00 Norwegian Centre for Design and Architecture, DogA, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo lopen naar hotel -
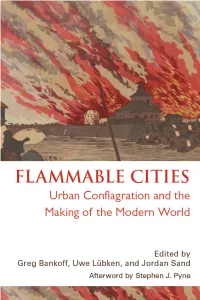
Flammable Cities: Urban Conflagration and the Making of The
F C Flammable Cities Urban Conflagration and the Making of the Modern World Edited by G B U L¨ J S T U W P Publication of this volume has been made possible, in part, through support from the German Historical Institute in Washington, D.C., and the Rachel Carson Center for Environment and Society at LMU Munich, Germany. The University of Wisconsin Press 1930 Monroe Street, 3rd Floor Madison, Wisconsin 53711–2059 uwpress.wisc.edu 3 Henrietta Street London WC2E 8LU, England eurospanbookstore.com Copyright © 2012 The Board of Regents of the University of Wisconsin System All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any format or by any means, digital, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or conveyed via the Internet or a website without written permission of the University of Wisconsin Press, except in the case of brief quotations embedded in critical articles and reviews. Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Flammable cities: Urban conflagration and the making of the modern world / edited by Greg Bankoff, Uwe Lübken, and Jordan Sand. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-299-28384-1 (pbk.: alk. paper) ISBN 978-0-299-28383-4 (e-book) 1. Fires. 2. Fires—History. I. Bankoff, Greg. II. Lübken, Uwe. III. Sand, Jordan. TH9448.F59 2012 363.3709—dc22 2011011572 C Acknowledgments vii Introduction 3 P : C F R 1 Jan van der Heyden and the Origins of Modern Firefighting: Art and Technology in Seventeenth-Century Amsterdam 23 S D K 2 Governance, Arson, and Firefighting in Edo, 1600–1868 44 J S and S W 3 Taming Fire in Valparaíso, Chile, 1840s–1870s 63 S J. -

Marking a New Chapter in the History of Our City. Newspaper Narratives of Proposed Waterfront Star Architecture
Vol.3 Vol.4no.2| no.12021 | 2021 Image Credits ©Carola Hein, CC-BY-NC ©Carola Image Credits MAIN SECTION Marking a New Chapter in the History of our City. Newspaper Narratives of Proposed Waterfront Star Architecture Nadia Alaily-Mattar — Delft University of Technology, Netherlands — Contact: [email protected] Mina Akhavan — Politecnico di Milano, Italy — Contact: [email protected] Carola Hein — Delft University of Technology, Netherlands — Contact: [email protected] ABSTRACT A recurrent claim associated with the development of star architecture buildings along new urban waterfronts in port cities is that star architecture’s capacity to garner media exposure for a port city can support its efforts to communicate narratives of urban transformation. Even during the inception phase, a constellation of actors legitimizes these projects by cap- italizing on their power to attract media attention. The media play a role in the communica- tion and construction of narratives. This paper shows how newspaper narratives about a proposed star architecture project along the waterfront of a port city communicate transfor- mation proposals. The case study presented is the inception phase of the Elbphilharmonie in Hamburg, Germany. The findings are based on content analysis of 420 newspaper articles, published before the formal endorsement of the project. The findings indicate that news- papers communicated the sense-making value of the Elbphilharmonie based on the visual and emotional power of star architecture. Newspapers introduced notions of identity, citizen identification and Hanseatic particularity into the discourse and played an important role in explaining the promise of the Elbphilharmonie to become a symbol of the city’s commitment to the port, the maritime context and the Elbe river. -
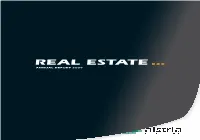
View Annual Report
KEY FIGURES EUR k 2009 2008 Change (%) Annual Report 2009 Revenues and earnings Revenues 102,510 102,055 0.4 Net rental income 91,964 93,222 – 1.4 Consolidated loss / profi t for the period – 79,651 – 56,000 – 42.2 ce REIT-AG ce FFO 32,690 39,415 – 17.1 Loss per share (EUR) – 1.44 – 1.02 – 41.2 alstria offi Balance sheet Investment property 1,425,440 1,805,265 – 21.0 Total assets 1,766,134 1,873,493 – 5.7 Equity 634,185 729,667 – 13.1 Equity ratio 35.9% 38.9% – 3.0 pp Liabilities 1,131,949 1,143,826 – 1.0 NAV/share (EUR) 11.32 13.03 – 13.1 NNNAV/share (EUR) 11.32 13.03 – 13.1 REIT key fi gures REAL ESTATE ... REIT ratio 40.3% 40.3% 0.0 pp ANNUAL REPORT 2009 Revenues plus other income from investment properties 100% 100% 0.0 pp Stock fi gures Number of shares (excluding own shares) 55,997,626 54,624,245 2.5 Number of treasury shares 2,374 1,375,755 – 99.8 Total 56,000,000 56,000,000 0 CONTENTS Letter from the Board of Management 2 Management Compliance Statement 81 Through Our Eyes 6 Auditors’ Report 82 alstria Stock 16 Corporate Governance 83 Report of the supervisory board 83 Group Management Report (separate content) 19 Corporate governance statement 86 Economics and strategy 20 Remuneration report 90 Financial analysis 25 REIT Disclosures and Portfolio 92 Report on risks and opportunities 29 REIT declaration 92 Sustainability report 33 REIT memorandum 93 Mandatory disclosure 33 Valuation report 94 Additional Group disclosures 35 List of all properties 102 Subsequent events and outlook 36 Other Information 108 Glossary 108 Consolidated -

Another Two Diagonal Avenues Intersect the Site, Radiating from the Central Section of the Gardens on Carlton Street, to the Two Southern Entry Points
ROYAL EXHIBITION BUILDING AND CARLTON GARDENS Another two diagonal avenues intersect the site, radiating from the central section of the gardens on Carlton Street, to the two southern entry points. The avenue on the east side is planted with Plane trees (Platanus x acerifolia). Near the Works Depot, in the avenue’s most northern extent, the trees are planted at wide spacings. This may have been a realisation of John Guilfoyle’s 1916 proposal to remove every second plane tree from the South Garden Plane Tree Avenue. It is unclear when the removal was to take place. The plane tree avenue referred to may have been that in the North Garden and not the one in the South Garden. In the southern section the trees are closely spaced, forming a denser over canopy and providing a stronger sense of enclosure. The avenue on the opposite diagonal on the west side of the gardens is planted with Grey Poplars (Populus x canescens) also reaching senescence. A replanting on the south-west side of this avenue with poplars occurred in 2006. The avenue’s integrity is strongest near Carlton Street where the trees are regularly spaced and provide good canopy coverage. 4.4.5 North Garden Boundary Trees The layout of the North Garden in the 1890s was primarily based on extensive avenue plantings crossing the site, with little in the way of other ornamentation. Individual specimen trees were mainly planted around the perimeter of the site, forming loose boundary plantations. The spaces between the avenue plantations remained relatively free of in-fill plantings, with expanses of turf being the primary surface treatment in these areas. -

HAFENCITY HAMBURG – IDENTITY, SUSTAINABILITY and URBANITY Jürgen Bruns-Berentelg
3 | HAFENCITY DISCUSSION PAPER Jürgen Bruns-Berentelg HAFENCITY HAMBURG – IDENTITY, SUSTAINABILITY AND URBANITY Jürgen Bruns-Berentelg HAFENCITY HAMBURG – IDENTITY, SUSTAINABILITY AND URBANITY HafenCity discussion paper no. 3 Hamburg, September 2014 / revised edition This HafenCity essay is the long version of a book essay published in 2013 in: ST. KATHARINEN Die Hauptkirche und ihr Viertel – eine Wiederentdeckung Published by Hauptkirche St. Katharinen ELBE&FLUT Edition/Junius-Verlag (2013) ISBN: 978-3-88506-026-4 www.hafencity.com/en/publications.html Abstract: How can the guiding perspectives of the HafenCity development over and beyond the master plan, which describe the production of “city” as a process, be characterized? This essay is devoted to answering this question. The development process of HafenCity – or so runs the argument – has witnessed the emergence of three overlapping, tangible and intangible perspectives of thought and action: identity, sustainability and urbanity. This multi-dimensional orientation is linked with highly challenging global and local demands that intersect with the urban spatial dimensions as a “new downtown” and “waterfront” urban development project. Author: Jürgen Bruns-Berentelg HafenCity Hamburg GmbH Osakaallee 11, 20457 Hamburg E-mail: [email protected] The author is chief executive officer of HafenCity Hamburg GmbH since 2003 and also Honorary Professor of Integrated Urban Development at HafenCity University, Hamburg. 1 HAFENCITY HAMBURG – The radical nature of this transformation is based on two factors. In contrast to the IDENTITY, SUSTAINABILITY high-quality brick buildings of the warehouse district, the HafenCity area had largely AND URBANITY featured relatively unassuming functional buildings, most of them single-storey storage sheds, such as are still to be found today in the Oberhafen, or upper port, district. -

Kjetil Ansgar Jakobsen NORSK HØST
Likhet er ikke et norsk eller skandinavisk særtrekk. Hammersborg, den lille høyden over Oslo, !ikk på Etter Jens Arup Seips berømte foredrag Fra embets- Kjetil Ansgar Jakobsen Forskjellene i inntekt og formue har historisk sett 1800-tallet oppnavnet «Det norske Akropolis». mannsstat til ettpartistat er det vanlig å dele vært like store i Norge som i andre europeiske Embetsmannsstaten bygde sykehus her og plasserte det norske demokratiets historie i tre regimer. NORSK HØST land, og det gjelder enten man ser til vikingtiden tre kirker på høyden: Trefoldighetskirken, Sankt Embetsmannsstaten fra 1814 til 1884, den borgerlige eller til 1800-tallet. Den skandinaviske likheten ble Olavs domkirke og Johanneskirken. Kirkenes !lerpartistaten eller Venstrestaten fra 1884 til Kjetil Ansgar Jakobsen (f. 1965) er en norsk kjempet fram av arbeiderbevegelsen rundt midten stil og materialer markerte trygg tilhørighet til 1935 og deretter den sosialdemokratiske orden historiker, sakprosaforfatter, og spesialist av det 20. århundret. I 1920-årene, for under hundre en luthersk kultur med sentrum i det nordlige eller Arbeiderpartistaten fra 1935 eller 1945. på nyere fransk, tysk og norsk kultur- og år siden, kunne britiske aviser advare mot det de Tyskland. Kirkene – også katolske Sankt Olav Ordet regime brukes her, slik også biologene idéhistorie. Han skriver Erling Viksjøs bygninger i regjeringskvartalet inn i en norsk kalte «norske tilstander», med bitter klassekamp – er bygd i rød tegl, som i Lübeck, Hamburg og gjør det, om et relativt stabilt dynamisk system. arkitekturhistorie preget av kon!likt. og endeløse streiker og lockouter. Men så endret Danzig. Stilen er romantisk historisk, preget av Arbeiderpartiet tok makten i to runder, i 1935 norsk samfunnsliv seg. -

Rb 500 6/2014
,QWHUQDWLRQDOH9HUHLQLJXQJ IU3RVWJHVFKLFKWH 'HXWVFKHU $OWEULHIVDPPOHU9HUHLQH9 5XQGEULHI1U -XQL $XVGHU6DPPOXQJ.ODXV5KO´0XVWHURKQH:HUWµ YRQ$OWGHXWVFKODQGELV'HXWVFKODQG0RGHUQGLHDQOlVVOLFKGHU +HLQULFK.|KOHU$XNWLRQYRPELV6HSWHPEHU]XP$QJHERWNRPPW Å+HUU3RVWPHLVWHUZlUHHVP|JOLFKPHLQHQ Å0XVWHUNQDEHQ´DOV0XVWHU]XYHUVHQGHQ"´ -HW]WHLQOLHIHUQ Einlieferungsschluss: 18. Juli 2014 +(,15,&+.g+/(5$XNWLRQVKDXV*PE+ &R.* :LOKHOPVWU :LHVEDGHQ 7HO )D[ ZZZKHLQULFKNRHKOHUGHLQIR#KHLQULFKNRHKOHUGH Ihr Partner für PHILATELIE & NUMISMATIK Christoph Gärtner Christoph Wir suchen • Briefmarken Alle Welt • Briefe vor 1950 aller Gebiete Jetzt vormerken! • ausgebaute Ländersammlungen • thematische Sammlungen - alle Motive • komplette Nachlässe Ϯϵ͘ƵŬƟŽŶ | ϲ͘ͲϭϬ͘KŬƚŽďĞƌϮϬϭϰ • Münzen aller Art Einlieferungsschluß ist der 2. August 2014! • auch Händler- und Dublettenposten ... jederzeit im SOFORT-BARANKAUF oder als EINLIEFERUNG *Vermittler erhalten Provision Rufen Sie uns an: +49-(0)7142-789400 <ŽŶƚĂŬƟĞƌĞŶ^ŝĞƵŶƐƉĞƌĞͲŵĂŝů͗ [email protected] IHRE WERTE WELTWEIT IM FOKUS Ϯϳ͘ƵŬƟŽŶͬ>ŽƐϭϬ͘ϲϭϬ Jetzt einliefern oder verkaufen! ǀĞƌŬĂƵŌĨƺƌ͗ϴ͘ϳϬϬ€ (Zuschlag + Aufgeld) Wir bieten • 3 mal im Jahr internationale Großauktionen • Unverbindliche und diskrete Beratung • Kostenlose Schätzungen • Schnelle und seriöse Abwicklung • Kostenloser Abholservice mit Vollversicherung • Internationale Experten mit jahrelanger Erfahrung • $XNWLRQVNDWDORJHPLWKRKHU$XÁDJH • Günstige Einlieferungskonditionen ohne weitere Nebenkosten Ϯϳ͘ƵŬƟŽŶͬ>ŽƐϭϬ͘ϲϭϵ ǀĞƌŬĂƵŌĨƺƌ͗ϳ͘ϴϬϬ€ • Internationales Kundennetzwerk