Tarock in Niederösterreich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dashabatar Taas of Bishnupur
Lost Game: Dashabatar Taas of Bishnupur Tarun Tapas Mukherjee Assistant Professor, Bhatter College, West Bengal, India Picture 1: Dashabatar Taas of Bishnupur by Sital Fouzdar: one of the court-cards from each suit The Dynasty and the Game Bishnupur witnessed the rise of a glorious tradition of art, craft and culture since the 700 AD under the patronage of the Malla kings of Bankura. The tradition reached its zenith during the reign (1565—1620 A.D) of Malla king Veer Hambir, the 49th ascender to the throne. His long and stable reign can be called the golden era of arts and culture—classical in taste and nature. The tradition was carried forward by his successors King Raghunath Singha and his son Veer Singha. Art, literature and music reached their heights through research, experimentation, training and application. After his conversion to Vaishnavism, according to some authors, under the influence of Vaishnav guru Srinivas Acharya, Veer Hambir was inspired to create a distinct style of art and to nurture a different type of cultural atmosphere in Bishnupur.i The establishment of Vaishanavism might have had something to do with enjoying pastime in a different and non-violent way and this might have given birth to the game of ‘Dashabatar taas’. Vaishanavism also hints that the game might have been imported Chitrolekha International Magazine on Art and Design, (ISSN 2231—4822), Vol. 1, No. 2, August, 2011 URL of the Issue: www.chitrolekha.com/v1n2.php Available at www.chitrolekha.com/V1/n2/09_Dashabatar_Taas_of_Bishnupur.pdf Kolkata, India. © Chitrolekha International Magazine on Art and Design. -

Collezionar. Minchiate Origini E Datazione Del Gioco Dei Germini O Minchiate Fiorentine
Collezionar. minchiate Origini e datazione del gioco dei Germini o Minchiate fiorentine GIORDANO BERTI uello conosciuto co me Germini, o Min Qchiat e fiorentine, è dei giochi più affa uno scinanti che siano mai stati ideati. Le sue origini risalgono all'età rinascimentale ed è stato a lungo praticato nell'a rea geografica compresa fra l'Emilia e il Lazio, alla corte di Parigi, in qualche circolo vien nese e, con qualche variante, in Liguria e in Sicilia. Poi, sul finire dell'Ottocento, le Min chiate sono finite nel "riposti glio dei giochi vecchi", sop piantate da altri giochi rispon denti alle mode dell'epoca. Negli ultimi anni l'interesse nei confronti di queste carte si è risvegliato, grazie ad impor tanti mostre e alla ristampa di alcuni di mazzi. È così comin ciata la ricerca dei "pezzi origi 21 Trionfi dei tarocchi (la fra quelli permessi compare ché le opinioni si scontrano e nali" da parte dei collezionisti Papessa è stata eliminata), i anche il giuocho delle minchia- si confrontano con i più anti e degli studiosi che allo stesso Germini comprendono 12 te. Pare che in una lettera del chi frammenti di mazzi giunti tempo hanno approfondito le segni zodiacali, 4 elementi, 3 1466 indirizzata a Lorenzo il sino ai nostri giorni. E preci indagini storiche. virtù teologali e la Prudenza, Magnifico dal poeta fiorenti samente: che completa la serie delle no Luigi Pulci si accennasse 1) i Fogli Rosenwald (fine sec. UN MAZZO INCONSUETO virtù cardinali. alle Minchiate giocate a Fi XV); tre fogli intonsi conser Le Minchiate fiorentine sono Si ignora il momento e il luo renze, ma perso il manoscritto vati presso la National Gallery una variante del gioco dei go esatto in cui venne prodot originale non è possibile la of Art di Washington. -
![Tarot (Maskulinum Oder Neutrum, Ausgesprochen [Ta'ro:]) Ist Ein 78-Blatt-Kartensatz, Der Zu Psychologischen Und Divinatorischen Zwecken Verwendet Wird](https://docslib.b-cdn.net/cover/0251/tarot-maskulinum-oder-neutrum-ausgesprochen-taro-ist-ein-78-blatt-kartensatz-der-zu-psychologischen-und-divinatorischen-zwecken-verwendet-wird-230251.webp)
Tarot (Maskulinum Oder Neutrum, Ausgesprochen [Ta'ro:]) Ist Ein 78-Blatt-Kartensatz, Der Zu Psychologischen Und Divinatorischen Zwecken Verwendet Wird
Tarot Geschrieben von: Administrator Sonntag, 12. April 2009 um 00:17 Uhr - Aktualisiert Montag, 13. April 2009 um 21:03 Uhr Tarot Tarot (maskulinum oder neutrum, ausgesprochen [ta'ro:]) ist ein 78-Blatt-Kartensatz, der zu psychologischen und divinatorischen Zwecken verwendet wird. Er wird eingeteilt in die 22 großen Arkana und die 56 kleinen Arkana. Die Geschichte der im Artikel Tarock gesondert behandelten Tarotspielkarten war bis Ende des 18. Jahrhunderts mit den als Deutungswerkzeug benutzten Tarots identisch. Seitdem enthalten Decks, welche explizit als Deutungswerkzeuge gedacht sind, zunehmend symbolische Inhalte. 1 Geschichte 1.1 Etymologie des Wortes „Tarot“ 1.2 Geschichte der Spielkarten 2 Tarot-Decks 2.1 Marseille-Tarot 2.2 Rider-Waite-Tarot 2.3 Crowley-Tarot (Thoth-Tarot) 2.4 Unterschiedliche Decks 3 Erklärungsmodelle 4 Die großen Arkana 4.1 Die 22 Trumpfkarten 4.2 „Die Reise des Helden“ 4.3 Das Tarotblatt 5 Die kleinen Arkana 5.1 Farben und Elemente 5.2 Die 16 Hofkarten 5.2.1 Personenzuordnung 5.2.2 Elementezuordnung 5.2.3 Alternative Deutung 5.3 Die 40 Zahlenkarten 5.3.1 Kabbalistische Zuordnung 6 Verbindung zu anderen esoterischen Systemen 6.1 Alchemie 6.2 Numerologie 6.3 Kabbala 6.4 Astrologie 6.5 Weitere Systeme 7 Legen und Lesen der Karten 7.1 Vorbereitung 7.2 Legesysteme 7.2.1 Legen mit drei Karten 7.2.2 Das keltische Kreuz 7.2.3 Umgekehrte Karten 8 Tarot in Literatur und Film 9 Rezeption 10 Siehe auch 1 / 24 Tarot Geschrieben von: Administrator Sonntag, 12. April 2009 um 00:17 Uhr - Aktualisiert Montag, 13. -

Ganjifa, the Delicate Art on These Tiny Playing Cards
Kunapipi Volume 22 Issue 2 Article 7 2000 Raghupathi Bhatta: Reviving a Dying Art June Gaur Follow this and additional works at: https://ro.uow.edu.au/kunapipi Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Gaur, June, Raghupathi Bhatta: Reviving a Dying Art, Kunapipi, 22(2), 2000. Available at:https://ro.uow.edu.au/kunapipi/vol22/iss2/7 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Raghupathi Bhatta: Reviving a Dying Art Abstract Raghupathi Bhatta of Mysore, one of India's most promising traditional artists, hails from a family of South-Indian Pandits (Brahamin priests). It was in the ancient town of Nagamangala, seventy kilometers from Mysore, that his artistic imagination was fired. First, by the exquisite details of Hoysala craftsmanship in the temples there, and then, by the beautiful nineteenth-century playing cards of the Mysore Maharaja, Krishnaraja Wodeyar IV. He began his artistic career by learning Ganjifa, the delicate art on these tiny playing cards. But there were no gurus in the family from whom he could learn this centuries-old craft which had fascinated him since he was a child. To quote Bhatta: 'In the early seventies, I bought a few Ganjifa paintings from the Mysore Palace. Since then, it's grown into an obsession and I've lived for, and by Ganjifa, collecting as much information as I could, including old photographs and cards from all over India and Nepal'. This journal article is available in Kunapipi: https://ro.uow.edu.au/kunapipi/vol22/iss2/7 Raghupathi Bhatta: Reviving a Dying Art 33 JUNE GAUR Raghupathi Bhatta: Reviving a Dying Art Raghupathi Bhatta of Mysore, one of India's most promising traditional artists, hails from a family of South-Indian Pandits (Brahamin priests). -
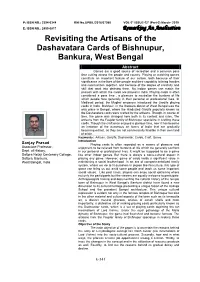
Remarking an Analisation Revisiting the Artisans
P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-2) March- 2019 E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation Revisiting the Artisans of the Dashavatara Cards of Bishnupur, Bankura, West Bengal Abstract Games are a good source of recreation and a common pass time cutting across the people and country. Playing or watching games constitute an important feature of our culture, both because of their significance in the lives of the people and their capability to bring families and communities together, and because of the degree of creativity and skill that work into devising them. No indoor games can match the passion with which the cards are played in India. Playing cards is often considered a pass time , a pleasure to neutralize the burdens of life which people face generally in their personal or professional lives. In Medieval period, the Mughal emperors introduced the Ganjifa playing cards in India. Bishnpur, in the Bankura district of West Bengal was the only place in Bengal, where the Hinduized Ganjifa popularly known as the Dashavatara cards were crafted by the artisans. Though, in course of time, the game was changed here both in its content and rules. The artisans from the Faujdar family of Bishnupur specialize in crafting these cards. Though the craft once enjoyed a glorious time, now it has become an instance of the numerous art forms of India that are gradually becoming extinct, as they are not commercially feasible in their own land of origin. Keywords: Artisan, Ganjifa, Dashavatar, Cards, Craft, Game. Introduction Sanjay Prasad Playing cards is often regarded as a means of pleasure and Associate Professor, enjoyment to be relieved from burdens of life which we generally confront Dept. -

The Penguin Book of Card Games
PENGUIN BOOKS The Penguin Book of Card Games A former language-teacher and technical journalist, David Parlett began freelancing in 1975 as a games inventor and author of books on games, a field in which he has built up an impressive international reputation. He is an accredited consultant on gaming terminology to the Oxford English Dictionary and regularly advises on the staging of card games in films and television productions. His many books include The Oxford History of Board Games, The Oxford History of Card Games, The Penguin Book of Word Games, The Penguin Book of Card Games and the The Penguin Book of Patience. His board game Hare and Tortoise has been in print since 1974, was the first ever winner of the prestigious German Game of the Year Award in 1979, and has recently appeared in a new edition. His website at http://www.davpar.com is a rich source of information about games and other interests. David Parlett is a native of south London, where he still resides with his wife Barbara. The Penguin Book of Card Games David Parlett PENGUIN BOOKS PENGUIN BOOKS Published by the Penguin Group Penguin Books Ltd, 80 Strand, London WC2R 0RL, England Penguin Group (USA) Inc., 375 Hudson Street, New York, New York 10014, USA Penguin Group (Canada), 90 Eglinton Avenue East, Suite 700, Toronto, Ontario, Canada M4P 2Y3 (a division of Pearson Penguin Canada Inc.) Penguin Ireland, 25 St Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland (a division of Penguin Books Ltd) Penguin Group (Australia) Ltd, 250 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124, Australia -

The Image of the Turk in Early Modern Board Games and Playing Cards
THE IMAGE OF THE TURK IN EARLY MODERN BOARD GAMES AND PLAYING CARDS ÖMER FATİH PARLAK PHD THESIS Directed by DR. MARÍA JOSÉ VEGA RAMOS and DR. LARA VILÀ TOMAS Literary Theory and Comparative Literature Department of Spanish Literature Faculty of PhiLosophy and Arts BarceLona 2019 In memory of my father, Adem Parlak (1949-2014) TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS .................................................................................................... 5 TABLE OF FIGURES ........................................................................................................ 8 LIST OF TABLES ............................................................................................................... 9 ABSTRACT ....................................................................................................................... 10 RESUMEN ......................................................................................................................... 11 ACKNOWLEDGEMENTS .............................................................................................. 12 INTRODUCTION ............................................................................................................. 15 GAMES INDEX ................................................................................................................... 23 Germany ...................................................................................................................... 23 Italy ............................................................................................................................. -

Tarot 1 Tarot
Tarot 1 Tarot The tarot (/ˈtæroʊ/; first known as trionfi and later as tarocchi, tarock, and others) is a pack of playing cards (most commonly numbering 78), used from the mid-15th century in various parts of Europe to play a group of card games such as Italian tarocchini and French tarot. From the late 18th century until the present time the tarot has also found use by mystics and occultists in efforts at divination or as a map of mental and spiritual pathways. The tarot has four suits (which vary by region, being the French suits in Northern Europe, the Latin suits in Southern Europe, and the German suits in Central Europe). Each of these suits has pip cards numbering from ace to ten and four face cards for a total of 14 cards. In addition, the tarot is distinguished by a separate 21-card trump suit and a single card known as the Fool. Depending on the game, the Fool may act as the top trump or may be played to avoid following suit. François Rabelais gives tarau as the name of one of the games played by Gargantua in his Gargantua and Pantagruel;[1] this is likely the earliest attestation of the French form of the name.[citation needed] Tarot cards are used throughout much of Europe to play card games. In English-speaking countries, where these games are largely unplayed, tarot cards are now used primarily for divinatory purposes. Occultists call the trump cards and the Fool "the major arcana" while the ten pip Visconti-Sforza tarot deck. -

A Cultural History of Tarot
A Cultural History of Tarot ii A CULTURAL HISTORY OF TAROT Helen Farley is Lecturer in Studies in Religion and Esotericism at the University of Queensland. She is editor of the international journal Khthónios: A Journal for the Study of Religion and has written widely on a variety of topics and subjects, including ritual, divination, esotericism and magic. CONTENTS iii A Cultural History of Tarot From Entertainment to Esotericism HELEN FARLEY Published in 2009 by I.B.Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 www.ibtauris.com Distributed in the United States and Canada Exclusively by Palgrave Macmillan 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 Copyright © Helen Farley, 2009 The right of Helen Farley to be identified as the author of this work has been asserted by the author in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or any part thereof, may not be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN 978 1 84885 053 8 A full CIP record for this book is available from the British Library A full CIP record for this book is available from the Library of Congress Library of Congress catalog card: available Printed and bound in Great Britain by CPI Antony Rowe, Chippenham from camera-ready copy edited and supplied by the author CONTENTS v Contents -

Ulf Martin, John Mcleod Playing the Game: Dreierles
ULF MARTIN, JOHN McLEOD Playing the Game: Dreierles he 2018 IPCS Convention in Leinfelden-Echterdingen and the following days were particularly fruitful for card game research. Not only did we Tenjoy the experience of playing the Württemberg games Gaigel and Binokel with local players during the Convention itself, but we also took the opportunity to learn several other fascinating card games during our subsequent travels in Southwest Germany. In a future article we will write about the various types of Schafkopf we discovered in the Palatinate. Meanwhile this article is devoted to a little-known Tarot game played in Central Baden. The former state of Baden, now part of the Land Baden-Württemberg, is so far as we know the only region in Germany where the tradition of playing games with the Tarot cards has survived. In this region the special 54-card French-suited Tarot pack known as Cego is used. There are two designs – the one most often used is an animal Tarot, but another version with domestic scenes on the trumps, somewhat like the modern French Tarot design, may still occasionally be found. Cego is also the name of the Tarot game most often played with these cards, and it is sometimes described as the “national card game of Baden”. But the same cards are also used for at least two other games. One is Strassenwart, also known as Vier-Anderle, which is not a Tarot game proper. The other is Dreierles (“Dreierle”, “Dreier”), a true Tarot game with some resemblance to Austrian Tapp-Tarock. From a pack made by The existence of Dreierles was already known Jacob, Mannheim, c.1890 to us from an article by Friedrich Schlager1 and it is mentioned in history of Tarot games by Dummett and McLeod2, but until recently we were unsure whether the game had survived, and we had no detailed description of it. -

Catalogue of the Collection of Playing Cards Bequeathed To
CATALOGUE OF THE COLLECTION OF PLAYING CARDS BEQUEATHED TO THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM ; ^ ^4 f BY THE LATE LADY CHAULOTTE SCHREIBER. COMPILED BY FREEMAN M. O'DONOGHUE, F.S.A., ASSISTANT-KEEPER OF PRINTS AND DRAWINGS. Printed by Order of the Trustees. LONDON: LONGMANS & CO., Pateenosteb Eow; B. QUAEITCH, 15, Piccadilly; ASHEE & CO., 13, Bedford Street, Covent Garden; KEGAN PAUL, TEENCH, TEUBNEE & CO., Paternoster House, Charing Cross Eoad; and HENBY FBOWDE, Oxford University Press, Amen Corner. 1901, : ON !?33 LONDON PRINTED BY WILLIAM CLOWES AND SONS, Limited, STAMFORD STREET AND CHARING CROSS. ; PREFACE. The late Lady Charlotte Schreiber formed during her lifetime an extensive collection of the Playing-Cards of various countries, and, dying in 1895, bequeathed the collection to the Trustees of the British Museum. In accordance with the terms of the legacy, all those items were retained which were not strictly duplicates of others already in the Museum, the remainder being returned to the executors. The portion retained constitutes a very important addition to the collection which previously belonged to the department.* The present separate catalogue of the addition to the national collection thus made by Lady C. Schreiber's bequest, has been prepared by Mr. F. M. O'Donoghue, Assistant-Keeper of Prints and Drawings in the Museum, and is published by the Trustees in accordance with an undertaking made on their behalf to the executors of the testatrix when her bequest was accepted. Among the most important items in the collection are, in the Italian section, Mitelli's tarocchino and "II Passa Tempo" packs; Fresehot's cards of Venetian Heraldry, 1707 ; and two interesting Ombre packs, probably executed in Venice, one hand-painted on plates of silver and enclosed in a silver case, the other engraved on brass plates and contained in a case of the same material. -

Florentine Minchiate: the Fool's Journey
CANAL Issue Two / Spring 2018 / The Department of World Languages & Cultures The University of Massachusetts Lowell ______________________________________________________________________________ Florentine Minchiate: The Fool’s Journey ____________________________________________________________CAMERON WALSH “The random conditions presented by a hand of cards are a metaphor for the circumstances one is born into [...]. The playing out of a hand of cards can be seen as a microcosmic reflection of the ever-changing world around us […].” -Timothy Husband, The World in Play: Luxury cards 1430- 1540 (10) Ordinary decks of playing cards that most people are familiar with are made up of 52 cards containing four suits: Spades, Hearts, Diamonds, and Clubs. Additionally, a deck has kings, queens, and jacks as face cards as well as number cards 2 through 10. Instead of a 1, th ere is an ace which has the highest value. There are also two jokers which some times are not used. These modern suits were adopted into tradition from 15th-century French playing cards. Card games were introduced to Europe in approximately the middle of t he 14th century, probably from the Near East through Venice or from the Mamluk sultanate in Egypt through southern Italy, Sicily, or even Spain (Husband). Early card decks in Italy incorporated suits such as Cups ( copper), Swords ( spade), Batons ( gastonia), and Coins ( denari). Playing cards in Germany did not follow any standardized symbolism until the late 15th century when the suits became Acorns ( Eichel), Leafs (Laub), Hearts ( Herz), and Bells ( Schele). Additionally, the number of cards in German decks often varied. CANAL Issue Two / Spring 2018 / The Department of World Languages & Cultures The University of Massachusetts Lowell ______________________________________________________________________________ FIG 1 Bonafacio Bembo Emperor of FIG 2 Dante Alighieri “Divina Commedia” (1st Swords from the Visconti Tarot.