Die Anfänge Der Merowingerherrschaft Am Niederrhein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Terugkeren Naar De Heemkunde-Site Kan Via De Terugknop. U Vindt De Terugknop Bovenin Uw Scherm, Meestal Uiterst Linksboven
Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop. U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven. Noord Brabants Historisch Jaarboek 2003 Paginas 10 tm 52 Gescand en letters via OCR gereconstrueerd, dus kan kleine spelfouten bevatten. Jan Mennen Een Romeinse weg door het Dommelgebied van Tongeren naar Rossum? 0. Vooraf 0.1. Inleiding Speuren naar Romeinse wegen in Noord-Brabant is al een tijd niet meer in de mode. Dat komt omdat er weliswaar veel kan worden verondersteld -en ook daadwerkelijk is verondersteld -maar nooit enig tastbaar bewijs voor een Romeinse weg in Noord-Brabant werd gevonden. Een serieuze poging zo'n weg aannemelijk te maken, werd ruim veertig jaar geleden gedaan door Knippenberg.1 Na felle kritiek hierop van Leenders, die Knippenberg en de zijnen op grond van het gebruik van te schaarse en vage gegevens betichtte van 'wegenbouwerij' en 'lijnentrekkerij', werden geen ernstige pogingen meer ondernomen 2 Toch blijven vele auteurs vermoeden dat er in de Romeinse tijd vanuit Tongeren een doorlopende weg noordwaarts door het Dommelgebied heeft gelopen3 Niet zonder reden, want de opgravingen van de rijke graven in Esch, de villa van Hoogeloon en de tempel van Empel, alsmede het onder- water-onderzoek van de brug (met stenen pijlers) over de Maas bij Cuijk, wIJzen op de aanleg en het onderhoud van wegen en getuigen van meer activiteiten tijdens de Romeinse bezetting dan we tot voor kort in onze provincie voor mogelijk hadden gehouden. De graven van Esch lagen onder grote, zij het lage heuvels van het zogenoemde Tongerse type waarvan er veel in België voorkomen. -

Oorkondenboek Van Noord-Brabant Tot 1312 II
Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 II De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom Eerste stuk (709-1288) Bewerkt door M. Dillo en G.A.M. Van Synghel met medewerking van E.T. van der Vlist Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag / 2000 Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Illustratieverantwoording Schutbladen: kaart van het Hertogdom Brabant-West, uit: G. Mercator en J. Hondius, Atlas ou Representation du monde universel (Amsterdam, 1633). Kaarten- en prentenverzameling van het Rijksarchief in Noord-Brabant, inv.nr. 45. Pagina X: kaart van de situatie van de gemeentelijke indeling op 1 januari 1958. Bron: Provin- ciale Almanak 1969. Copyright: Rijksarchief in Noord-Brabant 1999. ISBN 90-5216-115-1 geb. Eerste band NUGI 641 Gezet en gedrukt door Drukkerij Orientaliste, Herent (België). Gebonden door Callenbach bv, Nijkerk. © 1999 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag. Postbus 90755 • 2509 LT Den Haag • e-mail [email protected] Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. No part of this book may be reproduced in any way whatsoever, without prior written permis- sion from the publisher. Voorwoord Dr. H.P.H. Camps werkte van 1962 tot 1979 aan de editie van het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 (ONB). In 1979 verscheen het eerste deel, met de oorkonden betreffende de Meierij van ’s-Hertogenbosch en de heerlijkheid Gemert. Bij de opzet werd aanvankelijk uitgegaan van één oorkondenboek waarin alle oorkonden die betrekking heb- ben op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant in chronologische volgorde zou- den worden uitgegeven. -

Lanaken En De Vroegste Geschiedenis Van Franken En Merovingen
Lanaken en de vroegste geschiedenis van Franken en Merovingen Jozef Van Loon, KANTL Samenvatting De Limburgse plaatsnaam Lanaken is een historisch gedenkwaardig toponiem. Traditioneel wordt hij verklaard als een naam op -iniaca(s), maar klankwettig is dat onmogelijk. Hetzelfde bezwaar geldt voor talloze Franse toponiemen die met het suffix worden gereconstrueerd. Een nauwkeuriger onderscheiding van de vele varianten die terug- gaan op het Keltische ākos-suffix, maakt het mogelijk deze namen nauwkeuriger te periodiseren, van late prehistorie tot Vroegkarolin- gische tijd. Lanaken zelf is aldus te reconstrueren als *Hluþenakōm, een naamformatie die wellicht uit de tweede eeuw n.C. dateert. Het eerste deel van het toponiem bevat de naam van de Germaanse godin Hluthena, die in de Romeinse tijd vooral werd vereerd in het gebied van de Sugambri, en is tevens het kenmerkende naambestanddeel van de Merovingische dynastie die uit die stam is voortgekomen. Van de oudst bekende naamdrager, Chlodio, wordt aangetoond dat hij voluit Chlodebaudes heette, een naam die alleen voorkomt in enkele genea- logieën die tot nu onbetrouwbaar werden geacht. Het artikel gaat zijdelings ook in op de etymologie van de namen Liedekerke, Luik, Montenaken, Salii, Sinnich, Thüringen en Vicus Helena. Summary A new etymology of the Limburg place-name Lanaken leads to far- reaching conclusions with respect to the descent of the Merovingian dynasty and their Frankish origins. Traditionally, the name Lanaken, like many French place-names in -y, -ies etc., has been seen as containing the Gallo-Roman suffix -iniaca(s). However, this recon- struction runs into problems with the historical sound laws of Dutch and French. -
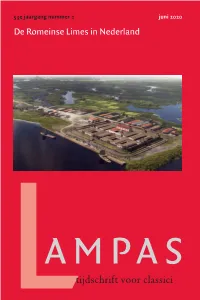
Lampas 20202 Binnenwerk.Indb 113 20-05-2020 08:38 114 Lampas 53 (2020) 2
LAMPAS Inhoud Lampas 53 (2020) 2 53e jaargang nummer 2 juni 2020 De Romeinse Limes in Nederland Stephan Mols en De Romeinse Limes in Nederland 113 Rien Polak Rien Polak De grenzen van het Romeinse Rijk 124 Eenheid in verscheidenheid Marieke van Dinter Limes en landschap 137 De samenhang tussen het landschap en de Romeinse forten in de Rijndelta Christian Kicken De infrastructuur in het gebied van de Neder-Germaanse 146 en Stephan Mols Limes Julia Chorus De forten langs de Rijn in Romeins Nederland 157 Stijn Heeren Van Bataafse auxiliarii naar Frankische foederati 174 Migratie in de archeologie en nieuwe groepen in het grensgebied van Germania secunda Harry van Romeins Nijmegen 194 Enckevort 500 jaar legerplaats en stad Kleurkatern 209 Laura Kooistra Brood en vlees 241 en Maaike Groot De rol van de agrarische samenleving in de limeszone bij de bevoorrading van militairen en burgers Jasper de Bruin Grensgevallen 259 Militaire en civiele gemeenschappen in de Limeszone Marenne Zandstra Culturele diversiteit aan de Neder-Germaanse limes 271 Erik Graafstal en De nieuwe kleren van de keizer? 282 Tom Hazenberg De lange weg naar een aantrekkelijk Werelderfgoed 53 (2020) 2 AMPAS 9 789087 048563 issn 0165-8204 tijdschrift voor classici Lampas 2020-2 omslag.indd 1 L 19-05-2020 15:44 Beknopte auteursinstructies Lampas. Tijdschrift voor classici L A M P A S Uitgebreide auteursinstructies op lampas.verloren.nl. Tijdschrift voor classici 1 Inzending kopij Jaargang 53 nummer 2, juni 2020 Zend uw kopij per e-mail naar: [email protected]. Redactie 2 Omvang dr. Rutger Allan (Grieks, Vrije Universiteit Amsterdam), dr. -

Römische Landnutzung Im Antiken Industrierevier Der Osteifel (RGZM Monographien, Bd. 155)
BIBLIOGRAPHIE QUELLEN Amm.: Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte. II: Buch 18- Varro rust.: M. Terentius Varro, Res rusticae. Gespräche über die 21. Übersetzt von W. Seyfarth. Schr. u. Quellen Alte Welt 21, 2 Landwirtschaft. Buch 1-3. Herausgegeben, eingeleitet und über- (Berlin 1970). setzt von D. Flach. Texte Forsch. 65-67 (Darmstadt 1996, 1997, 2002). Auson. Mos.: D. Magnus Ausonius, Mosella. Kritische Ausgabe, Übersetzung, Kommentar von J. Gruber. Texte und Kommentare Veg. mil.: Publius Flavius Vegetius Renatus, Epitoma rei militaris – 42 (Berlin, Boston 2013). Abriß des Militärwesens. Lateinisch und deutsch. Mit Einleitung, Erläuterung und Indices herausgegeben von Friedhelm L. Müller Colum.: Lucius Iunius Moderatus Columella, Res rustica. Zwölf Bü- (Stuttgart 1997). cher über Landwirtschaft: Lateinisch - deutsch. Hrsg. und übers. Vitr.: M. Vitruvius Pollio, De architectura libri decem. Zehn Bücher von W. Richter. Bd. 1-3 (München 1981, 1982, 1983). über Architektur. Übersetzt und durch Anmerkungen und Zeich- nungen erläutert von F. Reber (Wiesbaden 32015). LITERATUR Abegg 1989a: A. Abegg, Die römischen Grabhügel von Siesbach, Ament 1976: H. Ament, Die fränkischen Grabfunde aus Mayen Kreis Birkenfeld. Trierer Zeitschr. 52, 1989, 171-278. und der Pellenz. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit B 9 (Berlin 1976). 1989b: A. Abegg, Grab 1444. Eine für die 1. Hälfte des 3. Jahr- hunderts n. Chr. charakteristische Bestattung mit Keramikbei- Applebaum 1975: S. Applebaum, Some observations on the econ- gabe. In: A. Haffner (Hrsg.), Gräber – Spiegel des Lebens. Zum omy of the Roman Villa at Bignor, Sussex. Britannia 6, 1975, Toten brauchtum der Kelten und Römer am Beispiel des Treverer- 118-132. Gräberfeldes Wederath-Belginum. Schriftenr. Rhein. Landesmus. Arenillas / Castillo 2003: M. -

Hagiography in the Diocese of Liege (950-1130)
Hagiography in the diocese of Liege (950-1130) by J. R. WEBB INTRODUCTION. 1. THE CITY OF LIEGE. - A. Cathedral St-Lambert. - B. St-]acques. - C. St-Laurent. II. ROMANCE-SPEAKING LANDS. - A. Stavelot-Malmedy. - B. St-Hubert (Andage). - C. Waulsort. - D. Florennes. - E. Brogne. - F. Fosses. - G. No tre-Dame de Huy. - H. Andenne. - 1. St-Aubain de Namur. -]. Gem bloux. - K. Nivelles. III. GERMANIC-SPEAKING LANDS. - A. St-Truiden (St-Trond). - B. Mun- sterbilzen. - D. St-Servatius of Maastricht. - E. St-Odilienberg. CONCLUSION. REPERTOIRE OF TEXTS. BIBLIOGRAPHY. INTRODUCTION It will become clear in what follows why the diocese ofLiege merits specific treatment in this collection. The ecclesiastical in stitutions along the Meuse and its larger vicinity were among the most prolific producers ofhagiography throughout the mid dle ages, and the period roughly encompassing the late tenth to the early twelfth century was no exception. The tenth and eleventh centuries saw the development of Liege into an episcopal principality - its political form that would endure until the French Revolution. Thanks in large part to grants and privileges from the German emperors, the bishops 1 of Liege became the most powerful magnates in the region . Episcopal influence is strongly felt in the hagiography of the 1 On this development, see KURTH, Notger (1905) and KUPPER, Liege (1981). 810 ]. R. WEBB HAGIOGRAPHY IN THE DIOCESE OF LIEGE (950-1130) 811 tenth and eleventh centuries, a significant part of which took earlier bishops as its subjects. Notable and wealthy monasteries, many with foundations dating back to the mid-seventh century, dotted the countryside of the diocese. -

Downloaden Download
Een nieuwe visie op de omvang en indeling van de pagus Hasbania (Vle - Xlle eeuw). door KAREL VERHEISr 1. De pagi van de V• tot de JX• eeuw Toen de Salische koningen in de loop van de V• en het begin van de VI• eeuw door verovering gaandeweg gans Gallië aan hun gezag onderwierpen, namen ze bij het bestuur van hun steeds groter wor dende rijk de bestaande Romeinse civitas-indeling nagenoeg volle dig over. In het zuiden, waar een degelijk uitgebouwde Romeinse administratie gewoon was blijven voortbestaan, werd de civitas als bestuurlijke eenheid behouden. In het noorden daarentegen, waar deze administratie was verdwenen of slechts broksgewijze had stand gehouden, bleek de civitas te omvangrijk voor de primitievere Fran kische bestuursmiddelen en greep er een opdeling plaats van de oor spronkelijke civitas in meerdere kleinere bestuursomschrijvingen, 1 die gebaseerd waren op nederzettingsgebieden • Deze nieuwe Fran kische bestuurseenheden, zowel deze welke rechtstreekse erfgena- • Graag zouden wc prof. cm. Dr. J. Buncinx en docent Dr. J. Goossens willen danken voor hun raadgevingen bij de totstandkoming van dit artikel. •• Volgende afkortingen komen uit de reeks Monumenta Germanille historica: Diplomatum Karolinorum : D.K.D.G. : Dl. I: Pippim; Carlomanm; Caroli Mllgni diplomata, Uitg. E. MUllI.BACHER, München, 1979 2. D.Lol. : Dl. III: Lotharii Iet Lotharii Il diplomata, Uitg. Tu. SCHIEFFER, Bcrlin-Zürich, 1966. Diplomata regum Germanille ex slirpe Karolinorum : D. Arn: Dl. III: Amolfi diplomata, Uitg. P. KEHR, Bcrlin, 1940. D . Zwcnt. : Dl. IV: Zwenliboldi et Ludowici infantü diplomata, Uitg. Tu. SCHIEFFER, Bcr lin, 1960. Diplomata regum et imperatorum Germanille : D.0 .1. -

De Franken Te Dinther Onderzoek Vroege Middeleeuwen Door N.L. Van Dinther © 2019 Capricornus
De Franken te Dinther Onderzoek Vroege Middeleeuwen door N.L. van Dinther © 2019 capricornus Inleiding: Onderzoek te Dinther naar bewoning in de Vroege Middeleeuwen kan niet anders bestudeerd worden dan in de context van een groter gebied, het Rivierengebied het latere “Teisterband” en het stroomgebied van de Dieze, de Dommel, de Aa en de Maas liggend in het gebied aangeduid met het latere “Toxandria/Texandria”.1 Voorblad : Utrechts psalterium, Universiteitsbibliotheek, Reims/Hautvillers, ca. 820-845, Ms 32, fol. 30. 1 Een eerdere versie van de Vroege Middeleeuwen te Dinther in mijn boek: “Dinther in het Aa- Leigraaf-Beekgraaf-Gebied” 2014. 2 Vroege Middeleeuwen in Texandrië:(450-1050 na Chr.) 2 De bevolking in het Maaslandgebied trekt na ca. 250 grotendeels weg. Oorzaken kunnen gezocht worden in het wegtrekken van de Romeinen naar elders waardoor een machtsvacuüm ontstond en waarbij tevens het economisch verlies door het wegvallen van levering van diensten en producten aan de Romeinen een rol kunnen hebben gespeeld. Maar de belangrijkste aanleiding zal vooral zijn het binnenvallen van Germaanse stammen, later bekend onder de verzamelnaam “Franken”. “In de tweede helft van de derde eeuw drong een deel van de Franken, meestal de Saliërs of Salische Franken genoemd, het Romeinse Rijk binnen. Zij vestigden zich in de Scheldemonding en de Midden-Nederlandse rivierendelta. Het doet vermoeden dat zij vooral met schepen het Romeinse gebied zijn binnen gedrongen.”3 Keizer Julianus gaf in 358 een Frankische stam, de Saliërs, toestemming in een gebied, bekend als Texandrië, te blijven wonen. Zij hadden zich daar eerder clandestien gevestigd. Rond 370 had er in de buurt van Deusone een treffen plaats tussen een Romeinse legerafdeling en een groep Saksische plunderaars. -

0Freyssinet Emilie
Université Marc Bloch, Strasbourg II UFR des Sciences Historiques UMR 7044 « Etude des civilisations de l’Antiquité » Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Marc Bloch, Strasbourg II Sciences de l’Antiquité Présentée et soutenue publiquement par Emilie FREYSSINET L’organisation du territoire entre Meuse et Rhin à l’époque romaine Volume I : Texte Sous la direction de Madame Anne-Marie ADAM Professeur à l’Université Marc Bloch, Strasbourg II Jury : Madame Jeanne-Marie DEMAROLLE, Professeur émérite à l’Université de Metz Monsieur Stephan FICHTL, Professeur à l’Université François Rabelais de Tours Monsieur Jean-Yves MARC, Professeur à l’Université Marc Bloch de Strasbourg Monsieur Michel REDDÉ, Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Octobre 2007 1 A l’issue de cette thèse, je souhaiterais exprimer ma très grande reconnaissance à Mme Anne- Marie Adam, pour son soutien constant, sa disponibilité et la pertinence de ses conseils. J’aimerais aussi faire part de cette reconnaissance à Monsieur Stephan Fichtl, pour nos discussions parfois enflammées, ainsi qu’à Madame Jeanne-Marie Demarolle, à Monsieur Jean-Yves Marc et à Monsieur Michel Reddé, pour l’intérêt porté à ce sujet et leur participation au jury. Mes remerciements les plus vifs vont à tous les chercheurs et professionnels de l’archéologie qui m’ont accueillie, conseillée ou aidée, avec grande sympathie : les membres du Service Régional de l’Archéologie en Alsace, particulièrement Emmanuel Pierrez, Georges Triantafillidis, Marie- Dominique Waton, les membres du Service Régional de l’Archéologie en Lorraine, particulièrement Isabelle Clément-Gébus, Murielle Georges-Leroy, et également Gersende Alix, Monsieur Bonnet, Pascal Flotté, Matthieu Fuchs, Gilles Hamm, Gertrud Kuhnle, Matthieu Michler, Suzanne Plouin, Bénédicte Viroulet, Muriel Zehner. -

Frontiers of the Roman Empire – the Lower German Limes
Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes Nomination File for Inscription on the UNESCO World Heritage List Part I – Nomination file Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes Nomination File for Inscription on the UNESCO World Heritage List Netherlands | Germany Acknowledgements Programme manager Tamar Leene Main authors Marinus Polak, Steve Bödecker, Lisa Berger, Marenne Zandstra, Tamar Leene Text contributions Astrid Gerrits, Martijn Goedvolk, Tessa de Groot, Sebastian Held, Peter Henrich, Thomas Otten, Sebastian Ristow, Alfred Schäfer, Jennifer Schamper, Dirk Schmitz, Martin Wieland, Lisa Wouters Additonal support Matthias Angenendt, Sandra Rung, Johanna Steffesthun Final editing Jens Wegmann English correction Nigel Mills Cartography Eugen Rung Design Christoph Duntze Printing LVR-Druckerei, Inklusionsabteilung Many thanks are due to all those involved in the preparation of the nomination, of national and federal govern- ments and institutions, provinces, regional services and municipalities, universities, archaeological contractors, museums and other organisations for public outreach, professionals as well as volunteers, and to the owners of parts of the nominated property and buffer zones. Preface Rome and the huge Empire it built during the first centuries AD extended over vast swathes of Europe, the Near East and North Africa. This Empire has fascinated people since the days of the Enlightenment. In the wake of Rome’s military conquests, Roman culture also spread and began to influence the cultural expressions of the societies it vanquished. These developments, combined with intensive mobility and trade – especially within the Empire – ensured a flourishing exchange between cultures and peoples. When Rome’s expansion came to an end, linear frontiers known as limites were created from the 1st century AD onwards to secure the borders. -
Annaert 2018 Rural Riches & Royal Rags 0.Pdf
Rural riches & royal rags? ‘Rural riches & royal rags? Editorial board Studies on medieval and modern archaeology, presented to Frans Theuws’ Mirjam Kars was introduced to the ins is published on the occasion of the and outs of life, death and burial in the symposium at the University of Leiden, Merovingian period by Frans Theuws as June 29, 2018. supervisor of her PhD thesis. This created a solid base for her further explorations of this This publication was made possible by grants dynamic period. Frans and his Rural Riches from the following persons, institutions and team participate with Mirjam on her work archaeological companies: on the medieval reference collection for Dutch Society for Medieval Archaeology, the Portable Antiquities of the Netherlands Cultural Heritage Agency of the project, which is much appreciated. Netherlands, Familie Van Daalen, University of Amsterdam, Gemeente Maastricht, Roos van Oosten is an assistant professor Tilburg University, Leerstoel Cultuur of urban archaeology in Frans Theuws’ in Brabant, Academie voor Erfgoed chairgroup at Leiden University. She also Brabant, Archol, Diggel Archeologie, worked alongside Frans Theuws (and D. Archaeo (Archeologische advisering en Tys) when he founded the peer-reviewed ondersteuning), Gemeente Veldhoven. journal Medieval Modern Matters (MMM). In addition to undergraduate and graduate © SPA-Uitgevers, Zwolle teaching responsibilities, Van Oosten is in cooperation with the Dutch Society for working on her NWO VENI-funded project Medieval Archaeology, Amsterdam. entitled ‘Challenging the paradigm of filthy and unhealthy medieval towns’. SPA-Uitgevers, Assendorperstraat 174 4, 8012 CE Zwolle, [email protected] Marcus A. Roxburgh is currently at Leiden University working on his PhD research, Text editor: Marcus A. -

Frontiers of the Roman Empire – the Lower German Limes
FRONTIERS OF THE ROMAN EMPIRE – THE LOWER GERMAN LIMES —— NOMINATION FILE FOR INSCRIPTION ON THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST PART I - NOMINATION FILE 1 CONTENTS Executive Summary ................................................................................................................................................. 7 State parties ....................................................................................................................................................... 7 State, Province or Region ................................................................................................................................... 7 Name of Property ............................................................................................................................................... 7 Geographical coordinates to the nearest 10 m .................................................................................................. 7 Textual description of the boundaries of the nominated property ................................................................. 11 Map of the nominated property ...................................................................................................................... 12 Criteria under which property is nominated .................................................................................................... 12 Draft Statement of Outstanding Universal Value ............................................................................................. 14 Name and contact information