Die Machthierarchie Der SED
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Angeregt Durch Die Methode Der Geschwister Scholl« Ein Rückblick Auf Den Eisenberger Kreis Aus Dem Jahre 1965
THOMAS AMMER (EUSKIRCHEN/FLAMERSHEIM) »Angeregt durch die Methode der Geschwister Scholl« Ein Rückblick auf den Eisenberger Kreis aus dem Jahre 1965 Der hier dokumentierte Text zum »Eisenberger Kreis« aus dem Jahr 1965 war ur- sprünglich nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Er sollte Ereignisse, Gedanken- gänge und Zusammenhänge so, wie sie kurz nach Haftentlassung der letzten Mit- glieder des »Eisenberger Kreises« erinnerlich waren, fixieren. Die damalige Zurückhaltung hinsichtlich einer Veröffentlichung hatte zwei Gründe: Die den »Freikauf« vermittelnden Rechtsanwälte Alfred Musiolik und Wolfgang Vogel sowie Mitarbeiter des Bundesministeriums für Gesamtdeutsche Fragen baten die »Freigekauften« dringend, über den »Freikauf« und die Vorgänge, die zu den Ver- haftungen und politischen Prozessen geführt hatten, zu schweigen, da zu be- fürchten sei, dass die DDR die »Freikauf«-Aktion andernfalls beenden würde. An diese Bitte haben sich die meisten der Betroffenen etwa zwei Jahre lang gehalten. Ein zweiter Grund für relatives Stillschweigen in der Öffentlichkeit, damals auch für vollständiges Verschweigen mancher Fakten und Zusammenhänge, war, dass von der Zerschlagung der Gruppe im Jahr 1958 bis zum Zeitpunkt der Frei- lassung der letzten Verurteilten 1964 »nur« sechseinhalb Jahre verstrichen waren und damit zu rechnen war, dass das MfS sich noch immer für den »Eisenberger Kreis« und sein Umfeld interessierte – ein Verdacht, der sich später bei der Durchsicht der MfS-Akten bestätigte. Die Sichtung des äußerst umfangreichen Aktenbestandes des MfS über den »Eisenberger Kreis« brachte vor allem Erkenntnisse über die Zerschlagung der Gruppe und über die Überwachung ihrer Mitglieder bis zum Ende der DDR. Das MfS hat im Zusammenhang mit dem »Eisenberger Kreis« eine solche Menge von Akten produziert, die zudem teilweise weit verstreut sind, dass sie von den Be- troffenen schwerlich jemals vollständig erfasst werden können. -

Nonviolent Struggle and the Revolution in East Germany
Nonviolent Struggle and the Revolution in East Germany Nonviolent Struggle and the Revolution in East Germany Roland Bleiker Monograph Series Number 6 The Albert Einstein Institution Copyright 01993 by Roland Bleiker Printed in the United States of America. Printed on Recycled Paper. The Albert Einstein Institution 1430 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 ISSN 1052-1054 ISBN 1-880813-07-6 CONTENTS Acknowledgments ................... .... ... .. .... ........... .. .. .................. .. .. ... vii Introduction ..............................................................................................1 Chapter 1 A BRIEF HISTORY OF DOMINATION, OPPOSITION, AND REVOLUTION IN EAST GERMANY .............................................. 5 Repression and Dissent before the 1980s...................................... 6 Mass Protests and the Revolution of 1989 .................................... 7 Chapter 2 THE POWER-DEVOLVING POTENTIAL OF NONVIOLENT S"I'RUGGLE................................................................ 10 Draining the System's Energy: The Role of "Exit" ...................... 10 Displaying the Will for Change: The Role of "Voice" ................ 13 Voluntary Servitude and the Power of Agency: Some Theoretical Reflections ..................................................15 Chapter 3 THE MEDIATION OF NONVIOLENT STRUGGLE: COMPLEX POWER RELATIONSHIPS AND THE ENGINEERING OF HEGEMONIC CONSENT ................................21 The Multiple Faces of the SED Power Base ..................................21 Defending Civil -

Doktorarbeit Ges. Veröff. Stand 13.06.2017
Die Deutschlandpolitik der CSU Vom Beginn der sozial-liberalen Koalition 1969 bis zum Ende der Zusammenarbeit mit der DSU 1993 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften der Universität Regensburg vorgelegt von Stephan Oetzinger aus Mantel Regensburg 2016 Gutachter (Betreuer): Prof. Dr. Peter Schmid Gutachter: Prof. Dr. Bernhard Löffler Vorwort Die Umsetzung und Abfassung eines Dissertationsprojekts bedarf vielfältiger Unterstützung. Daher ist es mir eine angenehme Pflicht all jenen zu danken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. An erster Stelle gilt mein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Peter Schmid für die kontinuierliche Betreuung und Begleitung der Arbeit durch zahlreiche Anregungen. Ebenso herzlich danke ich Herrn Prof. Dr. Bernhard Löffler für die Übernahme der Zweitkorrektur. Bedanken möchte ich mich bei der Hanns-Seidel-Stiftung für die Gewährung eines Promotionsstipendiums sowie meinen Eltern, Irmgard und Peter Oetzinger, ohne deren finanzielle Unterstützung die Arbeit an diesem Projekt nicht möglich gewesen wäre. Mein Dank gilt weiterhin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von mir genutzten Archive für die Betreuung. Kraft und Motivation für die abschließende Fertigstellung des Projekts durfte ich bei meiner Familie schöpfen. Insbesondere für die Ermunterung und ihre Rücksichtnahme möchte ich mich daher bei meiner Frau Barbara und unserem Sohn Franz ganz herzlich bedanken, ohne deren Rückhalt das Projekt nicht zu einem guten Ende hätte kommen können. Diese Unterstützung ist von umso größerer Bedeutung, als dass die Arbeit über den größten Teil des Bearbeitungszeitraums berufsbegleitend entstanden ist. Mantel, im Juni 2017 Stephan Oetzinger Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 7 1.1 Hinführung zum Thema 7 1.2 Vorgehensweise 9 1.3 Forschungsstand 10 1.4 Quellenlage 12 2. -

Hochschule & Wissenschaft in SBZ / DDR / Ostdeutschland 1945
Peer Pasternack Hochschule & Wissenschaft in SBZ / DDR / Ostdeutschland 1945 - 1995 Annotierte Bibliographie für den Erscheinungszeitraum 1990 - 1998 SBZ/DDR-Wissenschafts-/Hochschulgeschichte allgemein 5 Inhalt Vorbemerkungen........................................................................................................................ 7 A. Fächerübergreifende Themen / Ostdeutsche Hochschul- und Wissenschaftsentwicklung allgemein .......................................................................... 9 1. SBZ/DDR-Wissenschafts- und -Hochschulgeschichte allgemein .................................... 11 2. Statistik.............................................................................................................................. 47 3. Ostdeutscher Hochschul- und Wissenschaftsumbau 1989ff............................................. 53 3.1. Inhaltliche, personalbezogene und strukturelle Entwicklungen....................................... 53 3.2. Rechtliche Aspekte.......................................................................................................... 104 3.3. Administrative und technische Aspekte.......................................................................... 108 4. Spezielle Aspekte der ostdeutschen Hochschul- und Wissenschaftsentwicklung.......... 139 4.1. Gleichstellungspolitik / Frauenförderung ....................................................................... 139 4.2. Die Studierenden............................................................................................................ -

Transitions from Nazism to Socialism: Grassroots Responses to Punitive and Rehabilitative Measures in Brandenburg, 1945-1952
Transitions from Nazism to Socialism: Grassroots Responses to Punitive and Rehabilitative Measures in Brandenburg, 1945-1952 Doctoral Thesis of Julie Nicole Deering-Kraft University College London PhD in History 1 Declaration I, Julie Nicole Deering-Kraft, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 Abstract This study examines transitions from Nazism to socialism in Brandenburg between 1945 and 1952. It explores the grassroots responses and their relative implications within the context of both punitive and rehabilitative measures implemented by the Soviet Military Administration (SMAD) and the communist Socialist Unity Party of Germany (SED). The present study is based on archival and oral history sources and addresses two main research questions: First, in what ways did people at the grassroots attempt to challenge the imposition of punitive measures, and did their responses have any effect on the manner in which these policies were implemented at a grassroots level? These punitive measures were designed to remove remnants of Nazism and included punitive Soviet practices, Soviet NKVD camps and denazification and sequestering. Second, to what extent did grassroots Brandenburgers participate in political organisations which were designed to integrate East Germans during the rehabilitative stage and what impact did these responses have on the post-war transition? This study focuses on the National Democratic Party and the Society for German-Soviet Friendship as well as examining wider factors which may have impeded and facilitated the processes of post-war transitions. Two main arguments are proposed. -

(SED) Lasts Forty Years in the GDR, and Dissent Is Articulated Against It the Enti
PIcture: Andreas Schoelzel Youth opposition in the German Democratic republic (GDr) The dictatorship of the Socialist Unity Party (SED) lasts forty years in the GDR, and dissent is articulated against it the entire time. Young people searching for guidance and truth confront over and over again the limits set by the regime. Music and litera ture are censored, music bands and writers forbidden; the militarization of the entire society gives the lie to offi cial peace policies; elections are rigged. Whoever desires something else is penalized by the state, arrested, condemned. There are nevertheless people – from the Baltic Sea to the Thuringian Forest, in the cities and in An exhibition of the Robert the co untryside – who resist and stand up for their ideals. Havemann Society and the Federal Foundation for the Reappraisal of It is often young people who take a stand. This exhibition the SED Dictatorship. presents some of the actors who emerged from this great variety of opposition and resistance. arno esch * 1928 † 1951 rno Esch, who has not yet A reached his sixteenth birthday, is drafted into the army in January 1944. After the war his family moves from Memel to Mecklenburg, where Esch begins to study at the Universi Photo Archive Marburg / LA 420915 The University of Rostock around 1950. Arno Esch studies ty of Rostock in 1946. He aspires to law and economics here. In the fall of 1947, at the age of nineteen, he becomes the university advisor of the LPD an academic career, is considered to state organization of Mecklenburg. be extraordinarily talented and very hardworking. -

Politically Divided : a Comparative Analysis of German Right-Wing Extremist Voter Support
University of Louisville ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository Electronic Theses and Dissertations 5-2010 Politically divided : a comparative analysis of German right-wing extremist voter support. Carolyn Marie Morgan University of Louisville Follow this and additional works at: https://ir.library.louisville.edu/etd Recommended Citation Morgan, Carolyn Marie, "Politically divided : a comparative analysis of German right-wing extremist voter support." (2010). Electronic Theses and Dissertations. Paper 1007. https://doi.org/10.18297/etd/1007 This Master's Thesis is brought to you for free and open access by ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. This title appears here courtesy of the author, who has retained all other copyrights. For more information, please contact [email protected]. POLITICALLY DIVIDED: a comparative analysis of German right-wing extremist voter support By Carolyn Marie Morgan B.A., Indiana University Southeast, 2007 A Thesis Submitted to the Faculty of the College of Arts and Sciences of the University of Louisville in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Department of Political Science University of Louisville Louisville, Kentucky May 2010 POLITICALLY DIVIDED: a comparative analysis of German right-wing extremist voter support By Carolyn Marie Morgan B.A., Indiana University Southeast, 2007 A Thesis Approved on April 7, 2010 by the following Thesis Committee: Thesis Director t 1 11 DEDICATION This thesis is dedicated to my parents, who were always supportive and knew I could do anything, even when I had no confidence. -
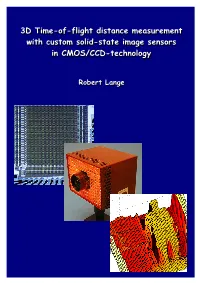
3D Time-Of-Flight Distance Measurement with Custom Solid-State Image Sensors in CMOS/CCD-Technology
3D3D Time-of-flightTime-of-flight distancedistance measurementmeasurement withwith customcustom solid-statesolid-state imageimage sensorssensors inin CMOS/CCD-technologyCMOS/CCD-technology RobertRobert LangeLange 3D Time-of-Flight Distance Measurement with Custom Solid-State Image Sensors in CMOS/CCD-Technology A dissertation submitted to the DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE AT UNIVERSITY OF SIEGEN for the degree of DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCES presented by Dipl.-Ing. Robert Lange born March 20, 1972 accepted on the recommendation of Prof. Dr. R. Schwarte, examiner Prof. Dr. P. Seitz, co-examiner Submission date: June 28, 2000 Date of oral examination: September 8, 2000 To my parents 3D Distanzmessung nach dem „Time-of-Flight“- Verfahren mit kundenspezifischen Halbleiterbildsensoren in CMOS/CCD Technologie VOM FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIK DER UNIVERSITÄT-GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN zur Erlangung des akademischen Grades DOKTOR DER INGENIEURWISSENSCHAFTEN (DR.-ING.) genehmigte Dissertation vorgelegt von Dipl.-Ing. Robert Lange geboren am 20. März 1972 1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. R. Schwarte 2. Gutachter: Prof. Dr. P. Seitz Vorsitzender der Prüfungskommission: Prof. Dr.-Ing H. Roth Tag der Abgabe: 28. Juni 2000 Tag der mündlichen Prüfung: 8. September 2000 Meinen Eltern I Contents Contents .................................................................................................................... I Abstract ....................................................................................................................V -

Liste Aller Mitwirkenden Der Enquete-Kommission 1995-1998
Mitwirkende Personen der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit“(1995-1998), 13. Wahlperiode 1. Abgeordnete Ordentliches Mitglied Stellvertreter CDU/CSU Hartmut Büttner Monika Brudlewsky Rainer Eppelmann (Vorsitzender) Wolfgang Dehnel Hartmut Koschyk (Obmann) Dr.-Ing. Rainer Jork Werner Kuhn Walter Link Johannes Selle Reinhard Frh. von Schorlemer SPD Iris Gleicke Tilo Braune Stephan Hilsberg Reinhold Hiller (seit September 1996) Nicolette Kressl (bis September 1996) Markus Meckel (Obmann) Christine Kurzhals (bis 4. Mai 1998 +) Siegfried Vergin (stellvertretender Vorsitzender) Jörg-Otto Spiller Bündnis 90/ Gerd Poppe (Obmann) Gerald Häfner Die Grünen F.D.P. Prof. Dr. Rainer Ortleb (Obmann) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (seit Feb. 1996) Quelle: Deutscher Bundestag/ Drucksache 13/11000 – Schlußbericht der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit". 1 Prof. Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (bis Feb. 1996) PDS Prof. Dr. Ludwig Elm (Obmann) Rolf Kutzmutz 2. Sachverständige Sachverständige Einrichtung Burrichter, Clemens Senior Fellow am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam Faulenbach, Bernd Prof. Dr. Forschungsinstitut für Arbeiterbildung und Fakultät für Geschichtswissenschaft der Ruhruniversität Bochum Fricke, Karl Wilhelm Dr. Publizist, ehemaliger Leiter der Ost-West- Abteilung des Deutschlandfunks Köln Gutzeit, Martin Theologe, Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Berlin Huber, -
The Structure of Higher Education in the German Democratic Republic
DOCUMENT ISSUE ED 144 476 HE 009 264 AUTHOR , Giles, Geoffrey J. TITLE The Structure of Higher Education in the German Democratic Republic. Yale Higher Education Program Working Paper. INSTITUTION Yale Univ., New.Haven, Conn. Inet. for Social and Policy Studies. SKONS AGENCY Lilly Endowment, Inc., Indianapolis, Ind. REPORTING. YHEP-12 .PUB DATE r Oct 76 NOTE 43p.; Best copy available AVAILABLE FROM Yale University, Institution for Social and Policy Studies,, 16A Yale-Station (111 Prospect Street), New Haven, Connecticut 06520 . EDRS PRICE MF-$0.83 HC-$2.06 Plus Postage. DESCRIPTORS *Administrative Organization; Colleges; College Students; *Comparat-ive Education; Comparative Statistics; •*Educational Supply; *Foreign Countries; Governance; *HigherEducation; Manpower Development; *Po,}itical Influences; Universities .IDENTIFIERS *East Germany ABSTRACT. Postsecondary education in the German Democratic Republic (GDR) is largely' the domain of the Ministry of Higher and Technical Education, which-is responsible both for higher education and for training carried out in the loser- level technical, engineering, and vocational schools. This paper covers the higher education sectr, which has been a major concern to the regime since the- end of World War II. The priorities and administrative organization of the colleges and universities are described, with emphasis on political ramifications. Statistical tables are included on student characteristics. (LBH) YALE UNIVERSITY New Haven, Conn. 06520 THE STRUCTURE OF HIGHER ÉDUCATION IN THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC by Geoffrey J, Giles* YALE HIGHER EDUCATION PROGRAM' WORKING PAPER YHEP-12 October 1976 *Geoffrey J. Giles Research Associate, Program of Comparative and Historical Studies of Higher Education The research reported in this paper has been part.of the Yale Higher Education Program. -

Die-Geheimen-Lager-Der-Stasi
10.01.2019 D R. H U B E R T U S K N A B E Die geheimen Lager der Stasi In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 4/93, S. 23-34. www.hubertus-knabe.de Hubertus Knabe Die geheimen Lager der Stasi Gleichwohl sind die Planungen zum Aufbau von f. Die Maßqahmen der SED Isolierungslagern für Oppositionelle bislang nur in für den Ernstfall Umrissen bekannt, und vor allem - ist niemand I r von den dafür Verantwortlichen rut Rechenschaft gezogen worden. Die Ermittlungen, die noch vom - der DDR eingeleitet wor- Die geplante Errichtung von Gefangenenlagern Militaroberstaatsanwalt verliefen im Sande, nach der deutschen zttr Ausschaltung von Andersdenkenden in der den waren, lehnte der für die Lagerplanungen im DDR gehört zu den Themen, die nach dem Zv' Vereinigung ehemaligen Bezirk Erfurt zuständige Oberstaats- sammenbruch der SED-Herrschaft in der DDR die anwalt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens Öffentlichkeit in besonderer Weise erschüttert ha- ab3. Lediglich im Freistaat Sachsen bemüht sich ben. Hatte die SED tatsächlich vor, Menschen, die ein vom Landtag eingesetzter Untersuchungsaus- als kritisch oder unzuverlässig eingestuft wurden, schuß für Amts- und Machtmißbrauch um eine in Spannungsperioden zu Tausenden in Lagetn za Klärunga, ähnliches strebt ein Ausschuß im Kreis konzentrieren und dort womöglich sogar umzu- - Nordhausen Darüber hinaus hat sich eine bringen? Hinweise auf solche Planungen wurden all. von Antragstellern an den Bundesbeauf- zum erstenmal in den Wochen des Umbruchs in Reihe tragten frir die Unterlagen des Staatssicherheits' der DDR bekannt; in verschiedenen Orten - so in dienstes gewandt und um die Bereitstellung von Worbis und in Grimmen - stieß man in der Folge- diesbezüglichem Aktenmaterial aus den Archiven zeitauf Übersichten mit den Namen von Personen, des gebeten. -
Bericht Der Enquete-Kommission „Aufarbeitung Von Geschichte Und Folgen Der SED-Diktatur in Deutschland" (Drucksache 12
Deutscher Bundestag Drucksache 12/7820 12. Wahlperiode 31. 05. 94 Bericht der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland" gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages vom 12. März 1992 und vom 20. Mai 1992 — Drucksachen 12/2330, 12/2597 — Inhaltsübersicht Seite Vorwort 5 A. Auftrag und Durchführung der Kommissionsarbeit 7 I. Entstehung und Aufgabenstellung der Kommission 7 II. Arbeitsweise der Kommission 10 III. Zusammensetzung der Kommission 12 B. Themenfelder 15 I. Themenfeld: Machtstrukturen und Entscheidungsmechanismen im SED-Staat und die Frage der Verantwortung 15 a) Beratungsverlauf 15 b) Bericht 18 1. Konstituierung der Diktatur und ihre Rahmenbedingungen 1945-1949 18 2. Die Machthierarchie der SED — die Verquickung von Partei-, Regierungs- und Staatsapparat 21 3. Die SED und das Ministerium für Staatssicherheit 27 4. Rolle und Funktion von Blockparteien und Massenorganisatio- nen 30 Sondervotum 34 5. Umgestaltung und Instrumentalisierung der Wirtschaft 37 6. Die Medien als Herrschaftsinstrument der SED 39 7. Militarisierung der Gesellschaft und die Rolle der „bewaffneten Organe" 40 8. Schluß 41 Drucksache 12/7820 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode Seite II. Themenfeld: Rolle und Bedeutung der Ideologie, integra tiver Fakto- ren und disziplinierender Praktiken in Staat und Gesellschaft der DDR 43 a) Beratungsverlauf 44 b) Bericht 47 Vorbemerkung 47 1. Rolle und Bedeutung der Ideologie des Marxismus-Leninis- mus 47 Sondervotum 48 2. Die soziale Umgestaltung in der SBZ/DDR 54 Sondervotum 56 3. Frauen- und Familienpolitik 57 4. Stellenwert und Mißbrauch von Erziehung und Bildung 62 5. Rolle und Funktion der Wissenschaft im SED-Staat 68 Sondervotum 73 6. Kulturpolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit 74 7.