Nationale Literaturen Heute – Ein Fantom?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
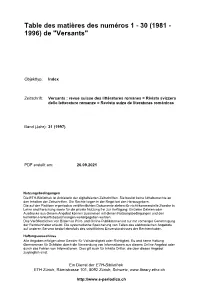
Table Des Matières Des Numéros 1 - 30 (1981 - 1996) De "Versants"
Table des matières des numéros 1 - 30 (1981 - 1996) de "Versants" Objekttyp: Index Zeitschrift: Versants : revue suisse des littératures romanes = Rivista svizzera delle letterature romanze = Revista suiza de literaturas románicas Band (Jahr): 31 (1997) PDF erstellt am: 26.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch TABLE DES MATIERES DES NUMÉROS 1-30 (1981-1996) DE VERSANTS Cette table des matières se divise en deux sections; dans la première, sont répertoriés tous les articles parus dans les numéros 1-30, classés par discipline et par nom d'auteur; la deuxième section comprend la liste des numéros thématiques. -

The Surreal Voice in Milan's Itinerant Poetics: Delio Tessa to Franco Loi
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Dissertations, Theses, and Capstone Projects CUNY Graduate Center 2-2021 The Surreal Voice in Milan's Itinerant Poetics: Delio Tessa to Franco Loi Jason Collins The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/4143 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] THE SURREALIST VOICE IN MILAN’S ITINERANT POETICS: DELIO TESSA TO FRANCO LOI by JASON M. COLLINS A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Comparative Literature in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2021 i © 2021 JASON M. COLLINS All Rights Reserved ii The Surreal Voice in Milan’s Itinerant Poetics: Delio Tessa to Franco Loi by Jason M. Collins This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Comparative Literature in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy _________________ ____________Paolo Fasoli___________ Date Chair of Examining Committee _________________ ____________Giancarlo Lombardi_____ Date Executive Officer Supervisory Committee Paolo Fasoli André Aciman Hermann Haller THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT The Surreal Voice in Milan’s Itinerant Poetics: Delio Tessa to Franco Loi by Jason M. Collins Advisor: Paolo Fasoli Over the course of Italy’s linguistic history, dialect literature has evolved a s a genre unto itself. -

F O Gli 35 /2014
Fogli Biblioteca Salita dei Frati di Lugano Rivista dell’Associazione Contributi Mario Botta, Biblioteche [p. 1] / Marina Bernasconi Reusser, Laura Luraschi Barro, Luciana Pedroia, La biblioteca della Madonna del Sasso di Locarno-Orselina. Note su un progetto in corso [p. 4] / Theo Mäusli, Archivi radiotelevisivi come memoria 3 5 /2014 collettiva [p. 24] / Rromir Imami, Un progetto per avvi- cinare il pubblico ai manoscritti: da e-codices a Flickr [p. 31] / Per Giovanni Pozzi Fabio Soldini, Giovanni Pozzi e Giorgio Orelli lettori reciproci. Testimonianze epistolari [p. 39] /Rara et curiosa Fabio Soldini, Due rari opuscoli goldoniani del 1760 [p. 59] / In biblioteca Enrico Tallone, Con i Manuali talloniani nella foresta di caratteri, carte e inchiostri [p. 64] / Fernando Lepori, Incontri in biblioteca [p. 72] / Alessandro Soldini, Le esposizioni nel porticato della biblioteca [p. 77] / Cronaca sociale Relazione del Comitato [p. 83] / Conti [p. 90]/ Nuove accessioni Pubblicazioni entrate in biblioteca nel 2013 [p. 92] Fogli Progetto grafico Rivista dell’Associazione Marco Zürcher Biblioteca Salita dei studio CCRZ, Balerna Frati di Lugano. Esce di www.ccrz.ch regola una volta all’anno; Impaginazione ogni fascicolo costa Marina Barbieri 7 franchi; ai membri dell’Associazione è Stampa e confezione inviato gratuitamente. Progetto Stampa, Chiasso È consultabile sul sito Carte www.fogli.ch Rives Vergé, 220 e 120 g/m2 Munken Lynx, 80 g/m2 ISSN Tiratura Edizione stampata: 1’200 copie 2235-4697 Edizione online: In copertina 2235-5189 Lettera autografa -

Das Schweizerische Verlagswesen : Eine Geschichte Kleiner Verlage
Das schweizerische Verlagswesen : eine Geschichte kleiner Verlage Autor(en): Oprecht, Peter Objekttyp: Article Zeitschrift: Medienwissenschaft Schweiz = Science des mass média Suisse Band (Jahr): - (1994) Heft 1 PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-790837 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Peter Oprecht Das Schweizerische Verlagswesen - eine Geschichte kleiner Verlage Der ehemalige Präsident des Schweizerischen Buchhändler- und Verleger-Verbands SBW skizziert in seinem Beitrag detail- und kenntnisreich die Geschichte des Schweizerischen Verlagswesens, stellt sich die Frage, was denn ein «Kleinverlag» überhaupt ist, diskutiert dessen Vor- und Nachteile undformuliert einige Anregungen zur Verbesserung der Lage der schweizerischen Kleinverlage. -

Maurizio Basili Ultimissimo
Le tesi Portaparole © Portaparole 00178 Roma Via Tropea, 35 Tel 06 90286666 www.portaparole.it [email protected] isbn 978-88-97539-32-2 1a edizione gennaio 2014 Stampa Ebod / Milano 2 Maurizio Basili La Letteratura Svizzera dal 1945 ai giorni nostri 3 Ringrazio la Professoressa Elisabetta Sibilio per aver sempre seguito e incoraggiato la mia ricerca, per i consigli e le osservazioni indispensabili alla stesura del presente lavoro. Ringrazio Anna Fattori per la gratificante stima accordatami e per il costante sostegno intellettuale e morale senza il quale non sarei mai riuscito a portare a termine questo mio lavoro. Ringrazio Rosella Tinaburri, Micaela Latini e gli altri studiosi per tutti i consigli su aspetti particolari della ricerca. Ringrazio infine tutti coloro che, pur non avendo a che fare direttamente con il libro, hanno attraversato la vita dell’autore infondendo coraggio. 4 INDICE CAPITOLO PRIMO SULL’ESISTENZA DI UNA LETTERATURA SVIZZERA 11 1.1 Contro una letteratura svizzera 13 1.2 Per una letteratura svizzera 23 1.3 Sull’esistenza di un “canone elvetico” 35 1.4 Quattro lingue, una nazione 45 1.4.1 Caratteristiche dello Schweizerdeutsch 46 1.4.2 Il francese parlato in Svizzera 50 1.4.3 L’italiano del Ticino e dei Grigioni 55 1.4.4 Il romancio: lingua o dialetto? 59 1.4.5 La traduzione all’interno della Svizzera 61 - La traduzione in Romandia 62 - La traduzione nella Svizzera tedesca 67 - Traduzione e Svizzera italiana 69 - Iniziative a favore della traduzione 71 CAPITOLO SECONDO IL RAPPORTO TRA PATRIA E INTELLETTUALI 77 2.1 Gli intellettuali e la madrepatria 79 2.2 La ristrettezza elvetica e le sue conseguenze 83 2.3 Personaggi in fuga: 2.3.1 L’interiorità 102 2.3.2 L’altrove 111 2.4 Scrittori all’estero: 2.4.1 Il viaggio a Roma 120 2.4.2 Parigi e gli intellettuali svizzeri 129 2.4.3 La Berlino degli elvetici 137 2.5 Letteratura di viaggio. -

2195. Erlebte Landschaft : Die Heimat Im Denken Und Dasein Der Schweizer : Eine Landeskundliche Anthologie / Von Emil Egli.-- Artemis; 1961.,943:E1:1
2195. Erlebte Landschaft : die Heimat im Denken und Dasein der Schweizer : eine landeskundliche Anthologie / von Emil Egli.-- Artemis; 1961.,943:E1:1 2196. Erlebter Aktivdienst, 1939-1945 : Auszuge aus dem Tagebuch eines Angehorigen der Fliegertruppen / Ernst Frei.-- 3. Aufl.-- Novalis; 2000, c1998.,2343:F12:1 2197. Erlenbuel : Roman / Meinrad Inglin.-- Atlantis; c1965.,946:I1:14 2198. Erlosungsvorstellungen und ihre psychologischen Aspekte / Hans Schar.-- Rascher; 1950.-- (Studien aus dem C.G. Jung- Institut ; 2).,140:S1:1 2199. Ernest Ansermet : 1883-1969 : [catalogue de l'exposition Ernest Ansermet / organisee a l'occasion du centenaire de la naissance du chef d'orchestre ; publie sous la direction de Jean-Louis Mathey ; texte de liaison de Jean-Jacques Rapin ; preface de Rene Schenker].-- Bibliotheque cantonale et universitaire, Association Ernest Ansermet; 1983.,760:M3:1 2200. Ernest Ansermet : une vie en images / dessinee par Gea Augsbourg ; commentee par Paul Budry et Romain Goldron . Suivie d'un texte original d'Ernest Ansermet, Le geste du chef d'orchestre.-- Delachaux et Nestle; c1965.,760:B4:1 2201. Erni vom Melchi : Roman / R. Kuchler-Ming.-- Eugen Rentsch; c1948.,946:K6:1 2202. Ernst Gagliardi 1882-1940 : sein Leben und Wirken / Georg Hoffmann.-- O. Fussli; c1943.,2345:H6:1 2203. Ernst Kreidorf : der Maler und Dichter / von Jakob Otto Kehrli.-- P. Haupt; c1949.-- (Schweizer Heimatbucher ; Nr. 28/29).,703:K1:1 2204. Ernst Nobs : vom Burgerschreck zum Bundesrat : ein politisches Leben / Tobias Kastli.-- Orell Fussli; c1995.,310:K13:1 2205. Eros, die subtile Energie : Studie zur anthropologischen Psychologie des zwischenmenschlichen Potentials / Annie Berner-Hurbin.-- Schwabe; 1989.,140:B7:1 2206. -

ISSN 1661-8211 | 117. Jahrgang | 31. Juli 2017
2017/14 ISSN 1661-8211 | 117. Jahrgang | 31. Juli 2017 Redaktion und Herausgeberin: Schweizerische Nationalbibliothek NB, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern Erscheinungsweise: halbmonatlich, am 15. und 30. jeden Monats Hinweise unter: http://ead.nb.admin.ch/web/sb-pdf/ ISSN 1661-8211 © Schweizerische Nationalbibliothek NB, CH-3003 Bern. Alle Rechte vorbehalten Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Sommario - Cuntegn - Table of contents Inhaltsverzeichnis - Table des matières - 300 Sozialwissenschaften, Soziologie / Sciences sociales, Sommario - Cuntegn - Table of contents sociologie / Scienze sociali, sociologia / Scienzas socialas, sociologia / Social sciences, sociology.........................................11 310 Allgemeine Statistiken / Statistiques générales / Raccolte di 000 Allgemeine Werke, Informatik, statistiche generali / Statistica generala / Collections of general Informationswissenschaft / Informatique, information, statistics......................................................................................... 13 ouvrages de référence / Informatica, scienza dell'informazione, generalità / Informatica, infurmaziun e 320 Politikwissenschaft / Science politique / Scienza politica / referenzas generalas / Computers, information and general Politica / Political science.............................................................14 ........................................................................................ 1 reference 330 Wirtschaft / Economie politique / Economia / Economia / Economics.................................................................................... -

Sur La Route… Auf Der Strasse… Reflets D’Un Été 2015 En Valais, Entre Poésie Et Vagabondages
Sur la route… Auf der Strasse… Reflets d’un été 2015 en Valais, entre poésie et vagabondages 1 2 3 Sur la route… Auf der Strasse… Reflets d’un été 2015 en Valais, entre poésie et vagabondages Un projet porté par La Compagnie les Planches & les Nuages Ouvrage réalisé dans la continuité du projet « Sur la route... / Auf der Strasse... » qui s’est déroulé de mai à septembre 2015 dans le cadre des festivi- tés organisées pour la commémoration du Bicentenaire du Canton du Valais. Imprimé en août 2016 par onlineprinters.ch Mise en page : Damien Richard Photographies : © Cie Les Planches et les Nuages - Damien Richard © Tous droits réservés aux éditeurs et ayant-droits mentionnés au bas de chaque extrait © 2016, Cie Les Planches et les Nuages pour l’ensemble du volume ISBN : 978-2-8399-1945-6 http://www.cie-planches-nuages.net 4 5 « Il suffisait que j’introduise mes pas dans les bois pour écouter, sur les épicéas et les mélèzes, l’appel des mésanges bleues. Je recopiais les oiseaux avec des mots. » Raymond Farquet - Les jours s’en vont, je demeure - éditions de l’Aire - 2012 à Raymond Farquet, à qui nous aurions aimé offrir cet ouvrage... 6 7 littéraire actifs ici, partagent avec nous cette ambition. La Compagnie va plus loin encore en faisant en sorte que son projet infuse dans des endroits inhabituels et auprès de partenaires pour qui c’est une occasion de découvrir la richesse et l’exigence de la création artistique : entrepreneur de bus, officier de l’armée suisse, hôtelier, etc. -

Aus Der Sicht Welscher Schriftsteller
Heimat : aus der Sicht welscher Schriftsteller Autor(en): Fringeli, Dieter Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur Band (Jahr): 72 (1992) Heft 7-8 PDF erstellt am: 30.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-165038 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Dieter Fringeli Heimat - aus der Sicht welscher Schriftsteller Je mehr darüber geschrieben, gestritten und gelächelt wird-kein Autor, der nicht den eigenen Definitionsversuch unternommen hätte! -. um so verschwommener, nebliger wird die Landschaft, die Gegend, die «Heimat» sein möchte, wortgewordenes, gelobtes Herkommen. Das Thema» lässt sich mit allen Mutmassungen. -

Indice V Prefazione Di Roger Francillon 3 Avvertenza 7 Introduzione 25 Anelito Preromantico Gli Esordi Lirici in Lingua Tedesca
Indice V Prefazione di Roger Francillon 3 Avvertenza 7 Introduzione 25 Anelito preromantico Gli esordi lirici in lingua tedesca 27 Albrecht von Haller 31 Salomon Gessner 35 Lo spirito e la terra Il cosmopolitismo nella letteratura romanda fra sette e ottocento 39 Isabelle de Charrière 43 Germaine de Staël 47 Benjamin Constant 53 Charles-Victor de Bonstetten 56 Henri-Frédéric Amiel 59 Liberi e svizzeri Scrittori politici di lingua italiana 62 Vincenzo Dalberti 65 Stefano Franscini 69 Chimere dell’assoluto Narrativa svizzera tedesca dell’ottocento 72 Jeremias Gotthelf 84 Gottfried Keller 99 Conrad Ferdinand Meyer 111 Cari Spitteler 117 Rinascita di un’identità La letteratura retoromancia 121 Giachen Caspar Muoth 123 Peider Lansel 127 Idilli lacustri e montani Residui ottocenteschi nella narrativa svizzera italiana 129 Francesco Chiesa 135 Angelo Nessi 139 Giuseppe Zoppi 143 Tra simbolo e realtà La letteratura romanda agli esordi del novecento 146 Charles-Ferdinand Ramuz 155 Gonzague de Reynold 159 Guy de Pourtalès 162 Charles-Albert Cingria 165 Denis de Rougemont 169 Heimatlose Narrativa e poesia svizzere tedesche d’inizio novecento, fra critica sociale e straniamento 171 Jakob Bührer 175 Rudolf Jakob Humm 179 Kurt Guggenheim 183 Meinrad Inglin 188 Ludwig Hohl 192 Hermann Hesse 203 Robert Walser 214 Jakob Schaffner 218 Friedrich Glauser 225 Karl Stamm 227 Basta con le pannocchie al sole Poesia e prosa nella Svizzera italiana dagli anni quaranta 229 Pino Bernasconi 231 Felice Menghini 233 Remo Fasani 236 Amleto Pedroli 239 Ugo Canonica 243 -

Vision De La Suisse Chez Trois Romanciers
Vision de la Suisse chez trois romanciers Autor(en): Francillon, Roger Objekttyp: Article Zeitschrift: Versants : revue suisse des littératures romanes = Rivista svizzera delle letterature romanze = Revista suiza de literaturas románicas Band (Jahr): 34 (1998) PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-265668 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, -

LIT(T)ERA Tour De Suisse 2
Passim Passim 10 | 2012 Bollettino dell’Archivio svizzero di letteratura | Bulletin des Archives littéraires suisses | Bulletin des Schweizerischen Literaturarchivs | Bulletin da l’Archiv svizzer da litteratura LIT(T)ERA Tour de Suisse 2 Editorial lɪtəʀ aˈtuːɐ ̯/ liteʀatyʀ. Heureux croisement sémantique que celui induit par la petite musique du mot utilisé pour désigner l’objet de nos travaux, passions, études… Alors que le terme germanophone renvoie de manière onirique à un Tour au pays des Lettres (Litera-Tour) , son alter ego francophone suggère aux lecteurs de Goethe l’image d’une Porte que l’on s’empresserait d’ouvrir pour découvrir des trésors cachés (Littéra-Tür). Or c’est bien à un voyage que nous souhaitons vous convier dans ce nouveau numéro de Passim , voyage durant lequel vous serez amenés à franchir virtuellement les portes des différentes institutions responsables de la conservation et de la mise en valeur d’archives littéraires contemporaines. Pas moins de vingt institutions, provenant des quatre régions linguistiques, vous accueillent pour vous conter leur histoire, vous expliquer leur mission et vous présenter leurs fonds littéraires et leurs diverses activités. Die Bezeichnung LITERA verweist überdies auf das internationale Kompetenz-Netzwerk KOOP-LITERA von Institutionen, die moderne Nachlässe und Autographen aufbewahren. Auf Initiative des Schweizerischen Literaturarchivs wurde 2010 die nationale Plattform «KOOP-LITERA Schweiz» ins Leben gerufen ( http://www.onb.ac.at/koop- litera/start-schweiz.html ), mit dem Ziel, ein fachliches Forum für Passim 10 | 2012 Diskussionen und gegenseitigen Austausch zu bieten. Bulletin des Archives littéraires suisses | Bulletin des Schweizerischen Literaturarchivs | Am letztjährigen Treffen von KOOP-LITERA entstand auch die Idee, eine Bulletin da l’Archiv svizzer da literarische Landkarte nationaler Sammelinstitutionen insbesondere für litteratura | Bollettino dell’Archivio Bestände aus dem 20.