Temeswarer Beiträge Zur Germanistik Sind in Internationalen Datenbanken (ZDB, BDSL, Gin, SCIPIO, BASE, EZB, MLA, BLLDB U
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Das 20. Jahrhundert 239
Das 20. Jahrhundert 239 Autographen, Widmungsexemplare sowie andere Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 239 D Verlag und A Autographen, Widmungsexemplare S Antiquariat sowie andere Neueingänge 2 Frank 0. J Albrecht A Inhalt H R Autographen .................................................................... 1 H Widmungsexemplare und andere Neueingänge ........... 15 69198 Schriesheim U Register ......................................................................... 28 Mozartstr. 62 N Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T Die Abbildung auf dem Vorderdeckel zeigt den Einband von Walter Trier USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 zu Erich Kästner (Katalognr. 190). A S 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica E Unser komplettes Angebot im Internet: Kinder- und Jugendbuch http://www.antiquariat.com Kulturgeschichte R Kunst T Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde D Sekundärliteratur und Bibliographien A S Geschäftsbedingungen Gegründet 1985 2 0. Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- J ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro Mitglied im A (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht P.E.N.International nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf und im Verband H Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es Deutscher Antiquare R besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- H lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § U 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- Sparkasse Heidelberg N gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert. -

Deutsche Aphorismen Des 20. Jahrhunderts
Inhalt Der Aphorismus in Deutschland nach der Jahrhundertwende...................................................4 Emanuel Wertheimer 5, Ernst Hohenemser 8, Emil Gött 11, Arno Nadel 14, Walther Rathenau 16, Heinrich Gerland 18, Christian Morgenstern 19, Peter Hille 24, Isolde Kurz 26 Der österreichische Aphorismus nach der Jahrhundertwende.................................................27 Wilhelm Fischer 28, Richard Münzer 30, Otto Weiß 32, Karl Kraus 35, Peter Altenberg 41, Otto Stoessl 43, Carl Dallago 45, Alfred Grünewald 46 Der expressionistische Aphorismus..........................................................................................48 Rudolf Leonhard 49, Kurt Hiller 52, Franz Marc 54, Walter Serner 55 Der österreichische Aphorismus der zwanziger und dreißiger Jahre......................................57 Egon Friedell 58, Hugo von Hofmannsthal 60, Arthur Schnitzler 64, Richard von Schaukal 68, Rosa Mayreder 71, Franz Kafka 73, Robert Musil 77 Der Aphorismus in der Weimarer Republik..............................................................................78 Rudolf Alexander Schröder 79, Wilhelm von Scholz 82, Moritz Heimann 84, Friedrich Kayssler 85, Gerhart Hauptmann 86, Otto Michel 88, Kurt Tucholsky 89 Aphorismus und Spruch im Dritten Reich.................................................................................91 Ernst Bertram 92, Richard Benz 95, Theodor Haecker 97 Aphorismus und Exil.................................................................................................................99 Franz -

Michiel De Ruyter in Der Ungarischen Erinnerung
ERINNERUNGSORTE IM SPANNUNGSFELD UNTERSCHIEDLICHER GEDÄCHTNISSE: GALEERENSKLAVEREI UND 1848 Herausgegeben von Pál S. Varga – Karl Katschthaler – Miklós Takács LOCI MEMORIAE HUNGARICAE 4. HeRAUSGEGEBEN VON Gergely Tamás Fazakas, Orsolya Száraz, Miklós Takács és Pál S. Varga Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848 Herausgegeben von Pál S. Varga – Karl Katschthaler – Miklós Takács Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press 2016 Dieser Band wurde durch die Forschungsgruppe für ungarische Erinnerungsorte, die an der Universität Debrecen am Institut für ungarische Literatur- und Kulturwissenschaft tätig ist, im Rahmen der Ausschreibung K 112335 des Ungarischen Wissenschaftlichen Forschungsfonds (OTKA) gefördert. Der Druck wurde vom ungarischen Nationalen Kulturfonds (Nemzeti Kulturális Alap) und der Gedenkkommission Reformation gefördert. Lektoriert von István Bitskey, Eszter Pabis und Peter Stachel Das Namenregister wurde von Evelin Farkas zusammengestellt. Auf dem Umschlag sind Fotos von dem Denkmal der Galeerensklaven (1895, Gedenkgarten, Debrecen) und dem Denkmal von József Nagysándor abgebildet. ISSN 2064-549X ISBN 978-963-318-617-6 © Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is Kiadta a Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press www. dupress.hu Felelős kiadó: Karácsony Gyöngyi Műszaki szerkesztő: M. Szabó Monika Készült a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzemében, 2016-ban Inhalt Vorwort (Miklós -

Das 20. Jahrhundert 215
Das 20. Jahrhundert 215 Ein Jahrhundert im Rückblick. Teil XVIII: 1975-1980 sowie Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 215 D Verlag und A Ein Jahrhundert im Rückblick S Antiquariat Teil XVIII: 1975-1980 2 sowie Neueingänge 0. Frank J A Albrecht H Inhalt R H 1975 .............................................................................. 1 69198 Schriesheim U 1976 .............................................................................. 7 Mozartstr. 62 1977 ............................................................................ 14 N 1978 ............................................................................ 20 Tel.: 06203/65713 D 1979 ............................................................................ 24 FAX: 06203/65311 E 1980 ............................................................................ 29 Email: R Neueingänge ................................................................ 36 [email protected] T Register ....................................................................... 40 USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 A Die Abbildung auf dem Vorderdeckel S zeigt eine Farblithographie von Juan Miró aus 2 Katalognr. 368. 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Kunst T Unser komplettes Angebot im Internet: Politik und Zeitgeschichte http://www.antiquariat.com -
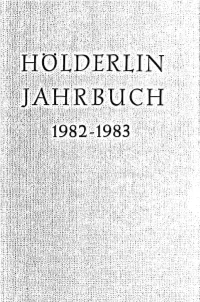
Ecics 32.Pdf
HOLDERLIN-JAHRBUCH Begründetvon FriedrichBeißner ttnd Paul Klttckhohn Im Auftrag der Hölderlin-Gesellschaft heramgegebenvon BernhardBöschenstein und GerhardKurz Dreiundzwanzigster Band 1982-1983 J.C.B.MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN Gedruckt mit Hilfe der Gesdiwister Boehringer Ingelheun· St"f •• • • 1 tung fur Ge1stesw1ssensdiaften in Ingelheim am Rhein. Inhalt Redaktionelle Mitarbeit: Marita Keilson-Lauritz Vorträge und Abhandlungen Gedenkrede auf Adolf Beck. Von Ulrich Fülleborn 1 Hölderlins Verskunst. Von Wolfgang Binder . 10 Hölderlins poetische Sprache. Von Gerhard Kurz 34 Hölderlin-Rezeption in der Nachfolgi; Nietzsches - Stationen der Aneig- nung eines Dichters. Von Gunter Martens . 54 Die Rheinhymne und ihr Pindarisches Modell. Struktur und Konzeption von Pythien 3 in Hölderlins Aneignung. Von Albrecht Seifert 79 Robert Walser über Hölderlin. Von Hans Dieter Zimmermann 134 Hölderlin und Celan. Von Bernhard Böschenstein 147 Die Königszäsur. Zu Hölderlins Gegenwart in Celans Gedicht. Von Klaus Manger . 156 Von Hölderlin getroffen. Von Albrecht Goes 166 Hölderlin 1944. Von Stephan Hermlin . 172 Die Gegenwärtigkeit Hölderlins. Von Hans-Georg Gadamer 178 Sobria ebrietas. Hölderlins 'Hälfte des Lebens'. Von Jochen Schmidt 182 ,,Jedes Lieblose ist Gewalt". Der junge Hegel, Hölderlin und die Dialek- tik der Aufklärung. Von Christoph Jamme ........ 191 Zeitgeschichtliche Hintergründe der 'Empedokles'-Fragmente Hölderlins. Von Christoph Prigni tz . 229 © J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1983 Dokumentarisches Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags ist es auch nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen. Zu Hölderlins Reise nach Bordeaux. Von Pierre Bertaux 258 Printed in Germany Satz und Druck: Laupp & Göbel, Tübingen Instrumentarien der Hölderlin-Philologie. Von Ute Oelmann, Hans Einband: Großbuchbinderei Heinr. Koch, Tübingen Otto Horch und Maria Kohler 261 ISBN 3-16-944706-8 Hölderlin in der Schule. -
House Programme
swire-1213-hpad-newlogo=v10a-op.pdf 1 1/11/12 12:21 PM C M Y CM MY CY CMY K 2 swire-1213-hpad-newlogo=v10a-op.pdf 1 1/11/12 12:21 PM C M Y CM MY CY CMY K 3 VAN ZWEDEN THE EIGHTH MUSIC DIRECTOR OF THE HONG KONG PHILHARMONIC 香港管弦樂團第八任音樂總監 1 Musical America’s Conductor of the Year for 2012 《音樂美國》二零一二年度指揮家 2 The youngest Concertmaster ever of the Royal Concertgebouw Orchestra 荷蘭皇家音樂廳樂團史上最年輕團長 3 Music Director of the Dallas Symphony Orchestra 達拉斯交響樂團音樂總監 4 Works regularly with the Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic, London Philharmonic, Orchestre de Paris and the Royal Concertgebouw Orchestra. Recently conducted the Berlin Philharmonic. 與芝加哥交響樂團、克里夫蘭管弦樂團、費城管弦樂團、紐約愛樂、 倫敦愛樂、巴黎樂團及荷蘭皇家音樂廳樂團合作。最近受邀指揮 柏林愛樂樂團。 ”The orchestra (HK Phil) responded to van Zweden’s grip on the soul of the piece with an impressively disciplined performance.” Sam OLLUVER, SOUTH CHINA MORNING POST ﹝梵志:清淨之志,登:達到﹞ 志 登 ”The orchestra (HK Phil) responded to van Zweden’s grip on the soul of the piece with an impressively disciplined performance.” Sam OLLUVER, SOUTH CHINA MORNING POST bugsbunny-hpad-op.pdf 1 23/12/13 11:31 AM C M Y CM MY CY CMY K Everyone at the Hong Kong Philharmonic wishes you a happy and wonderful New Year. It is now a well-established tradition at the HK Phil to celebrate the ending of one year and the beginning of the next with a concert featuring the light, joyous dances by members of the Strauss family. In recent years we have spiced up this heady cocktail of waltzes, polkas and quadrilles with music from other composers, often from other lands and from other eras. -

Autographen-Auktion 1
AUTOGRAPHEN-AUKTION 1. April 2006 47807 Krefeld, Steinrath 10 Los 1581 Sigmund Freud Axel Schmolt Autographen-Auktionen 47807 Krefeld Steinrath 10 Telefon 02151-93 10 90 Telefax 02151-93 10 9 99 E-Mail: [email protected] AUTOGRAPHEN-AUKTION Inhaltsverzeichnis Los-Nr. ! Geschichte - Bayern - Haus Wittelsbach 1 - 6 - Deutsche Geschichte ohne Bayern und Preußen 7 - 16 - Preußen 17 - 57 - I. Weltkrieg 58 - 81 - Weimarer Republik 82 - 110 - Deutschland 1933-1945 111 - 216 - Deutsche Geschichte seit 1945 217 - 304 - Geschichte des Auslands bis 1945 305 - 345 - Geschichte des Auslands seit 1945 346 - 482 - Kirche-Religion 483 - 513 ! Literatur 514 - 660 ! Musik 661 - 936 - Oper-Operette (Sänger/- innen) 937 - 1106 ! Bühne - Film - Tanz 1107 - 1365 ! Bildende Kunst 1366 - 1557 ! Wissenschaft 1558 - 1646 - Forschungsreisende und Geographen 1647 - 166 ! Luftfahrt 1663 - 1674 ! Weltraumfahrt 1675 - 1705 ! Sport 1706 - 1764 ! Widmungsexemplare - Signierte Bücher 1765 - 1880 ! Sammlungen - Konvolute 1881 - 1903 Autographen – Auktion am Samstag, den 01. April 2006 47807 Krefeld, Steinrath 10 Die Versteigerung beginnt um 10.00 Uhr. Pausen nach den Gebieten Literatur und Bühne-Film-Tanz Im Auktionssaal sind wir zu erreichen: Telefon (02151) 93 10 90 und Fax (02151) 93 10 999 Während der Auktion findet im Auktionssaal keine Besichtigung statt. Die Besichtigung in unseren Geschäftsräumen kann zu den nachfolgenden Terminen wahrgenommen werden oder nach vorheriger Vereinbarung. 25.03.2006 (Samstag) von 10.00 bis 16.00 Uhr 27.03.2006 – 31.03.2006 von 10.00 bis 17.00 Uhr Bei Überweisung der Katalogschutzgebühr von EUR 10,- senden wir Ihnen gerne die Ergebnisliste der Auktion zu. Autographen - Auktionen Axel Schmolt Steinrath 10, 47807 Krefeld Tel. -

Register Mit Einer Einführung: Litera- Turpreise Als Literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand
Diskussionsbeiträge des SFB 619 »Ritualdynamik« der RuprechtRuprecht----KarlsKarlsKarls----UniversitätUniversität Heidelberg Herausgegeben von Dietrich Harth und Axel Michaels Nr. 12 Juni 2005 LITERATURPREISE Register mit einer Einführung: Litera- turpreise als literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand Burckhard Dücker Verena Neumann INHALT Vorwort 2 Burckhard Dücker: Literaturpreisverleihungen. Von der ritualisierten Ehrung zur Literaturgeschichte 1. Zur Aktualität von Literaturpreisverleihungen 4 2. Literatur und Literaturpreise: Zur Perspektive von Autoren 7 3. Zur Klassifikation von Literaturpreisen 9 4. Zur Inszenierung einer Literaturpreisverleihung 11 5. Zur Gedenkfunktion von Literaturpreisverleihungen 12 6. Literaturpreise als literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand 6.1 Literarische Ehrungen als Basis literaturgeschichtlicher Positionierung 13 6.2 Theorie und Methode 15 6.3 Preisverleihung: Konsensproklamation und Gabentausch 17 6.4 Literaturpreisverleihung und Literaturgeschichte 21 6.4.1 Material 24 6.4.2 Präsenz und Präsentation von Literatur 26 Literatur 31 Verena Neumann / Burckhard Dücker: Übersicht der registrierten Preise 35 Register der Preise 40 Register der Preisträger und ihrer Preise 212 1 Vorwort Die vorliegende Veröffentlichung versteht sich als Handreichung und Anregung für weiterführende Studien und wendet sich mit ihrem Infor- mations- und Methodenangebot auch an Gymnasien, Volkshochschulen und andere Einrichtungen im Bereich von Bildung und Weiterbildung. Entstanden ist sie im Rahmen des Heidelberger -

Das 20. Jahrhundert 284
Das 20. Jahrhundert 284 Signiert Teil 2: Bücher, Autographen, Kunst Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 284 D Verlag und A S Signiert Teil2: Antiquariat 2 Bücher, Autographen, Kunst Frank 0. J A Albrecht H R Inhalt H 69198 Schriesheim U Signiert ............................................................................ 1 Register ......................................................................... 61 Mozartstr. 62 N Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T Die Abbildung auf dem Vorderdeckel USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 zeigt ein Orig.-Tuschpinselzeichnung A von Karl Hubbuch (Katalognr. 206). S 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Unser komplettes Angebot im Internet: Kulturgeschichte R http://www.antiquariat.com Kunst T Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde Sekundärliteratur D A und Bibliographien S Gegründet 1985 2 Geschäftsbedingungen 0. J Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- Mitglied im ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro P.E.N.International A H (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht und im Verband nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf Deutscher Antiquare R Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es H besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- U lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § Sparkasse Heidelberg N 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- IBAN: DE87 6725 0020 gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert. -

Korall Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 51
KORALL KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 51. 14. évfolyam • 2013. 2013. Zene – zene – zene Bozó Péter, Fónagy Zoltán, Heltai Gyöngyi, Pálóczy Krisztina, Markian Prokopovych, Péteri Lóránt, Schreck Csilla, és Tóth Zoltán tanulmányai, valamint Szűts István Gergely írása Ára 1250 Ft 51. KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT „Minden, ami emberi alkotás õsidõktõl fogva, anyagi formákban maradt ránk, velük, rajtuk építkezünk tovább. Anyagi szerkezetekre rakódik rá jelen életünk, mint valami korallképzõdmény, úgy tenyészik az emberi társadalom.” (Hajnal István) 2 SZERKESZTÕSÉG CZOCH GÁBOR fõszerkesztõ GRANASZTÓI PÉTER KÁRMÁN GÁBOR KLEMENT JUDIT KOLTAI GÁBOR LENGVÁRI ISTVÁN MAJOROSSY JUDIT TANÁCSADÓ TESTÜLET Bácskai Vera, Beluszky Pál, Benda Gyula Faragó Tamás, Gyáni Gábor, Kovács I. Gábor, Kövér György, Tóth Zoltán, Valuch Tibor A „Zene – zene – zene” című blokkunkat Kármán Gábor és Klement Judit szerkesztette. Olvasószerkesztõ: Jung Eszter A szám megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap, és olvasóink adóforintjainak 1%-os felajánlásai támogatták. Címlapon: Borsos József Testvérek csoportképe című fotója (Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár). Kiadja a KORALL Társadalomtörténeti Egyesület Felelõs kiadó: az Egyesület elnöke Szerkesztõség: 1113 Budapest, Valkói u. 9. [email protected], www.korall.org Terjesztés: [email protected] Nyomdai elõkészítés: Kalonda Bt. Készült az OOK-Press Kft. nyomdájában Vezetõ: Szathmáry Attila ISSN 1586-2410 3 TARtaLOM ZENE – ZENE – ZENE Bozó Péter A szalon mint a zenei és társasági élet színtere Jacques Offenbach Monsieur Choufleuri restera chez lui le… című operettjében 5 Fónagy Zoltán Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században 18 Markian Prokopovych Diadalmas birodalom: Johann Strauss és A cigánybáró a budapesti Operaházban 1905-ben 41 Pálóczy Krisztina „Ha a rezesbanda ráreccsenti, az már valami…” Rézfúvós zenekarok a falvak zenei életében 61 Tóth Zoltán Zsilipelés a középosztályba. -

A Fabrizio Cambi
a Fabrizio Cambi (1952-2021) Comitato scientifico: Martin Baumeister (Roma), Luciano Canfora (Bari), Domeni- co Conte (Napoli), Markus Engelhardt (Roma), Christian Fandrych (Leipzig), Jón Karl Helgason (Reykjavik), Giampiero Moretti (Napoli), Robert E. Norton (Notre Dame), Giovanna Pinna (Campobasso), Hans Rainer Sepp (Praha), Vivetta Viva- relli (Firenze) Direzione editoriale: Marco Battaglia, Irene Bragantini, Fabrizio Cambi, Marcella Costa, Luca Crescenzi, Luigi Reitani Direttore responsabile: Luigi Reitani Redazione: Luisa Giannandrea, con la collaborazione di Miriam Miscoli, Andrea Romanzi e Sabine Schild Vitale L’«Osservatorio critico della germanistica» è a cura di Fabrizio Cambi, con la col- laborazione di Maurizio Pirro Progetto grafico: Roberto Martini Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 162/2000 del 6 aprile 2000 Periodico semestrale «Studi Germanici» è una rivista peer-reviewed di fascia A – ISSN 0039-2952 © Copyright Istituto Italiano di Studi Germanici Via Calandrelli, 25 – 00153 Roma 1820 Indice 7 Orizzonti 9 Federico Vercellone Im Archetyp wohnen. Die neuen Symbole von Anselm Kiefer 15 Kai Bremer – Marcella Costa Germanistica in Germania e in Italia durante la pandemia: un dialogo 29 Associazione italiana di germanistica La germanistica italiana nel periodo del Covid. Presentazione dei risultati dell’indagine AIG Saggi 39 Stefano Franchini Aber die Liebe. Blasfemia e oscenità nelle liriche giovanili di Richard Dehmel 57 Elisa D’Annibale Oltre Da Hegel a Nietzsche. Delio Cantimori legge Karl Löwith (1935-1965) 79 Paola Gentile La circolazione letteraria dalle periferie culturali. Il caso della letteratura neerlandofona in Italia 99 Ulisse Dogà Sul significato evidenziale del Futur II nella letteratura drammatica di Goethe e Schiller 119 Osservatorio critico della germanistica a cura di Fabrizio Cambi, con la collaborazione di Maurizio Pirro 225 Abstracts 229 Hanno collaborato Orizzonti Im Archetyp wohnen. -
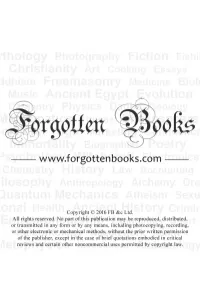
Memorable Dates Jewish History
ME MORABLE DATE S J E WIS H H ISTO RY BY T H D E TSCH P H . D . GO T A R D U , , Profe sso r a t th e H e b re w U n ion Colle e g , Cin cin n a ti 0 . , N E W YO R K B L B L O CH P U ISHING CO . 1 904 M E M OR A BLE D A T E S . IN T R OD U CT ION . M O NG th e various attempts to explain the complex phe n omen on called Judaism , the historical explanation will of necessarily be the least dispute d . The definition Judaism as of a racial entity is strongly denied by a great many its followers , of as mistaking the accidental for the essential . The definition u m of wh o Judaism as a creed is derided by a great n ber men , not only allow themselves to be called Jews in spite of their in dif or ference even hostility to the religious question , but even by such for n . who zealously work its future desti y The definition , however, of a r e that the Jews the present age such by descent, that is , i through h storic forces , be those forces racial or religious, cannot n ot be denied . The worst that may be said against it is that it is complete . This assertion is strongly sup ported by the fact that the interest in Jewish history is manifeste d in ou r age as it never has been e m i befor , by publication of docu ents , of tombstone inscript ons o and mon graphs , by the founding of societies devoted to the fur th er a n ce of of Jewish history, and by the frequent celebration e or i a o c ntenaries , similar events , recall ng import nt turning p ints of ou r in the h istory past .