Ecics 32.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Das 20. Jahrhundert 239
Das 20. Jahrhundert 239 Autographen, Widmungsexemplare sowie andere Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 239 D Verlag und A Autographen, Widmungsexemplare S Antiquariat sowie andere Neueingänge 2 Frank 0. J Albrecht A Inhalt H R Autographen .................................................................... 1 H Widmungsexemplare und andere Neueingänge ........... 15 69198 Schriesheim U Register ......................................................................... 28 Mozartstr. 62 N Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T Die Abbildung auf dem Vorderdeckel zeigt den Einband von Walter Trier USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 zu Erich Kästner (Katalognr. 190). A S 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica E Unser komplettes Angebot im Internet: Kinder- und Jugendbuch http://www.antiquariat.com Kulturgeschichte R Kunst T Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde D Sekundärliteratur und Bibliographien A S Geschäftsbedingungen Gegründet 1985 2 0. Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- J ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro Mitglied im A (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht P.E.N.International nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf und im Verband H Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es Deutscher Antiquare R besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- H lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § U 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- Sparkasse Heidelberg N gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert. -

Deutsche Aphorismen Des 20. Jahrhunderts
Inhalt Der Aphorismus in Deutschland nach der Jahrhundertwende...................................................4 Emanuel Wertheimer 5, Ernst Hohenemser 8, Emil Gött 11, Arno Nadel 14, Walther Rathenau 16, Heinrich Gerland 18, Christian Morgenstern 19, Peter Hille 24, Isolde Kurz 26 Der österreichische Aphorismus nach der Jahrhundertwende.................................................27 Wilhelm Fischer 28, Richard Münzer 30, Otto Weiß 32, Karl Kraus 35, Peter Altenberg 41, Otto Stoessl 43, Carl Dallago 45, Alfred Grünewald 46 Der expressionistische Aphorismus..........................................................................................48 Rudolf Leonhard 49, Kurt Hiller 52, Franz Marc 54, Walter Serner 55 Der österreichische Aphorismus der zwanziger und dreißiger Jahre......................................57 Egon Friedell 58, Hugo von Hofmannsthal 60, Arthur Schnitzler 64, Richard von Schaukal 68, Rosa Mayreder 71, Franz Kafka 73, Robert Musil 77 Der Aphorismus in der Weimarer Republik..............................................................................78 Rudolf Alexander Schröder 79, Wilhelm von Scholz 82, Moritz Heimann 84, Friedrich Kayssler 85, Gerhart Hauptmann 86, Otto Michel 88, Kurt Tucholsky 89 Aphorismus und Spruch im Dritten Reich.................................................................................91 Ernst Bertram 92, Richard Benz 95, Theodor Haecker 97 Aphorismus und Exil.................................................................................................................99 Franz -

Das 20. Jahrhundert 215
Das 20. Jahrhundert 215 Ein Jahrhundert im Rückblick. Teil XVIII: 1975-1980 sowie Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 215 D Verlag und A Ein Jahrhundert im Rückblick S Antiquariat Teil XVIII: 1975-1980 2 sowie Neueingänge 0. Frank J A Albrecht H Inhalt R H 1975 .............................................................................. 1 69198 Schriesheim U 1976 .............................................................................. 7 Mozartstr. 62 1977 ............................................................................ 14 N 1978 ............................................................................ 20 Tel.: 06203/65713 D 1979 ............................................................................ 24 FAX: 06203/65311 E 1980 ............................................................................ 29 Email: R Neueingänge ................................................................ 36 [email protected] T Register ....................................................................... 40 USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 A Die Abbildung auf dem Vorderdeckel S zeigt eine Farblithographie von Juan Miró aus 2 Katalognr. 368. 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Kunst T Unser komplettes Angebot im Internet: Politik und Zeitgeschichte http://www.antiquariat.com -

Autographen-Auktion 1
AUTOGRAPHEN-AUKTION 1. April 2006 47807 Krefeld, Steinrath 10 Los 1581 Sigmund Freud Axel Schmolt Autographen-Auktionen 47807 Krefeld Steinrath 10 Telefon 02151-93 10 90 Telefax 02151-93 10 9 99 E-Mail: [email protected] AUTOGRAPHEN-AUKTION Inhaltsverzeichnis Los-Nr. ! Geschichte - Bayern - Haus Wittelsbach 1 - 6 - Deutsche Geschichte ohne Bayern und Preußen 7 - 16 - Preußen 17 - 57 - I. Weltkrieg 58 - 81 - Weimarer Republik 82 - 110 - Deutschland 1933-1945 111 - 216 - Deutsche Geschichte seit 1945 217 - 304 - Geschichte des Auslands bis 1945 305 - 345 - Geschichte des Auslands seit 1945 346 - 482 - Kirche-Religion 483 - 513 ! Literatur 514 - 660 ! Musik 661 - 936 - Oper-Operette (Sänger/- innen) 937 - 1106 ! Bühne - Film - Tanz 1107 - 1365 ! Bildende Kunst 1366 - 1557 ! Wissenschaft 1558 - 1646 - Forschungsreisende und Geographen 1647 - 166 ! Luftfahrt 1663 - 1674 ! Weltraumfahrt 1675 - 1705 ! Sport 1706 - 1764 ! Widmungsexemplare - Signierte Bücher 1765 - 1880 ! Sammlungen - Konvolute 1881 - 1903 Autographen – Auktion am Samstag, den 01. April 2006 47807 Krefeld, Steinrath 10 Die Versteigerung beginnt um 10.00 Uhr. Pausen nach den Gebieten Literatur und Bühne-Film-Tanz Im Auktionssaal sind wir zu erreichen: Telefon (02151) 93 10 90 und Fax (02151) 93 10 999 Während der Auktion findet im Auktionssaal keine Besichtigung statt. Die Besichtigung in unseren Geschäftsräumen kann zu den nachfolgenden Terminen wahrgenommen werden oder nach vorheriger Vereinbarung. 25.03.2006 (Samstag) von 10.00 bis 16.00 Uhr 27.03.2006 – 31.03.2006 von 10.00 bis 17.00 Uhr Bei Überweisung der Katalogschutzgebühr von EUR 10,- senden wir Ihnen gerne die Ergebnisliste der Auktion zu. Autographen - Auktionen Axel Schmolt Steinrath 10, 47807 Krefeld Tel. -

Register Mit Einer Einführung: Litera- Turpreise Als Literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand
Diskussionsbeiträge des SFB 619 »Ritualdynamik« der RuprechtRuprecht----KarlsKarlsKarls----UniversitätUniversität Heidelberg Herausgegeben von Dietrich Harth und Axel Michaels Nr. 12 Juni 2005 LITERATURPREISE Register mit einer Einführung: Litera- turpreise als literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand Burckhard Dücker Verena Neumann INHALT Vorwort 2 Burckhard Dücker: Literaturpreisverleihungen. Von der ritualisierten Ehrung zur Literaturgeschichte 1. Zur Aktualität von Literaturpreisverleihungen 4 2. Literatur und Literaturpreise: Zur Perspektive von Autoren 7 3. Zur Klassifikation von Literaturpreisen 9 4. Zur Inszenierung einer Literaturpreisverleihung 11 5. Zur Gedenkfunktion von Literaturpreisverleihungen 12 6. Literaturpreise als literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand 6.1 Literarische Ehrungen als Basis literaturgeschichtlicher Positionierung 13 6.2 Theorie und Methode 15 6.3 Preisverleihung: Konsensproklamation und Gabentausch 17 6.4 Literaturpreisverleihung und Literaturgeschichte 21 6.4.1 Material 24 6.4.2 Präsenz und Präsentation von Literatur 26 Literatur 31 Verena Neumann / Burckhard Dücker: Übersicht der registrierten Preise 35 Register der Preise 40 Register der Preisträger und ihrer Preise 212 1 Vorwort Die vorliegende Veröffentlichung versteht sich als Handreichung und Anregung für weiterführende Studien und wendet sich mit ihrem Infor- mations- und Methodenangebot auch an Gymnasien, Volkshochschulen und andere Einrichtungen im Bereich von Bildung und Weiterbildung. Entstanden ist sie im Rahmen des Heidelberger -

Das 20. Jahrhundert 284
Das 20. Jahrhundert 284 Signiert Teil 2: Bücher, Autographen, Kunst Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 284 D Verlag und A S Signiert Teil2: Antiquariat 2 Bücher, Autographen, Kunst Frank 0. J A Albrecht H R Inhalt H 69198 Schriesheim U Signiert ............................................................................ 1 Register ......................................................................... 61 Mozartstr. 62 N Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T Die Abbildung auf dem Vorderdeckel USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 zeigt ein Orig.-Tuschpinselzeichnung A von Karl Hubbuch (Katalognr. 206). S 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Unser komplettes Angebot im Internet: Kulturgeschichte R http://www.antiquariat.com Kunst T Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde Sekundärliteratur D A und Bibliographien S Gegründet 1985 2 Geschäftsbedingungen 0. J Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- Mitglied im ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro P.E.N.International A H (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht und im Verband nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf Deutscher Antiquare R Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es H besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- U lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § Sparkasse Heidelberg N 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- IBAN: DE87 6725 0020 gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert. -

A Fabrizio Cambi
a Fabrizio Cambi (1952-2021) Comitato scientifico: Martin Baumeister (Roma), Luciano Canfora (Bari), Domeni- co Conte (Napoli), Markus Engelhardt (Roma), Christian Fandrych (Leipzig), Jón Karl Helgason (Reykjavik), Giampiero Moretti (Napoli), Robert E. Norton (Notre Dame), Giovanna Pinna (Campobasso), Hans Rainer Sepp (Praha), Vivetta Viva- relli (Firenze) Direzione editoriale: Marco Battaglia, Irene Bragantini, Fabrizio Cambi, Marcella Costa, Luca Crescenzi, Luigi Reitani Direttore responsabile: Luigi Reitani Redazione: Luisa Giannandrea, con la collaborazione di Miriam Miscoli, Andrea Romanzi e Sabine Schild Vitale L’«Osservatorio critico della germanistica» è a cura di Fabrizio Cambi, con la col- laborazione di Maurizio Pirro Progetto grafico: Roberto Martini Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 162/2000 del 6 aprile 2000 Periodico semestrale «Studi Germanici» è una rivista peer-reviewed di fascia A – ISSN 0039-2952 © Copyright Istituto Italiano di Studi Germanici Via Calandrelli, 25 – 00153 Roma 1820 Indice 7 Orizzonti 9 Federico Vercellone Im Archetyp wohnen. Die neuen Symbole von Anselm Kiefer 15 Kai Bremer – Marcella Costa Germanistica in Germania e in Italia durante la pandemia: un dialogo 29 Associazione italiana di germanistica La germanistica italiana nel periodo del Covid. Presentazione dei risultati dell’indagine AIG Saggi 39 Stefano Franchini Aber die Liebe. Blasfemia e oscenità nelle liriche giovanili di Richard Dehmel 57 Elisa D’Annibale Oltre Da Hegel a Nietzsche. Delio Cantimori legge Karl Löwith (1935-1965) 79 Paola Gentile La circolazione letteraria dalle periferie culturali. Il caso della letteratura neerlandofona in Italia 99 Ulisse Dogà Sul significato evidenziale del Futur II nella letteratura drammatica di Goethe e Schiller 119 Osservatorio critico della germanistica a cura di Fabrizio Cambi, con la collaborazione di Maurizio Pirro 225 Abstracts 229 Hanno collaborato Orizzonti Im Archetyp wohnen. -

Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 9180527 Wo die Opfer zu Tatern werden, machen sich die Tater zu Opfern: Die Rezeption der beiden ersten Romane Edgar Hilsenraths in Deutschland und den USA. -

Inhalt Kurzegeschichtedesdeuts
Kurze Geschichte des deutschen Aphorismus Inhalt Kurze Geschichte des deutschen Aphorismus I. Vorbemerkungen..........................................................................................................3 II. Zur europäischen Vorgeschichte.....................................................................................5 A. Das 18. Jahrhundert..........................................................................................................11 I. Die frühe deutsche La Rochefoucauld- Rezeption...................................................14 Adolph von Knigge 17, Johann Caspar Lavater 17, Marianne Ehrmann 17, Friedrich Schulz 17 II. Lebensphilosophie und Lehraphorismus................................................................17 III. Im Umkreis der werdenden Gattung.............................................................................19 Friedrich Heinrich Jacobi 19, August von Einsiedel 22, Sebastian Mutschelle 23 IV. Der frühe Höhepunkt der Gattung um 1800...........................................................25 1. Georg Christoph Lichtenberg: Sudelbuch-Einfälle...........................................26 2. Jean Paul: Gedanken und Bemerkungen ..........................................................28 3. Das romantische Fragment……………………................................................31 4. Johann Wolfgang von Goethe: Maxime und Aperçu .......................................34 B. Das 19. Jahrhundert 1. Politische Aphoristik nach 1800...........................................................................................42 -

Die Sammlung Dr. Kurt Kampf Im Klingspor-Museum
Die Sammlung Dr. Kurt Kampf im Klingspor-Museum Oberstudienrat Dr. Kurt Kampf (1907 – 1990) lehrte an der Rudolf-Koch-Schule in Offenbach, er war außerdem Lyriker, Sammler von Grafiken und Pressendrucken und Förderer des Bundes Offenbacher Künstler. Dr. Kampf vermachte dem Klingspor-Museum zahlreiche Drucke aus seiner Privatbibliothek und sein Vermögen zum Ankauf von Buchkunstwerken. Die Herbstausstellung 1997 des Klingspor-Museums zeigte alle acht kostbaren Künstlerbücher der Tukanpresse, deren Ankauf er mit seinem Vermächtnis ermöglicht hatte. Hier sind die Drucke aus Dr. Kampfs Sammlung verzeichnet, die sich im Bestand des Klingspor-Museums befinden: Abraham a Santa Clara: Von Papierern, Schreibern, Kupferstechern, Schriftgießern, Buchdruckern und Buchbindern. Mit 6 Kupferstichen des Christoph Weigel nach Caspar Luyken. Ausgew. von Helmut Presser. Typografie: Hermann Rapp. Gesellschaft der Bibliophilen, 1969. Inv. 95/849 Adams, William: Sacred allegories. With engravings from orig. designs by Charles W. Cope … London : Rivingtons, 1856. Inv. 99/22 Erwerb posthum Addams, Peter: Mord im Schloß. Kriminalgroteske. Einband u. Vignetten von Ruth Knorr. Typografie: Hans-Joachim Schauß. Berlin : Verl. der Nation, 1974. Inv. 99/465 Erwerb posthum Äsopus: Drei Dutzend Fabeln. Von Äsop. Mit Holzschnitten von Felix Hoffmann. Typografie: Max Caflisch. Zürich : Flamberg, 1968. Inv. 95/842 Äsopus: [Fabeln.] Äsopische Fabeln. Hrsg. von Gotthard de Beauclair. Mit 18 Linolschnitten von Imre Reiner. Typografie: Gotthard de Beauclair. Frankfurt am Main : Trajanus-Presse, 1968. Inv. 95/780 Aichinger, Ilse: Fünf Vorschläge. Mit Collagen von Peter Malutzki. Lahnstein : FlugBlatt-Presse, 1996. Inv. 97/384 Erwerb posthum Alexander, Charles: A book of hours. Poems by Charles Alexander. Illustrations by Penny Mc Elroy. Redlands, California : 5 & Dime Press, 1987. -

Autographen-Auktion 18
AUTOGRAPHEN-AUKTION 18. April 2009 Los 1285 Charles A. LINDBERGH Axel Schmolt Autographen-Auktionen 47807 Krefeld Steinrath 10 Telefon 02151-93 10 90 Telefax 02151-93 10 9 99 E-Mail: [email protected] AUTOGRAPHEN-AUKTION Inhaltsverzeichnis Los-Nr. ! Geschichte - Deutsche Geschichte allgemein (ohne Preußen) 1 - 28 - Preußen 29 - 57 - I. Weltkrieg 58 - 73 - Weimarer Republik 74 - 94 - Deutschland 1933-1945 95 - 171 - Deutsche Geschichte seit 1945 172 - 235 - Geschichte des Auslands bis 1945 236 - 290 - Geschichte des Auslands seit 1945 291 - 381 - Kirche-Religion 382 - 402 ! Literatur 403 - 551 ! Musik 552 - 730 - Oper-Operette (Sänger/- innen) 731 - 841 ! Bühne - Film - Tanz 842 - 1049 ! Bildende Kunst 1050 - 1202 ! Wissenschaft 1203 - 1261 - Forschungsreisende und Geographen 1262 - 1273 ! Luftfahrt 1274 - 1292 ! Weltraumfahrt 1293 - 1312 ! Sport 1313 - 1385 ! Widmungsexemplare - Signierte Bücher 1386 - 1445 ! Sammlungen - Konvolute 1446 - 1473 Autographen – Auktion am Samstag, den 18. April 2009 47807 Krefeld, Steinrath 10 Die Versteigerung beginnt um 11.00 Uhr. Pausen nach den Gebieten Literatur und Bühne-Film-Tanz Im Auktionssaal sind wir zu erreichen: Telefon (02151) 93 10 90 und Fax (02151) 93 10 999 Während der Auktion findet im Auktionssaal keine Besichtigung statt. Die Besichtigung in unseren Geschäftsräumen kann zu den nachfolgenden Terminen wahrgenommen werden oder nach vorheriger Vereinbarung. 11.4.2009 (Samstag) von 11.00 bis 16.00 Uhr 14.4.2009 bis 17.4.2009 von 11.00 bis 17.00 Uhr Bei Überweisung der Katalogschutzgebühr von EUR 10,- senden wir Ihnen gerne die Ergebnisliste der Auktion zu. Autographen - Auktionen Axel Schmolt Steinrath 10, 47807 Krefeld Tel. 02151 – 93 10 90 / Fax 02151 – 93 10 999 Internet: http://www.schmolt.de Wichtiger Hinweis: Mit der Abgabe der Gebote für die Autographen, Dokumente und Bildpostkarten aus der NS-Zeit verpflich- tet sich der Bieter dazu, diese Ware lediglich für historisch-wissenschaftliche Sammelzwecke zu erwerben und in keiner Weise propagandistisch im Sinne des § 86 StGB zu benutzen. -
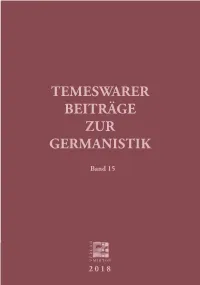
Temeswarer Beiträge Zur Germanistik Sind in Internationalen Datenbanken (ZDB, BDSL, Gin, SCIPIO, BASE, EZB, MLA, BLLDB U
ISSN: 1453-7621 BAND 15 TEMESWARER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK G T E E B R M E M I E Z T 2 B S V E R L A G A M U 0 and I R R W 1 N T O R 8 Ä 15 N A I G S R T E E I R K TEMESWARER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK Band 15 Gedruckt mit Förderung des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland Die Temeswarer Beiträge zur Germanistik sind in internationalen Datenbanken (ZDB, BDSL, GiN, SCIPIO, BASE, EZB, MLA, BLLDB u. a.) vertreten. Der Band einschließlich aller seiner Teile ist urhebberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Mirton Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Verfielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Romania ISSN: 1453-7621 TEMESWARER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK Band 15 Mirton Verlag Temeswar 2018 Herausgeberin Prof. Dr. Roxana Nubert (West-Universität Temeswar) Universitatea de Vest din Timișoara Fachbereich Germanistik Bd. V. Pârvan 4 RO-300223 Timișoara E-Mail: [email protected] Redaktion Doz. Dr. Marianne Marki (West-Universität Temeswar) Dr. Alina Olenici-Crăciunescu (West-Universität Temeswar) Dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan (Politehnica-Universität Temeswar) Dr. Kinga Gáll (West-Universität Temeswar) Dr. Alwine Ivănescu (West-Universität Temeswar) Dr. Beate Petra Kory (West-Universität Temeswar) Dr. Karla Lupșan (West-Universität Temeswar) Doz. Dr. Grazziella Predoiu (West-Universität Temeswar) Dr. Mihaela Șandor (West-Universität Temeswar) Dr. Maria Stângă (West-Universität Temeswar) Redaktionsbeirat Prof. Dr. Sabine Anselm (Ludwig-Maximilians-Universität München) Prof. Dr. Mariana-Virginia Lăzărescu (Universität Bukarest) Prof.