Information to Users
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Information Issued by The
Vol. XV No. 10 October, 1960 INFORMATION ISSUED BY THE. ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN t FAIRFAX MANSIONS, FINCHLEY ROAD (Comer Fairfax Road), Offict and Consulting Hours : LONDON, N.W.3 Monday to Thursday 10 a.m.—I p.m. 3—6 p.m. Talephona: MAIda Vala 9096'7 (General Officel Friday 10 a.m.—I p.m. MAIda Vale 4449 (Employment Agency and Social Services Dept.} 'Rudolf Hirschfeld (Monlevideo) a few others. Apart from them, a list of the creators of all these important German-Jewish organisations in Latin America would hardly con tain a name of repute outside the continent. It GERMAN JEWS IN SOUTH AMERICA it without any doubt a good sign that post-1933 German Jewry has been able to produce an entirely new generation of vigorous and success I he history of the German-Jewish organisations abroad '"—to assert this would be false—they ful leaders. =8ins in each locality the moment the first ten consider themselves as the sons of the nation In conclusion two further aspects have to be r^Ple from Germany disembark. In the few which has built up the State of Israel, with the mentioned : the relationship with the Jews around thp "if- ^^^^^ Jewish groups were living before consciousness that now at last they are legitimate us, and the future of the community of Jews from ne Hitler period the immigrants were helped by members of the national families of the land they Central Europe. Jewish life in South America ne earlier arrivals. But it is interesting that this inhabit at present. -

Hitler's Zweites Buch (Secret Book)
Home Zweites Buch (Secret book) Search Foreword Chapter 1 Adolf Hitler's Sequel to Mein Kampf Chapter 2 Chapter 3 "Politics is history in the making." Chapter 4 Chapter 5 Such were the words of Adolf Hitler in his untitled,unpublished, and Chapter 6 long suppressed second work written only a few years after the Chapter 7 publication of Mein Kampf. Chapter 8 Chapter 9 Chapter10 Only two copies of the 200 page manuscript were originally made, and only one of these Chapter 11 has ever been made public. Kept strictly secret under Hitler's orders, the document was Chapter 12 placed in an air raid shelter in 1935 where it remained until it's discovery by an American officer in 1945. Chapter 13 Chapter 14 Written in 1928, the authenticity of the book has been verified by Josef Berg (former Chapter 15 employee of the Nazi publishing house Eher Verlag), and Telford Taylor (former Chapter 16 Brigadier General U.S.A.R., and Chief Counsel at the Nuremburg war-crimes trials) who, after an analysis made in 1961,comments: Search "If Hitler's book of 1928 is read against thebackground of the intervening years , it should interest not scholars only, but the general reader. *as quoted by http://www.pharo.com/lost&found.htm FOREWORD In August, 1925, on the occasion of the writing of the second volume, I formulated the fundamental ideas of a National Socialist foreign policy, in the brief time afforded by the circumstances. Within the framework of that book I dealt especially with the question of the Southern Tyrol, which gave rise to attacks against the Movement as violent as they were groundless. -

Was Hitler a Darwinian?
Was Hitler a Darwinian? Robert J. Richards The University of Chicago The Darwinian underpinnings of Nazi racial ideology are patently obvious. Hitler's chapter on "Nation and Race" in Mein Kampf discusses the racial struggle for existence in clear Darwinian terms. Richard Weikart, Historian, Cal. State, Stanislaus1 Hamlet: Do you see yonder cloud that's almost in shape of a camel? Shakespeare, Hamlet, III, 2. 1. Introduction . 1 2. The Issues regarding a Supposed Conceptually Causal Connection . 4 3. Darwinian Theory and Racial Hierarchy . 10 4. The Racial Ideology of Gobineau and Chamberlain . 16 5. Chamberlain and Hitler . 27 6. Mein Kampf . 29 7. Struggle for Existence . 37 8. The Political Sources of Hitler’s Anti-Semitism . 41 9. Ethics and Social Darwinism . 44 10. Was the Biological Community under Hitler Darwinian? . 46 11. Conclusion . 52 1. Introduction Several scholars and many religiously conservative thinkers have recently charged that Hitler’s ideas about race and racial struggle derived from the theories of Charles Darwin (1809-1882), either directly or through intermediate sources. So, for example, the historian Richard Weikart, in his book From Darwin to Hitler (2004), maintains: “No matter how crooked the road was from Darwin to Hitler, clearly Darwinism and eugenics smoothed the path for Nazi ideology, especially for the Nazi 1 Richard Weikart, “Was It Immoral for "Expelled" to Connect Darwinism and Nazi Racism?” (http://www.discovery.org/a/5069.) 1 stress on expansion, war, racial struggle, and racial extermination.”2 In a subsequent book, Hitler’s Ethic: The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress (2009), Weikart argues that Darwin’s “evolutionary ethics drove him [Hitler] to engage in behavior that the rest of us consider abominable.”3 Other critics have also attempted to forge a strong link between Darwin’s theory and Hitler’s biological notions. -

Uvic Thesis Template
Fathers, Sons and the Holo-Ghost: Reframing Post-Shoah Male Jewish Identity in Doron Rabinovici’s Suche nach M by Michael Moses Gans BA, Cleveland State University, 1976 MS, University of Massachusetts, 1981 MSW, Barry University, 2008 MA, Central European University, 2009 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS in the Department of Germanic and Slavic Studies Michael Moses Gans, 2012 University of Victoria All rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. ii Supervisory Committee Fathers, Sons and the Holo-Ghost: Reframing Post-Shoah Male Jewish Identity in Doron Rabinovici’s Suche nach M by Michael Moses Gans BA, Cleveland State University, 1976 MS, University of Massachusetts, 1981 MSW, Barry University, 2008 MA, Central European University, 2009 Supervisory Committee Dr. Charlotte Schallié, (Department of Germanic and Slavic Studies) Supervisor Dr. Matthew Pollard, (Department of Germanic and Slavic Studies) Departmental Member iii Abstract Supervisory Committee Dr. Charlotte Schallié, (Department of Germanic and Slavic Studies) Supervisor Dr. Matthew Pollard, (Department of Germanic and Slavic Studies) Departmental Member The enduring, mythical and antisemitic figure of Ahasuerus is central to the unraveling and reframing of post-Shoah Jewish identity in Rabinovici’s novel Suche nach M for it serves as the mythological color palette from which Rabinovici draws his characters and, to extend that metaphor, how the Jews have been immortalized in European culture. There is no escape in Suche nach M. When painting the Jew, both Jews and non-Jews can only use brush strokes of color from the Christian-created palette of the mythic, wandering Jew, Ahasuerus, who is stained in the blood of deicide, emasculated, treacherous, and evil. -
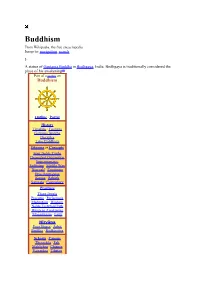
Buddhism from Wikipedia, the Free Encyclopedia Jump To: Navigation, Search
Buddhism From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search A statue of Gautama Buddha in Bodhgaya, India. Bodhgaya is traditionally considered the place of his awakening[1] Part of a series on Buddhism Outline · Portal History Timeline · Councils Gautama Buddha Disciples Later Buddhists Dharma or Concepts Four Noble Truths Dependent Origination Impermanence Suffering · Middle Way Non-self · Emptiness Five Aggregates Karma · Rebirth Samsara · Cosmology Practices Three Jewels Precepts · Perfections Meditation · Wisdom Noble Eightfold Path Wings to Awakening Monasticism · Laity Nirvāṇa Four Stages · Arhat Buddha · Bodhisattva Schools · Canons Theravāda · Pali Mahāyāna · Chinese Vajrayāna · Tibetan Countries and Regions Related topics Comparative studies Cultural elements Criticism v • d • e Buddhism (Pali/Sanskrit: बौद धमर Buddh Dharma) is a religion and philosophy encompassing a variety of traditions, beliefs and practices, largely based on teachings attributed to Siddhartha Gautama, commonly known as the Buddha (Pāli/Sanskrit "the awakened one"). The Buddha lived and taught in the northeastern Indian subcontinent some time between the 6th and 4th centuries BCE.[2] He is recognized by adherents as an awakened teacher who shared his insights to help sentient beings end suffering (or dukkha), achieve nirvana, and escape what is seen as a cycle of suffering and rebirth. Two major branches of Buddhism are recognized: Theravada ("The School of the Elders") and Mahayana ("The Great Vehicle"). Theravada—the oldest surviving branch—has a widespread following in Sri Lanka and Southeast Asia, and Mahayana is found throughout East Asia and includes the traditions of Pure Land, Zen, Nichiren Buddhism, Tibetan Buddhism, Shingon, Tendai and Shinnyo-en. In some classifications Vajrayana, a subcategory of Mahayana, is recognized as a third branch. -

Das 20. Jahrhundert 239
Das 20. Jahrhundert 239 Autographen, Widmungsexemplare sowie andere Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 239 D Verlag und A Autographen, Widmungsexemplare S Antiquariat sowie andere Neueingänge 2 Frank 0. J Albrecht A Inhalt H R Autographen .................................................................... 1 H Widmungsexemplare und andere Neueingänge ........... 15 69198 Schriesheim U Register ......................................................................... 28 Mozartstr. 62 N Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T Die Abbildung auf dem Vorderdeckel zeigt den Einband von Walter Trier USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 zu Erich Kästner (Katalognr. 190). A S 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica E Unser komplettes Angebot im Internet: Kinder- und Jugendbuch http://www.antiquariat.com Kulturgeschichte R Kunst T Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde D Sekundärliteratur und Bibliographien A S Geschäftsbedingungen Gegründet 1985 2 0. Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- J ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro Mitglied im A (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht P.E.N.International nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf und im Verband H Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es Deutscher Antiquare R besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- H lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § U 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- Sparkasse Heidelberg N gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert. -

Scientific Report (May 2013 – October 2015)
Scientific report (May 2013 – October 2015) Displacement, Deportation and Survival of the Jews from Bucovina. Literary Models of Identity and Memory Construction PN-II-RU-PD-2012-3–0233 STAGE 1 (May-December 2013) 1. Establishing the bibliographical apparatus The general and specific bibliography was identified by consulting the electronic catalogs of several libraries in Iasi (B.C.U), Bucharest (B.N.R, B.A.R, B.C.U.B), Vienna (Ö.N.B, Universitätsbibliothek, Bibliothek des Jüdischen Museums Wien), Jerusalem (National & University Library of Israel), Tel Aviv (Sourasky Central Library) and Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin, HU / FU-Universitätsbibliothek). I have also accessed some relevant databases of numerous archives in Jerusalem and in New York (e.g. Yad Vashem, The Central Archives for the History of the Jewish People, Leo Baeck, YIVO) in order to determine the documentation needs. As a result of this documentation work it was identified a total of 197 bibliographical representative titles; this work will form the interpretative basis in the framework of the project. The bibliography has been divided into three main chapters: a) historical works and studies; b) literary and documentary-literary writings; c) studies in aesthetic theory, works related to the cultural studies. The bibliographical references cover various linguistic and cultural areas, allowing the consultation of a wide range of literature written in Romanian, German, French, English and Yiddish. 2. Deepening the theoretical and thematic framework of the project a) The regaining of Bessarabia and Northern Bukovina by Romania; the Bukovina Jews during the Second World War; the deportations to Transnistria In this stage, it was relevant to consider a critical reading of a specific text corpus, especially of historical studies in order to reveal the historical peculiarities of the Romanian Holocaust in an objective manner. -

INFORMATION ISSUED by the Assooaim W XWISH ROKEES HI CHEAT OIITAHI
Volume XXXI No. 6 June, 1976 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOOAim W XWISH ROKEES HI CHEAT OIITAHI 'r erner Rosenstock at these meetings — convened by not speci fically Jewish learned societies and on a wider basis than the Scholars' Conference at Arden House in 1973 under the auspices of TWO SIGNIFICANT ANNIVERSARIES the LBI—are reprinted in this Year Book. In Braunschweig, Professor Reinhard Ruerup illustrates the "Jewish Question" in Gennany Robert Weltsch and the L.B.I. Year Book 1850-1890 by stating that in spite of the Libe ral conception according to which the Jews When, shortly after its inception, the Leo to the man, we now tum to his latest work, differed from the majority population only ^^eclc Institute decided to include in its pro- the 20th Year Book. From a general point of by their religion, the term "baptised Jew" Sramme the publication of year books, some view, this volume symbolises the general was widely accepted. This indicated that the sceptics, including Martin Buber, warned transition it has undergone in the course of the concept of "Jew" was not exhausted by its ^gainst such an ambitious venture, because past two decades. Whilst the contributors to reUgious connotation. Ruerup also deals with 'hey had experienced on several previous oc the first voliunes were almost exclusively the effects of the increasing concentration of casions that one could never reckon on the Jewish scholars, who had spent part of their Jews in towns and quotes as examples that continuity of such annual publications. Now, adult lives in Gennany, the circle of authors already in 1875 in Berlin 4-7 per cent and *^ can state with pride that, perhaps as the has 'gradually widened. -

Children in Frank Beyer's Holocaust Films
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations Dissertations and Theses November 2016 Children in Frank Beyer's Holocaust Films Delene M. White University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2 Part of the Film and Media Studies Commons, and the German Language and Literature Commons Recommended Citation White, Delene M., "Children in Frank Beyer's Holocaust Films" (2016). Doctoral Dissertations. 815. https://doi.org/10.7275/9052390.0 https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/815 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. CHILDREN IN FRANK BEYER’S HOLOCAUST FILMS A Dissertation Presented By DELENE CASE WHITE Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY September 2016 German and Scandinavian Studies © Copyright by Delene Case White 2016 All Rights Reserved CHILDREN IN FRANK BEYER’S HOLOCAUST FILMS A Dissertation Presented by DELENE CASE WHITE Approved as to style and content by: __________________________________ Barton Byg, Chair __________________________________ Sky Arndt-Briggs, Member __________________________________ Jonathan Skolnik, Member __________________________________ Jon Olsen, Member _____________________________ Andrew Donson, Member and Program Director German and Scandinavian Studies _____________________________ William Moebius, Department Chair Languages, Literature, and Cultures DEDICATION For Jack, my own child with the most agency of all. ACKNOWLEDGMENTS I have many people and institutions to thank for their support of many various kinds. -

Yiddish and the Negotiation of Literary Legacy in Germany After 1945
FOLK FICTION: YIDDISH AND THE NEGOTIATION OF LITERARY LEGACY IN GERMANY AFTER 1945 Emma Woelk A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill and Duke University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Carolina Duke Graduate Program in German Studies. Chapel Hill/Durham 2015 Approved by: Ruth von Bernuth William Donahue Kata Gellen Jonathan Hess Richard Langston © 2015 Emma Woelk ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Emma Woelk: Folk Fiction: Yiddish and the Negotiation of Literary Legacy in Germany after 1945 (Under the direction of Ruth von Bernuth) Following the Holocaust, when Eastern European Yiddish-language culture was all but destroyed and millions of Yiddish speakers were murdered, the language took on new significance in German culture. Whether it be as a symbol of proletarian solidarity in East German theater or as part of West German literary engagement with American Jewish culture, Yiddish shows up all over postwar German literature and performance. Building on scholarship from German Studies, Yiddish Studies, and cultural and political history, the following study connects the study of Yiddish in German literature after 1945 both to discourses from the early 20th century and to broader discussions on German identity and literary legacy in the postwar era. I am primarily interested in the reinvention of the folk tradition following the Nazi era and the creation of a usable literary past at a time in which the German political and geographic present was in flux. This dissertation explores these issues by looking at the ways in which German-language authors on both sides of the Berlin Wall, and those writing after its fall, relied on Yiddish to negotiate national literary identities. -

Nazi Party from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read View source View history Nazi Party From Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the German Nazi Party that existed from 1920–1945. For the ideology, see Nazism. For other Nazi Parties, see Nazi Navigation Party (disambiguation). Main page The National Socialist German Workers' Party (German: Contents National Socialist German Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (help·info), abbreviated NSDAP), commonly known Featured content Workers' Party in English as the Nazi Party, was a political party in Germany between 1920 and 1945. Its Current events Nationalsozialistische Deutsche predecessor, the German Workers' Party (DAP), existed from 1919 to 1920. The term Nazi is Random article Arbeiterpartei German and stems from Nationalsozialist,[6] due to the pronunciation of Latin -tion- as -tsion- in Donate to Wikipedia German (rather than -shon- as it is in English), with German Z being pronounced as 'ts'. Interaction Help About Wikipedia Community portal Recent changes Leader Karl Harrer Contact page 1919–1920 Anton Drexler 1920–1921 Toolbox Adolf Hitler What links here 1921–1945 Related changes Martin Bormann 1945 Upload file Special pages Founded 1920 Permanent link Dissolved 1945 Page information Preceded by German Workers' Party (DAP) Data item Succeeded by None (banned) Cite this page Ideologies continued with neo-Nazism Print/export Headquarters Munich, Germany[1] Newspaper Völkischer Beobachter Create a book Youth wing Hitler Youth Download as PDF Paramilitary Sturmabteilung -

Historicizing German Depictions of Poles, 1919-1934 THESIS
Das Deutsche Polenbild: Historicizing German Depictions of Poles, 1919-1934 THESIS Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in the Graduate School of The Ohio State University By Paul N Niebrzydowski Graduate Program in History The Ohio State University 2012 Master's Examination Committee: Alan Beyerchen, Advisor James Bartholomew Christopher Otter Copyright by Paul N Niebrzydowski 2012 Abstract After the armistice that marked the end of the Great War, the continuing conflict on Germany’s eastern border contributed to the weakened German self-image. Poles, newly confident and militaristic after having witnessed the rebirth of their nation, stood as a perceived, and oftentimes real, threat to the German state and identity. The present work explores how the experience of conflict between Germans and Poles on Germany’s eastern border contributed to a change in inflection of German stereotypes of Poles. Though still bearing the mark of 19 th century stereotypes, which cast the Poles as backward and fit to be colonized, interwar propaganda added an image of Poles as an aggressive and militaristic threat to the German identity. The uprising in Posen and the administration of the Upper Silesian plebiscite stood out in Germans' minds as examples of Germany's weakening sovereignty, not only in the face of its neighbor, but also at the hands of the Allies. When the Nazis came to power, they employed a renewed rhetoric of colonization of the east. Whereas Germany's colonies had been lost after the Great War, the Third Reich hoped to once again colonize the east.