Bayerisches· . · · "Volksk
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
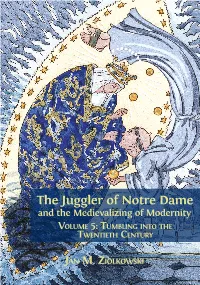
The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity VOLUME 5: TUMBLING INTO the TWENTIETH CENTURY
The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity VOLUME 5: TUMBLING INTO THE TWENTIETH CENTURY JAN M. ZIOLKOWSKI THE JUGGLER OF NOTRE DAME VOLUME 5 The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity Vol. 5: Tumbling into the Twentieth Century Jan M. Ziolkowski https://www.openbookpublishers.com © 2018 Jan M. Ziolkowski This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the work; to adapt the work and to make commercial use of the work providing attribution is made to the author (but not in any way that suggests that he endorses you or your use of the work). Attribution should include the following information: Jan M. Ziolkowski, The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity. Vol. 5: Tumbling into the Twentieth Century. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2018, https://doi.org/10.11647/OBP.0148 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. In order to access detailed and updated information on the license, please visit https://www. openbookpublishers.com/product/821#copyright Further details about CC BY licenses are available at http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Digital material and resources associated with this volume are available at https://www.openbookpublishers. -

13732073012.Pdf
Relaciones. Estudios de historia y sociedad ISSN: 0185-3929 [email protected] El Colegio de Michoacán, A.C México Olivier, Christin La mundialización de María. Topografías sagradas y circulación de las imágenes Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXXV, núm. 139, 2014, pp. 305-333 El Colegio de Michoacán, A.C Zamora, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13732073012 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto La mundialización de María. Topografías sagradas y circulación de las imágenes Olivier Christin UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES-Va SECCIÓN (PARÍS) A fines de los años 1650 se publica en alemán y en latín un pequeño libro ilus- trado intitulado Atlas Marianus, que su autor, el jesuita Wilhelm Gumppen- berg, concibe como la primera parte de una suma inmensa por venir, con la cual pensaba censar todos los santuarios del mundo católico que albergaban imágenes milagrosas de la Virgen María, incluyendo los de la América ibérica. Esta suma final se publica en 1672, sin ilustraciones. Obra de toda una vida, sostenida por una amplia red de informadores, el Atlas alcanza un grado hasta entonces desconocido de explicitación y de argumentación, las relaciones que la Iglesia y los poderes católicos establecen entonces entre cartografía y hagio- grafía, poniendo los territorios europeos y extraeuropeos bajo el patrocinio de santos nacionales o de vírgenes específicas. -
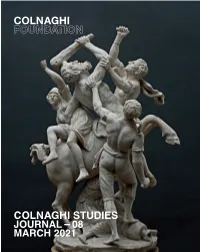
Journal 08 March 2021 Editorial Committee
JOURNAL 08 MARCH 2021 EDITORIAL COMMITTEE Stijn Alsteens International Head of Old Master Drawings, Patrick Lenaghan Curator of Prints and Photographs, The Hispanic Society of America, Christie’s. New York. Jaynie Anderson Professor Emeritus in Art History, The Patrice Marandel Former Chief Curator/Department Head of European Painting and JOURNAL 08 University of Melbourne. Sculpture, Los Angeles County Museum of Art. Charles Avery Art Historian specializing in European Jennifer Montagu Art Historian specializing in Italian Baroque. Sculpture, particularly Italian, French and English. Scott Nethersole Senior Lecturer in Italian Renaissance Art, The Courtauld Institute of Art, London. Andrea Bacchi Director, Federico Zeri Foundation, Bologna. Larry Nichols William Hutton Senior Curator, European and American Painting and Colnaghi Studies Journal is produced biannually by the Colnaghi Foundation. Its purpose is to publish texts on significant Colin Bailey Director, Morgan Library and Museum, New York. Sculpture before 1900, Toledo Museum of Art, Ohio. pre-twentieth-century artworks in the European tradition that have recently come to light or about which new research is Piers Baker-Bates Visiting Honorary Associate in Art History, Tom Nickson Senior Lecturer in Medieval Art and Architecture, Courtauld Institute of Art, underway, as well as on the history of their collection. Texts about artworks should place them within the broader context The Open University. London. of the artist’s oeuvre, provide visual analysis and comparative images. Francesca Baldassari Professor, Università degli Studi di Padova. Gianni Papi Art Historian specializing in Caravaggio. Bonaventura Bassegoda Catedràtic, Universitat Autònoma de Edward Payne Assistant Professor in Art History, Aarhus University. Manuscripts may be sent at any time and will be reviewed by members of the journal’s Editorial Committee, composed of Barcelona. -

2015 Bibliography
University of Dayton eCommons Marian Bibliographies Research and Resources 2015 2015 Bibliography Sebastien B. Abalodo University of Dayton, [email protected] Gloria Falcão Dodd University of Dayton, [email protected] Follow this and additional works at: https://ecommons.udayton.edu/imri_bibliographies eCommons Citation Abalodo, Sebastien B. and Dodd, Gloria Falcão, "2015 Bibliography" (2015). Marian Bibliographies. 14. https://ecommons.udayton.edu/imri_bibliographies/14 This Bibliography is brought to you for free and open access by the Research and Resources at eCommons. It has been accepted for inclusion in Marian Bibliographies by an authorized administrator of eCommons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Marian Bibliography 2015. International Marian Research Institute, University of Dayton, Ohio, USA. Bibliography 2015 English Anthropology Honkasalo, Marja-Liisa. “If The Mother of God Does Nfot Listen: Women's Contested Agency and the Lived Meaning of the Orthodox Religion in North Karelia”. Journal of American folklore 128, no. 507 (2015): 65-92. Apparitions Bitel, Lisa M., and Gainer, Matt. Our Lady of the Rock: Vision and Pilgrimage in the Mojave Desert. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015. Also eBook. Carmel of Coimbra. A Pathway under the Gaze of Mary: A Biography of Sister Maria Lucia of Jesus and the Immaculate Heart. Edited by Barbara Ernster. Translated by James A. Colson. Washington, NJ: World Apostolate of Fatima, 2015. Connell, Janice T. Meetings with Mary: Visions of the Blessed Mother. [n.p.]: Penguin Random House LLC, 2015. Also eBook. Deirdre de la Cruz. Mother Figured: Marian Apparitions and the Making of a Filipino Universal. Chicago: The University of Chicago Press, 2015. -
![[ULB] Images De La Vierge, Récits D'origine Et Pèlerinages Marials En E](https://docslib.b-cdn.net/cover/7354/ulb-images-de-la-vierge-r%C3%A9cits-dorigine-et-p%C3%A8lerinages-marials-en-e-6817354.webp)
[ULB] Images De La Vierge, Récits D'origine Et Pèlerinages Marials En E
Jean-Marie SANSTERRE, Université Libre de Bruxelles [ULB] Images de la Vierge, récits d’origine et pèlerinages marials en Europe occidentale dans les derniers siècles du Moyen Âge. Quelques exemples tirés d’une recherche en cours [Exposé fait le 4 mai 2015 à l’Université Libre de Bruxelles au cours-conférence « Cultures et sociétés du Moyen âge occidental » d’Alain Dierkens et Alexis Wilkin. L’exposé, repris tel quel, est précédé de l’exemplier distribué en séance. Comme le cours ne s’adressait pas seulement à des étudiants médiévistes, les textes ont été présentés en traduction française. Dans cette 2e version (mise en ligne le 1er juin 2015), je joins l’original, sauf pour les textes français présentés avec une orthographe et une ponctuation modernisées.] Exemplier Orientation bibliographique [Aucune étude d’ensemble, mais de nombreux travaux utiles à divers égards que ce soit pour la période envisagée, ou à titre de comparaison, pour les siècles ultérieurs. La liste n’est nullement exhaustive] — Marlène ALBERT LLORCA, Les Vierges miraculeuses. Légendes et rituels, Paris, Gallimard, 2002 (Le temps des images) [remarquable recherche anthropologique, sensible à la dimension historique, centrée sur les Vierges catalanes]. —Michele BACCI, « Pro remedio animae ». Immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale (secoli XIII e XIV), Pise, Gisem - Edizioni ETS, 2000 (« Piccola Biblioteca Gisem », 15). e e — Nicolas BALZAMO, Les deux cathédrales. Mythe et histoire à Chartres (XI –XX siècle), Paris, Les Belles Lettres, 2012 (Vérité des mythes). e — Nicolas BALZAMO, Les miracles dans la France du XVI siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2014 (Le Miroir des Humanistes). -

00 Revista Mirando Santuario 2017.Indd
mirando al Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza • Andújar Abril 2017 Época II nº 31 Real e Ilustre santuario Editorial 31 n año más la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, publica su revista MIRANDO AL SANTUARIO. Desde esta publicación cofrade, damos la bienvenida a nuestro nuevo obispo de la Diócesis, D. Amadeo Rodríguez Magro, al que desea- Umos una fructífera labor pastoral. MIRANDO AL SANTUARIO cumple su número 31 en la segunda época y desea recordar una singular e importante conmemoración, el 400 aniversario de la publica- ción del libro Los trabajos de Persiles y Segismunda de D. Miguel de Cervantes Saavedra, en el que nos habla de la romería de la Virgen de la Cabeza. Nunca estaremos sufi cientemente agradecidos al autor de El Quijote, del bello texto que nos dejó de tan singular y universal fi esta y devoción mariana. De ello da- mos cuenta en las siguientes páginas. Como viene siendo habitual MIRANDO AL SANTUARIO prosigue en la línea habitual de contenidos, incorporando a nuevos colaboradores; que junto a los más habituales, nos aportan sugerentes conocimientos sobre Ntra. Sra. de la Cabeza de Sierra Morena. Nuestro agradecimiento, una vez más, a todos los autores de los distintos tra- bajos que aquí podemos leer y a los anunciantes, sin ambos no podríamos publicar MIRANDO AL SANTUARIO. Mirando Mirando al Santuario II época N. 31 - Abril 2017 c/ Vendederas, 20 www.virgen-de-la-cabeza.es Director: Enrique Gómez Martínez Consejo de redacción: Junta Gestora Consejo asesor: Andrés Borrego Toledano, Francisco Fuentes Chamocho, José Luis Pantoja Vallejo, Manuel Peláez del Rosal, Salvador Rodríguez Becerra y José Carlos de Torres Martínez. -
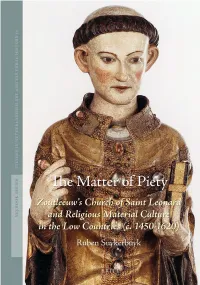
Download: Brill.Com/Brill-Typeface
The Matter of Piety Studies in Netherlandish Art and Cultural History Editorial Board H. Perry Chapman (University of Delaware) Yannis Hadjinicolaou (University of Hamburg) Tine Meganck (Vrije Universiteit Brussel) Herman Roodenburg (Formerly Meertens Institute and Free University Amsterdam) Frits Scholten (Rijksmuseum and University of Amsterdam) Advisory Board Reindert Falkenburg (New York University) Pamela Smith (Columbia University) Mariët Westermann (New York University) VOLUME 16 The titles published in this series are listed at brill.com/nach The Matter of Piety Zoutleeuw’s Church of Saint Leonard and Religious Material Culture in the Low Countries (c. 1450-1620) By Ruben Suykerbuyk LEIDEN | BOSTON Publication of this book has been aided by Ghent University and the Research Foundation – Flanders (FWO). This is an open access title distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Further information and the complete license text can be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ The terms of the CC license apply only to the original material. The use of material from other sources (indicated by a reference) such as diagrams, illustrations, photos and text samples may require further permission from the respective copyright holder. Cover illustration: Anonymous, Saint Leonard, c. 1350–1360, Zoutleeuw, church of Saint Leonard (© KIK-IRPA, Brussels). The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://lccn.loc.gov/2020022180 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. -

Die Marianischen Wandbespannungen Der Kirche Am Hof Im Kontext Jesuitischer Frömmigkeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die marianischen Wandbespannungen der Kirche Am Hof im Kontext jesuitischer Frömmigkeit Verfasserin Margret Kaufmann angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im März 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin / Betreuer: Ao. Univ. Prof. Dr. Monika Dachs-Nickel Danksagung An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meiner Diplomarbeitsbetreuerin Ao. Prof. Dr. Monika Dachs-Nickel für die Unterstützung bei der Umsetzung meiner Arbeit bedanken. Mein besonderer Dank gilt auch Brigitte Futscher, durch die ich zu diesem spannenden Thema gekommen bin und die mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Dr. Gregor M. Lechner OSB von der Graphischen Sammlung im Stift Göttweig und Dr. Peter Stoll von der Universitätsbibliothek Augsburg danke ich für den interessanten Austausch und die wertvollen Hinweise. Ebenso Kirchenrektor Pater Ilija Vrdoljak, der mir jederzeit den Zugang zu den Wandbespannungen in der Kirche Am Hof ermöglicht hat. Mein inniger Dank gilt natürlich meiner Familie und allen meinen Freunden die mich vielfältig unterstützt haben. Die marianischen Wandbespannungen der Kirche Am Hof im Kontext jesuitischer Frömmigkeit Einleitung……………………………………………………………………………………………........…..1 I. Die Kirche Am Hof im Überblick 1. Baugeschichte und Ausstattung.................................................................................... 3 2. Die Marienverehrung der Jesuiten und deren künstlerischer Ausdruck.......7 -
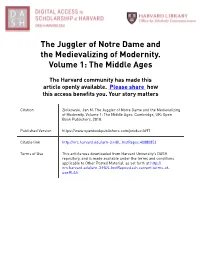
The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity. Volume 1: the Middle Ages
The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity. Volume 1: The Middle Ages The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Ziolkowski, Jan M. The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity. Volume 1: The Middle Ages. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2018. Published Version https://www.openbookpublishers.com/product/697 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:40880853 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity VOLUME 1: THE MIDDLE AGES JAN M. ZIOLKOWSKI THE JUGGLER OF NOTRE DAME VOLUME 1 The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity Vol. 1: The Middle Ages Jan M. Ziolkowski https://www.openbookpublishers.com © 2018 Jan M. Ziolkowski The text of this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the author(s), but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work. Attribution should include the following information: Jan M. Ziolkowski, The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity. -

For People Who Love Maps
159 INTERNATIONAL MAP COLLECTORS’ SOCIETY DECEMBER 2019 No.159 FOR PEOPLE WHO LOVE MAPS JOURNAL ADVERTISING Index of Advertisers 4 issues per year Colour BW Altea Gallery 4 Full page (same copy) £950 - Antiquariaat Sanderus 27 Half page (same copy) £630 - Quarter page (same copy) £365 - Barry Lawrence Ruderman outside back cover For a single issue Catawiki 55 Full page £380 - Collecting Old Maps 64 Half page £255 - Quarter page £150 - Clive A. Burden Ltd 62 Flyer insert (A5 double-sided) £325 £300 Daniel Crouch Rare Books 2 Advertisement formats for print Dominic Winter 17 We can accept advertisements as print ready CMYK Doyle 28 artwork saved as tiff, high quality jpegs or pdf files. Forum Auctions 49 It is important to be aware that artwork and files that Frame 26 have been prepared for the web are not of sufficient quality for print. Full artwork specifications are Jonathan Potter 50 available on request. Kenneth Nebenzahl, Inc. 60 Kunstantiquariat Monika Schmidt 26 Advertisement sizes Please note recommended image dimensions below: Le Bail-Weissert 48 Full page advertisements should be 216 mm high Loeb-Larocque 55 x 158 mm wide and 300–400 ppi at this size. The Map House inside front cover Half page advertisements are landscape and 105 mm Martayan Lan 27 high x 158 mm wide and 300–400 ppi at this size. Maps Perhaps 41 Quarter page advertisements are portrait and are 105 mm high x 76 mm wide and 300–400 ppi at this size. Miami Map Fair 17 Milano Map Fair 62 IMCoS website Web banner Mostly Maps 64 Those who advertise in our Journal have priority in taking a web banner also. -

Eremiten Im Barocken Bayern Mentalität Und Wandel Regensburger Schriften Zur Volkskunde/ Vergleichenden Kulturwissenschaft
Regensburger Schriften zur Volkskunde/Vergleichenden Kulturwissenschaft Georg Werner Eremiten im barocken Bayern Mentalität und Wandel Regensburger Schriften zur Volkskunde/ Vergleichenden Kulturwissenschaft herausgegeben vom Regensburger Verein für Volkskunde e.V. Daniel Drascek Helmut Groschwitz Gunther Hirschfelder Bärbel Kleindorfer-Marx Erika Lindig Band 30 © Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch. Georg Werner Eremiten im barocken Bayern Mentalität und Wandel Waxmann 2017 Münster • New York © Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch. Diese Arbeit wurde im Jahr 2016 von der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität Regensburg als Dissertation angenommen. Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Regensburger Schriften zur Volkskunde/ Vergleichenden Kulturwissenschaft, Bd. 30 ISSN 2196-9558 Print-ISBN 978-3-8309-3632-9 E-Book-ISBN 978-3-8309-8632-4 Waxmann Verlag GmbH, 2017 www.waxmann.com [email protected] Umschlaggestaltung: Pleßmann Kommunikationsdesign, Ascheberg Titelbild: Kraiburg am Inn, Fisslkling: Wallfahrtskirche St. Salvator mit Klause, Foto © Georg Werner Satz: Eva Lerche, Münster Druck: CPI books GmbH, Leck Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier, säurefrei gemäß ISO 9706 Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil -

9780295743813.Pdf (14.58Mb)
JESUITS AND MATRIARCHS JESUITS AND MATRIARCHS DOMESTIC WORSHIP IN EARLY MODERN CHINA NADINE AMSLER University of Washington Press Seattle Jesuits and Matriarchs was made possible in part by a grant from the James P. Geiss and Margaret Y. Hsu Foundation. Support for this publication was also provided by the Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange. The prepress of this publication was funded by the swiss national science foundation. Copyright © 2018 by the University of Washington Press Printed and bound in the United States of Amer i ca Composed in Minion Pro, typeface designed by Robert Slimbach 22 21 20 19 18 5 4 3 2 1 The digital edition of this book may be downloaded and shared under a Creative Commons Attribution Non-commercial No derivatives 4.0 international license (CC-BY-NC-ND 4.0). For information about this license, see https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0. To use this book, or parts of this book, in any way not covered by the license, please contact University of Washington Press. This license applies only to content created by the author, not to separately copyrighted material. University of Washington Press www. washington . edu / uwpress Maps by Jennifer Shontz, Red Shoe Design Cover illustration: Woodblock print from João da Rocha’s Rules for Reciting the Rosary (1619). Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program. Library of Congress Cataloging- in- Publication Data lc record available at https://lccn.loc.gov/2018011124 isbn 978-0-295-74379-0 (hardcover), isbn 978-0-295-74380-6 (pbk), isbn 978-0-295-74381-3 (ebook) To my parents CONTENTS Acknowl edgments ix Maps xi introduction 3 1.