Formatvorlage Univerlag Göttingen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dgzrs Längsseits
AUSGABE 1 / 2014 DEUTSCHE GESELLSCHAFT ZUR RETTUNG SCHIFFBRÜCHIGER Längsseits Erste Amtshandlung: Klaus Lage stellte als neuer ehrenamtlicher „Bootschafter“ der Seenotretter die Einsatzzahlen für das abgelaufene Jahr 2013 vor. Anschließend ging es an Bord der HERMANN MARWEDE auf Kontrollfahrt – im Hintergrund ist der Seenotkreuzer HERMANN HELMS/Station Cuxhaven zu sehen. Einsatzbilanz 2013 der Seenotretter – Musiker Klaus Lage neuer „Bootschafter“ Bei 2.081 Einsätzen 718 nach einigen Jahren mit auffallend vielen „Monopoli“ und „Faust auf Faust“. Klaus Menschen aus Seenot gerettet Geretteten diese Werte bei einer ver - Lage gehört seit drei Jahrzehnten zu den gleichsweise kurzen Wassersportsaison erfolgreichsten und zugleich beständig - und Gefahr befreit auf dem Niveau der Jahre 2009 und zuvor sten Protagonisten der deutschen Mu - stabilisiert. sikszene. Die Seenotretter unterstützt er Die Seenotretter der DGzRS sind im Ver - mit großem Erfolg: Der Rocksänger, Lie - lauf des Jahres 2013 insgesamt 2.081 Rock trifft Retter: Der bekannte Musiker dermacher und Produzent hat auf sei - Mal im Einsatz gewesen ( 2012 : 2.117 Ein - Klaus Lage ist neuer ehrenamtlicher nen Tourneen das rot-weiße Sammel - sätze). Dabei haben die Besatzungen 718 „Bootschafter“ der Seenotretter. Das Pu - schiffchen dabei. Menschen aus Seenot gerettet oder Ge - blikum kennt den gebürtigen Nieder - fahr befreit ( 2012 : 1.323 ). Die Einsatz - sachsen mit den lächelnden Augen hin - Lage löst den Moderator, Schauspieler zahlen liegen damit auf gleichbleibend ter der leicht getönten Brille vor allem und erfolgreichen Autor Yared Dibaba hohem Niveau. Allerdings haben sich durch Lieder wie „ 1000 und 1 Nacht“, ab, der die Arbeit der Seenotretter im zu - L 2 3 LÄNGSSEITS · AUSGABE 1 / 2014 rückliegenden Jahr mit großem Engage - ment begleitet hat. -

PDF Download
Februar 2017 Comedy-Spezial Nuhr, Kebekus, Schneider und mehr Meister der Illusion Die Ehrlich Brothers im Interview STADTTEIL- RUNDGANG Habenhausen: Das Dorf in der Bitte kein Zittern Stadt Werder startet in die Rückrunde Mit Lara Trautmann durch die kalte Jahreszeit Winter an der Weser EDITORIAL Hurra, der Alles, was Bremen und Winter ist da … „Der Winter ist gekommen umzu bewegt, auf Zoll! und hat hinweggenommen der Erde grünes Kleid; Schnee liegt auf Blütenkeimen, kein Blatt ist auf den Bäumen, erstarrt die Flüsse weit und breit“ Nun ist er also da, wie in der ab oben zitierte Volksweise von Ro- bert Reinick. Im Januar gab es * tatsächliich den ersten Schnee . , € Und auch wenn er eher spärlich im Monat vorhanden war, nutzten die Kin- der jeden Zentimeter weiß be- Redaktionsleiter Martin Märtens. deckten Grüns um an den Hü- Foto: T. Worthmann geln und Deichen der sonst eher IMPRESSUM flachen Stadt mit ihren Schlitten, Rutschtellern und sonstigen Utensilien herunterzugleiten. Und war es nicht ein wunder- bares Geräusch den leicht knirschenden Schnee beim Spazier- gang unter den Schuhsohlen zu hören? Und wie wohlig fühlte man sich anschließend im warmen Heim einen heißen Tee, Kakao oder Glühwein genießend? Sehen Sie, der Winter ist Herausgeber & Verlag: gar nicht so schlimm. Und deshalb dreht sich unsere aktuelle WESER-KURIER Mediengruppe Ausgabe auch fast komplett um die kalte Jahreszeit – ist doch Magazinverlag Bremen GmbH, der Februar traditionell der Wintermonat in Bremen. Martinistraße 43, 28195 Bremen Also nicht verzagen und auch bei kaltem Wetter die Stadt Telefon genießen. Etwa bei einem Besuch des Dorfes in der Stadt. Di- 04 21 / 36 71-4990 rekt hinter der Erdbeerbrücke gibt es das nämlich tatsächlich: Habenhausen. -

53. Sixdays Bremen WOHLFÜHLEN in SICHT WOHNEN MIT BLICK AUFS WASSER
Januar 2017 Atiye Yilmaz STADTTEIL- Bosporus-Star von der Weser RUNDGANG Auf Entdeckungs- Peter Lüchinger tour in Vegesack Eiswett-Schneider und König Charles Julian Brandt Vom Gänseblümchen-Pflücker zum Nationalspieler Clemens Fritz startet die 53. Sixdays Bremen WOHLFÜHLEN IN SICHT WOHNEN MIT BLICK AUFS WASSER MIETWOHNUNGEN IN DER ÜBERSEESTADT AB FRÜHJAHR Die modernen Weserhäuser liegen große, tiefe Balkone oder Loggien in der Überseestadt nahe des Fußbodenheizung in der malerischen, mehr als hundertjäh- gesamten Wohnung rigen Molenturms, direkt an der helle, bodentiefe Fenster Weser. In diesem dynamischen neuester Energiestandard Stadtteil erlebenSie viele besondere barrierearm Momente, die das Leben lebenswert machen. lichte Deckenhöhe von 2,70m Zur Vermietung kommen 2- bis moderne Bäder mit Handtuchheizkörper und bodengleichen Duschen 4-Zimmer Wohnungen ab ca. 50m. und/oder Wannen BAUHERR VERMIETUNG VERMIETUNG T. 30 80 68 94 T. 20 16 018 2 WWW.WESERHÄUSER.DE EDITORIAL Liebeshoroskop 2017 Liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle finden Sie nor- malerweise unser Editorial. Doch anstatt hier ausführlich auf die im Januar startenden Sixdays einzugehen, Hinweise zum Stadtteilrundgang in Bremen-Vegesack zu machen, über die letzte Musikschau der Nationen zu berichten oder näher auf die Eiswette und den dazugehörigen Schneider einzugehen, haben wir uns ausnahmsweise dazu entschlossen, einen Blick in die Sterne zu wagen. Oder vielmehr haben wir das einen Profi machen lassen. Der gebürtige Bremer Volker Reiner- mann hat jedes Sternzeichen im Hinblick auf „Liebe und Partnerschaft“ astrologisch ausgearbeitet und teilt mit uns seine Prognosen für das Jahr 2017. Viel Spaß beim Lesen wünscht das gesamte Team vom STADTMAGAZIN Bremen! Widder (21. März – 20. April) Ihren Freiheitsdrang stärkt. -
Vergängliche Kunst Die Stadt Im Einkaufskorb Stadtlabor
Januar 2021 Stadtlabor Wie entwickelt sich die Innenstadt? Vergängliche Kunst Kollektiv nutzt altes Coca-Cola-Gelände Die Stadt im Einkaufskorb Neue Produkte und kreative Erzeugnisse aus Bremen Fluglotse, Model, Schauspieler und Stuntman: Durchstarter und Wahlbremer Vu Dinh Das Multitalent Urban trifft grün, Qualität trifft Innovation Eigentumswohnungen in Nähe des Bürgerparks 1 bis 5 Zimmer Hell & barrierefrei Bodentiefe Fenster High-Speed-Internet Echtholzparkett & Mindestens 1 Balkon Fußbodenheizung oder Terrasse JETZT INFORMIEREN! TELEFON: WEBSITE: BAUHERR & VERKAUF: 0421 · 30 80 68 91 www.findorff-living.de 2 EDITORIAL Liebe Bremerinnen Mit uns in besten Händen! Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art in Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! und Bremer, Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung. Wir verfügen über das Know-how und langjährige Erfahrung, kompetent und seriös erledigen wir für Sie die gesamte Abwicklung, vom ersten Kontakt bis zur notariellen Beurkundung des Kaufvertrages und darüber hinaus bleiben wir selbstverständlich ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen! Telefon: 0421 – 61 44 21 Mobil:28277 Bremen 0173 2404099• Tel. 0421-614421/-87189063 / 0177 3381293 [email protected]: 0173 2404099 / 0177 3381293 [email protected] www.basse-immobilien.de IMPRESSUM Herausgeber & Verlag: Foto: Senatspressestelle Foto: WESER-KURIER Mediengruppe Magazinverlag Bremen GmbH hinter uns liegen bewegte und schwere Monate: Gemeinsam Martinistraße 43, 28195 Bremen haben wir den Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgenom- Telefon 04 21 / 36 71-49 90 men. Und den werden wir auch in der kommenden Zeit fortset- E-Mail [email protected] zen müssen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir keinen neuerlichen Redaktion: Martin Märtens (V.i.S.d.P.), Lockdown hätten beschließen müssen. -

Ausgabe-19-02.Pdf
WESER WIRTSCHAFT DAS WIRTSCHAFTSJOURNAL FÜR BREMEN UND UMGEBUNG AUSGABE: FEBRUAR 2019 | JAHRGANG 09 | WWW.WESER-WIRTSCHAFT.DE Qualifi ziertes Personal vom Standort Bremen zu über- zeugen, steht bereits auf der To-do-Liste des Sena- tors für Wirtschaft, Arbeit Weiterhin und Häfen. Denn auch im kleinsten Bundesland sind qualifi zierte Arbeitskräfte auf der mehr als gefragt. Oft tref- fen bei Unternehmen je- doch nicht einmal Bewer- bungen ein oder es mangelt an den Qualifi ka tionen der Bewerber. SUCHE In einer Sonderbefragung im AUS MANGEL AN BEWERBUNGEN Rahmen ihrer Konjunkturumfrage im letzten Herbst hat die Handels- kammer Bremen 403 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienst- leistungen in Bremen befragt. Er- gebnis: 71 Prozent der Befragten – insbesondere die Branchen Ho- tellerie und Gastronomie sowie Verkehr und Logistik – nennen den Fachkräftemangel als eines der größten Geschäftsrisiken in den kommenden zwölf Monaten. Unter- dessen geben 56 Prozent der befrag- ten Unternehmen an, derzeit offene keit bei der Stellenbesetzung mit 67 der Besetzung offener Stellen eine zu marke für Arbeitgeber für das Land händeringend nach qualifiziertem Stellen längerfristig nicht besetzen Prozent dadurch entsteht, zu weni- geringe oder unpassende Qualifi kati- Bremen zu entwickeln. „Wofür steht Personal gesucht. Doch was sagen zu können, weil sie keine geeigneten ge Bewerbungen erhalten zu haben. on der Bewerber an. Auf Platz zwei Bremen als Arbeitsstandort? Welche die Zahlen über Bremen? Und wie Arbeitskräfte fi nden. Der zweithäufi gste Grund sind man- liegt der Punkt „keine Bewerber“ Werte werden hier gelebt, welche steht es eigentlich um Fachkräfte gelnde Qualifi kationen der Bewerber. und zu hohe Forderungen hinsicht- Vorteile bietet das Land, welches in IT-Berufen? Schließlich wird die WETTBEWERB UM Danach folgt die mangelnde Bereit- lich Gehalt oder Arbeitsbedingun- Lebensgefühl herrscht hier?“, ist dort Digitalisierung nicht auf Deutsch- DIE FACHKRÄFTE schaft, die Arbeitsbedingungen wie gen stehen mit 37 Prozent auf dem zu lesen. -

20704719 Block Innenstadtplan 11.10.2007 15:39 Uhr Seite 1
20704719 Block Innenstadtplan 11.10.2007 15:39 Uhr Seite 1 Bremen Sights Heerstr. Blockland A 27 E 234 ̆ Autobahn A 27 Autobahn A 27 ̆ ©28 ©29 ©28 ©29 Bremen-Nord, Bremerhaven, Cuxhaven Bremen-Nord, Bremerhaven, Cuxhaven Bremen-Überseestadt e iralstraße Stapelfeldstr. Gröpelingen UtbremerKindertagesheim Grün Spielplatz schule Bürgerpark Weser © Borgfelder Heerstr. Landwehrstraße Findorff FindoKulturzentrum 17 24 Jugend- und Utbremen BAB-Zubringer Schlachthof Bremerhaven Horn-Lehe Altenheim Struckmannstraße Hollerallee Gröpelinger Heerstr. c Borgfeld Stadtwaldsee Camping Hochschulring Bremer am Stadtwaldsee Plantage Bürgerweide Hollersee Werftstr. Spielplatz Rundfunk- Congress Centrum Seehausen Spielplatz oten museum ©35 © Bremen-Horn-Lehe tkn Bremen 30 s Wiener Str. e Güterbahnhof Universität BAB-Zubringer w Universität rd © Universitäts-Allee o BAB-Zubringer Überseestadt Stadtwald 22 Lilienthaler Heerstr. N Bremerhavener Str. Osterfeuerberger Friedric 2 Ring Sportplatz h-R H au Theodor-Heuss-Allee Neustädter Horn- Spielplatz e AWD-Dome Utbremer Ring Auf dem Kamp r Bgm-Hildebrand-Str. s Hafen Handels- Hemmstr. -S Waller Ring Lehe Leher Heerstr. Senator-Appelt-Str. tr häfen Waller Heerstr. Fürther Str. Nordstr. Volkshaus Doventorste Findorff-Tunnel Parkstraße Walle Versorgungs- Rockwinkler Heerstr. Sporthalle NicolaistraßeSt.- Breitenweg Findorff Oberneulander ©35 amt Merkurstr. © Heerstr. W Michaelis- 32 Horner Heerstr. es T W ta Kirche F Eickedorfer Str. b Sportplätze ri Bahnhofsvorstadt Ludwig-Erhard-Str. © es fa ed 32 t h r ̄ Rablinghausen zu rt ic © S Doventorsdeich h eetjen-Allee 34 © Oberneuland f. t -R Utbremer Str. 23 Rhododendron- -S e Berufsbildungs- i traße D Schwachhauser Ring Oberneulander Landstr. t p nweg rs a - Bürgerpark Park ̄ e h zentrum u v © p a Arbeits- e 25 h r Hansestr. -
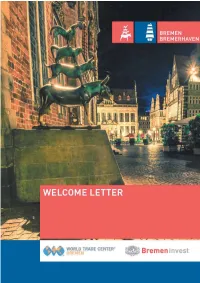
Welcome Letter 2020.Pdf
Table of Contents .......................................................................................................................... Page Welcome to Bremen ........................................................................................................................... 5 Public Transport.................................................................................................................................. 6 Interactive Network Map ................................................................................................................6 Tickets ............................................................................................................................................6 BSAG Customer Centers..................................................................................................................7 BSAG Price Table valid as of 1 January 2020 ....................................................................................8 Taxi Operators .................................................................................................................................... 8 Rail Travel ........................................................................................................................................... 9 Long-distance Coach Travel................................................................................................................. 9 Bremen Airport .................................................................................................................................. -

Dgzrs Längsseits
AUSGABE 4 / 2013 DEUTSCHE GESELLSCHAFT ZUR RETTUNG SCHIFFBRÜCHIGER Längsseits DGzRS-„Bootschafter“ Yared Dibaba steht auf dem Museumskreuzer H.-J. KRATSCHKE. Der bekannte Hörfunk- und Fernsehmoderator stellte die Dreivierteljahres-Einsatzbilanz der Seenotretter vor. Fast 2.000 Einsätze in zehn Monaten 701 Menschen aus Seenot Jahre 2009 und zuvor stabilisiert. Von Ja - In vielen Fällen griffen die Seenotretter gerettet und Gefahr befreit nuar bis Oktober 2013 haben die Besat - frühzeitig ein und begrenzten so Schä - zungen der 60 Seenotkreuzer und Seenot - den bereits im Vorfeld. Zudem sind sie rettungsboote in Nord- und Ostsee 2.583 Mal in ihren Revieren zwischen In den ersten zehn Monaten des Jahres • 60 Menschen aus Seenot gerettet, Borkum im Westen und Ueckermünde 2013 ist die Rettungsflotte der DGzRS • 641 Menschen aus drohender Gefahr im Osten auf Kontrollfahrt gegangen. 1.937 Mal im Einsatz gewesen (Januar bis befreit, Seit ihrer Gründung am 29 . Mai 1865 hat Oktober 2012 : 1.990 Einsätze). Dabei ha - • 363 Mal erkrankte oder verletzte Men - die DGzRS bis Ende Oktober 2013 insge - ben die DGzRS-Besatzungen 701 Men - schen von Seeschiffen, Inseln oder Hal - samt 80 .899 Menschen aus Seenot ge - schen aus Seenot gerettet oder Gefahr ligen zum Festland transportiert, rettet oder Gefahrensituationen auf See befreit (Januar bis Oktober 2012 : 1.126 ). • 34 Schiffe und Boote vor dem Totalver - befreit. lust bewahrt, Nach einigen Jahren mit auffallend vie - • 936 Hilfeleistungen für Wasserfahr - Zu den herausragenden Einsätzen der len Geretteten haben sich die Werte da - zeuge aller Art erbracht sowie ersten zehn Monate des Jahres 2013 mit bei einer vergleichsweise kurzen • 476 Einsatzanläufe und Sicherungs - Wassersportsaison auf dem Niveau der fahrten absolviert. -

Welcome Letter
Table of Contents ............................................................................................................................................... Page Welcome to Bremen ............................................................................................................................................... 5 Local Transport ....................................................................................................................................................... 6 Local Public Transport BSAG .............................................................................................................................. 6 Interactive Network Map .............................................................................................................................. 6 VBN Journey Planner ..................................................................................................................................... 6 Tickets ............................................................................................................................................................ 6 BSAG Customer Centers ................................................................................................................................ 7 BSAG Price Table valid as of 1 January 2021 ................................................................................................. 8 Car Sharing ........................................................................................................................................................ -

Wirtschaft Weser
WESER WIRTSCHAFT DAS WIRTSCHAFTSJOURNAL FÜR BREMEN UND UMGEBUNG AUSGABE: FEBRUAR 2018 | JAHRGANG 08 | WWW.WESER-WIRTSCHAFT.DE Großraumbüros: Der Traum anderen Seite der Austausch mit eines jeden Selbstständigen? völlig anderen Unternehmensfel- dern zu kreativen Ideen verhelfen Was wie ein Widerspruch kann, die einem sonst überhaupt anmutet, ergibt in soge- Gemeinsam stark nicht in den Sinn gekommen wären. nannten Coworking-Spaces COWORKING IN BREMEN durchaus Sinn. Geringe EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN Kosten und der Kontakt zu Ob die „Alte Schnapsfabrik“ in der anderen kreativen Geistern Neustadt, die „Kalle Co-Werkstatt“ sprechen als Faktoren für in Huckelriede oder das „kraftwerk“ beim Bahnhof: Geeignete Locations sich. In den Räumlichkei- für Bremer Gründer gibt es einige. ten von Weserwork und Wie Kai Stührenberg vom Senat Co. wird nicht nur frischen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen beschreibt, kommt es dabei ganz Gründern, sondern auch darauf an, wie unabhängig oder Beschäftigten mit Handicap netzwerknah man arbeiten möchte zu einer Perspektive verhol- – denn nicht selten haben auch die Betreiber der Büros ein unmittelba- fen. Weser- Wirtschaft stellt res Interesse an den Produkten und die modernen Büros vor. Dienstleistungen der beheimateten Start-ups. Viele Neuzugänge haben sich dabei für Weserwork entschie- Das Homeoffi ce nicht zum kon- den: Der größte Coworking-Space zentrierten Arbeiten geeignet? Ein des kleinsten Bundeslands vereint eigenes Büro wegen hoher Mietkos- in der Überseestadt maritimes Flair, ten kaum lukrativ? Wer als Frei- modernes Arbeiten und Integra- berufl er vor dieser vermeintlichen tionsarbeit. Unter Anleitung von Zwickmühle steht, sollte einen Bernhard Havermann, Geschäfts- Schreibtisch in einem Coworking- führer des Integrationsfachdiens- Space in Betracht ziehen. -

Schönheitschirurgie | Gesundheit | Beauty | Reisen | Wellness | Gesundheit Für Schönheitschirurgie | Beauty Journal
Ausgabe 31 | Herbst /Winter 2017 /18 Journal für Schönheitschirurgie | Gesundheit | Beauty | Reisen | Wellness EUR 6,50 SCHÖNHEITSCHIRURGIE Möglichkeiten und Grenzen Venenzentrum Hannover Schonendste und modernste Methoden zur Beseitigung von Krampfadern Ayurveda- Zentrum im Grand Hotel Binz Printer dpi: 1200 Magnification: Bar Height: BWR: 2.50 0.0635 mils 15.0000 mm 83.38% mm Anzeige IHR CLUB AM UFER DES MASCHSEES Ein einzigartiger Ort für alle, die sich zu mehr inspirieren lassen wollen. EIN CLUB DER STETS NACH INNOVATIONEN STREBT EXKLUSIVER PRIVATSTRAND AM MASCHSEE TRAUMHAFTE POOLS & EXKLUSIVER SPA BEREICH VIELFÄLTIGE KURS-UND TRAININGS- ANGEBOTE Erleben Sie bei Aspria eine unvergleichliche Welt des Sports und des Wohlbefindens. Werden Sie jetzt Mitglied. Aspria Hannover Maschsee aspria.com/clubsport Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 83 30519 Hannover 0511 899797-159 Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und liebe Leser! Editorial Wir begrüßen Sie zur neuen Ausgabe Esthetic Pure 2017/18! Vital, gesund und attraktiv – Grundlagen für ein schönes Leben. Daher sind kleinere und größere kosmetische Maßnahmen zum körperlich-seelischen Wohlbefinden auch bei uns in Deutschland längst kein Tabu mehr. Das erfahrene Fach- ärzte-Team der renommierten Kompetenzzentren Eilenriede Klinik Hannover und Klinik am Zuckerberg, Braunschweig, leistet verantwortungsvolle Plastisch-Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie auf höchstem medizinischem Niveau. Mit neuesten Therapie- Verfahren sorgen die Spezialisten für beste Ergebnisse: Facelift, Mid-Facelift, sichere -

Bilderrätsel Hochzeit Fanta 4 Auf Tour
Januar 2019 Hochzeit Tipps für den großen Tag Bilderrätsel Wohlfühlpaket zu gewinnen Fanta 4 auf Tour Smudo im Interview HANSEBAU Alles rund ums Bauen und Wohnen Lennard Kämna – Der Radprofi über die Sixdays, sein Team und die Saisonvorbereitung Es geht wieder rund Provisionsfreier Erwerb direkt vom Bauherrn STILVOLLE EIGENTUMSWOHNUNGEN BEZUGSFERTIG HERBST 2019 Die Stadtvillen Habenhausen – das sind 3 ge- Ausstattung schmackvoll gestaltete Wohnhäuser, die insgesamt · 2- bis 4-Zi.-Wohnungen · Echtholzparkett 39 Eigentumswohnungen beherbergen. Archi- · barrierearm · High-Speed-Internet tektonisch treffen hier mediterrane Bauweise und · Fußbodenheizung · Sonnenbalkone südländisches Flair auf nordischen Purismus. · Tiefgarage, Lift · moderne Bäder VERKAUF & BAUHERR: BERATUNG & VERKAUF: 0421· 30 80 68 97 0421· 17 39 333 [email protected] [email protected] 2 www.stadtvillen-habenhausen.de EDITORIAL Ein herzliches Danke Viel Neues in 2019 an unsere geschätzten Kunden und Geschäftspartner, verbunden mit den besten Wünschen al ehrlich, was haben Sie sich für das neue für ein fröhliches M Jahr vorgenommen? Weihnachtsfest, Vielleicht mit dem Rauchen aufzuhören, sich gesünder zu einen guten Rutsch ernähren oder gar mehr Sport zu machen? ins Neue Jahr, Da kommen die Sixdays, für 2019 das Allerbeste... mit denen das Jahr in Bremen Zeit für die wichtigen Dinge... startet, ja genau richtig. Sechs Gesundheit, Zufriedenheit und Glück... Tage lang sorgen sie für eine Art Ausnahmezustand in der Stadt, Ihr Team von wie es sonst nur der Freimarkt 0421-614421 • Mobil 0177-3381293 • 0173-2404099 • www.basse-immobilien.de oder Werder schaffen. Vielleicht haben Sie sich Redaktionsleiter Martin Märtens. aber auch vorgenommen, ein Foto: S. Strangmann Haus zu bauen oder die Woh- Erstmals erscheinen wir 2019 mit zwölf Ausgaben.