Bachelorarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ne Xamax FC BASEL 1893 Dimanche 14 Fevrier 2010 STADE DE LA MALADIÈRE À 16H00
N° 28, saison 2009/10 Axpo Super League NE XAMAX FC BASEL 1893 DIMANCHE 14 FEVriER 2010 STADE DE LA MALADIÈRE À 16H00 Shkelzen Gashi EDITORIAL Après deux mois d’interruption, la compétition a enfin recommencé. La préparation hivernale s’est très bien déroulée, avec un stage d’oxy- génation à Couvet (magnifiques installations et accueil extraordinaire), trois matches amicaux en Suisse (une victoire et deux nuls), un stage de 10 jours en Espagne où l’équipe a pu s’entraîner dans d’excellentes conditions. Durant cette pause, le mercato (au 1er février) a été actif au sein du club. Nos deux attaquants Brown et Gavranovic vont poursuivre leur aventure à l’étranger. Nous leur souhaitons plein succès. Cordiale bienvenue au nouveau centre-avant Sanel Kuljic, appelé pour entourer nos jeunes joueurs et faire trembler les filets adverses. La convoitise de nos joueurs démontre l’excellence du travail effectué par Pierre-André Schurmann et toute son équipe. C’est clair il faut repartir, relancer la machine, mais tous ensemble avec vous également cher public, cette deuxième phase peut nous donner de grandes satisfactions. Bienvenue au FC Bâle ce jour de la Saint-Valentin. Belle Fête aux Amoureux en espérant que Xamax pourra vous donner un joli cadeau, sous la forme de trois points bien emballés avec du papier de soie rouge et noir. Au nom de la Direction Philippe Salvi 3 IMPRESSUM SOMMAIRE Editeur 3 Editorial Neuchâtel Xamax S.A. Quai Robert-Comtesse 3 Case postale 2749 5 Impressum 2001 Neuchâtel Sommaire Tél. 032 725 44 28 [email protected] 7-11 Entraîneurs/Joueurs www.xamax.ch Marketing 12-13 Des nouvelles de PRO’IMAX SA la relève Quai Robert-Comtesse 3 2000 Neuchâtel 15 Photo Souvenir PARTAGER DES Tél. -

Topps Match Attax Bundesliga 2008/2009
www.soccercardindex.com Topps Match Attax German Bundesliga 2008/09 checklist Herta Berlin Werder Bremen Eintracht Frankfurt Hoffenheim □1 Jaroslav Drobny □55 A Tim Wiese (Citybank) □109 Markus Pröll 163 Ramazan Özcan □2 Josip Simunic □55 B Tim Wiese (Bwin) □110 Aaron Galindo 164 Andreas Beck □3 Kaka Ii □56 Sebastian Boenisch □111 Christoph Spycher 165 Andreas Ibertsberger □4 Marc Stein □57 Naldo □112 Habib Bellaid 166 Isaac Vorsah □5 Sofian Chahed □58 Per Mertesacker □113 Marco Russ 167 Marvin Compper □6 Steve Von Bergen □59 Petri Pasanen □114 Patrick Ochs 168 Matthias Jaissle □7 Cicero Santos □60 Sebastian Prödl □115 Benjamin Köhler 169 Per Nilsson □8 Fabian Lustehberger □61 Clemens Fritz □116 Caio 170 Zsolt Löw □9 Gojko Kacar □62 Daniel Jensen □117 Chris 171 Francisco Copado □10 Lukasz Piszczek □63 Frank Baumann □118 Faton Toski 172 Jochen Seitz □11 Maximilian Nicu □64 Jurica Vranjes □119 Junichi Inamoto 173 Luis Gustavo □12 Pal Dardai □65 Mesut Özil □120 Markus Steinhöfer 174 Sejad Salihovic □13 Patrick Ebert □66 Aaron Hunt □121 Michael Fink 175 Selim Teber □14 Valeri Domovchiyski □67 Boubacar Sanogo □122 Alexander Meier 176 Demba Ba □15 Andrej Voronin □68 Claudio Pizarro □123 Martin Fenin 177 Vedad Ibisevic □16 Raffael □69 Hugo Almeida □124 Nikos Liberopoulos 178 Wellington □17 Star - Arne Friedrich □70 Markus Rosenberg □125 Star - Ümit Korkmaz 179 Star - Carlos Eduardo □18 Star - Marko Pantelic □71 Star - Diego □126 Star - Ioannis Amanatidis 180 Star - Chinedu Obasi □72 Star - Torsten Frings Arminia Bielefeld Hamburger Sv Karlsruher -
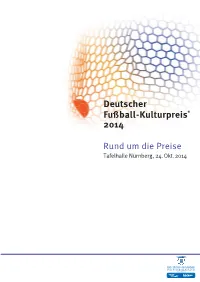
KUF Fußball Programm 2014 04
Deutscher Fußball-Kulturpreis 2014 Rund um die Preise Tafelhalle Nürnberg, 24. Okt. 2014 Inhalt 1 Programm Gala 2014 4 10 Jahre Deutsche Akademie für Fußball-Kultur Programmrückblick und Mitglieder 10 Lernanstoß – Der Fußball-Bildungspreis 11 Der Sieger 2014: „CHoG Kids“, Champions ohne Grenzen, Berlin 13 Die Bewerber 15 Die Jury 16 Fußballspruch des Jahres 17 Die vier besten Sprüche in den Halbfinals 18 Die Platzierungen im Überblick 19 Die Jury 20 Fußballbuch des Jahres 21 Der Sieger 2014: Reuel Golden mit „The Beautiful Game“ 24 Die Platzierungen im Überblick 25 Die Nominierungen 31 Die Jury 32 Fußball-Hörspiel des Jahres 33 Der Sieger 2014: Simon Schneider mit „La vida no termina aqui“ 34 Die Platzierungen im Überblick 37 Die Jury 38 Walther-Bensemann-Preis 39 Der Sieger 2014: Ottmar Hitzfeld 43 Die Jury 44 Impressum und Dankeschön Deutscher Fußball-Kulturpreis 2014 Die Gala zur Preisverleihung Freitag, 24. Oktober 2014, 20 Uhr Tafelhalle Nürnberg 1 Programm Lernanstoß – Der Fußball-Bildungspreis 2014 Verleihung an das Projekt „Champions ohne Grenzen – Kids“, Champions ohne Grenzen e.V., Berlin Würdigung durch den Juryvorsitzenden Norbert Niclauß, BKM, Berlin Preisverleihung durch Nicole Hummel, TESSLOFF Verlag Fußball-Hörspiel des Jahres – Der easyCredit-Fanpreis 2014 Verleihung an Simon Schneider für „La vida no termina aquí“ Würdigung durch Hans Sarkowicz, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main Preisverleihung durch Alexander Boldyreff, easyCredit Fußballspruch des Jahres 2014 LIVE-Abstimmung des Publikums über den Fußballspruch -

Timo Bernhard Siegt Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Homburg 1:0; 1
DIE RHEINPFALZ — NR. 74 SPORT-ZAHLENSPIEGEL MONTAG, 29. MÄRZ 2010 04_SPOR FUSSBALL FUSSBALL HANDBALL HANDBALL Frauen-Oberliga 3. Liga C-Junioren Regionalliga Südwest: TuS Mayen - FC Timo Bernhard siegt Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Homburg 1:0; 1. FC Saarbrücken - FC Metternich 7:1; 1. FC Kopenhagen - THW Kiel 31:33 TSV Kandel - TG Konz 29:23 (13:10). Kandel: Benz Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden 0:1 (8), Wüst (7/4), Raunft (5/2), Heib (4), Ahrens (3), Kickers Offenbach - SpVgg Unterhaching 1:3 FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 1:2; SVW Mainz - JFG KS Vive Kielce - HSV Hamburg 29:30 Saarlouis 2:0; Eintracht Trier - JFG Saar-Halberg 4:1; BM Valladolid - Rhein-Neckar Löwen 29:30 Mühl (2) Erzgebirge Aue - Bayern München II 2:0 HSG Wittlich - TV Ruchheim 29:15 Rot-Weiß Erfurt - SV Sandhausen 1:0 Spfr. Eisbachtal - TuS Koblenz 1:5; VfL Osnabrück - Wehen Wiesbaden 0:0 Europapokal der Pokalsieger, Viertelfinale, Hinspiel HBC Bascharage - TV Ruchheim 20:11 (10:4). Ruch- FSV Mainz 05 17 47 Lu'hafener SC 17 21 Tvis Holstebro/Dänemark - VfL Gummersbach 27:32 heim: Lauer (3), Schnaubelt, Gräf, Blanz (je 2), Hügel- Borussia Dortmund II - VfB Stuttgart II 1:2 1.FC K'lautern 17 45 SVW Mainz 17 17 Wacker Burghausen - 1. FC Heidenheim 1:3 schäfer, Foß 1.FC Saarbrücken 15 41 JFG Saar-Halberg 17 16 TSG Friesenheim - SV Zweibrücken 30:30 (16:19). FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg 2:2 Eintr. Trier 18 35 SV Gonsenheim 17 11 Bundesliga: Füchse Berlin - HSG Wetzlar 28:26; GWD Werder Bremen II - Carl Zeiss Jena 1:2 Minden - TV Großwallstadt 26:34; Hannover-Burgdorf - Friesenheim: Helmer (6), Fink (5/2), Senk (4), Hauser TuS Koblenz 17 32 JFG Saarlouis 18 10 (4), Spuhler (4/2), Falk (3), Heßler (3), Mauersberger - Holstein Kiel - Wuppertaler SV 1:1 TuS Mayen 17 31 FC Homburg 16 7 HSG Düsseldorf 28:26; SC Magdeburg - Nettelst.-Lübbe- cke 34:29 SV: Leiner (9), Depta (8/4), Leonhardt (7), Weick (2), 1. -

FC Bayern München - Getafe CF MATCH PRESS KIT Allianz Arena, Munich Thursday 3 April 2008 - 20.45 CET (20.45 Local Time) Quarter-Finals, - Matchday 10
FC Bayern München - Getafe CF MATCH PRESS KIT Allianz Arena, Munich Thursday 3 April 2008 - 20.45 CET (20.45 local time) Quarter-finals, - Matchday 10 Contents 1 - Match background 6 - Competition facts 2 - Squad list 7 - Team facts 3 - Match officials 8 - Competition information 4 - Domestic information 9 - Legend 5 - Match-by-match lineups Match background UEFA Cup favourites FC Bayern München host rank outsiders Getafe CF in the quarter-finals with Michael Laudrup seeking a first win on German soil. • The two sides have never met in European club competition. • Bayern have played in plenty of games against Spanish sides over the years – 33 in total – winning 17, drawing eight and losing eight. • Their 15 home games against Spanish sides have produced eleven wins, three draws and one defeat. • Bayern have won two European finals against Spanish sides. They beat Club Atlético de Madrid 5-1 over two legs to claim the 1973/74 European Champion Clubs' Cup, and then beat Valencia CF 5-4 on penalties after a 1-1 draw in the 2000/01 UEFA Champions League final in Milan. • Getafe by contrast are up against German opposition for the first time. • Rubén De La Red can at least claim to have seen the inside of the Fußball Arena München before, having been an unused substitute as Real Madrid CF lost 2-1 in the second leg of last season's UEFA Champions League first knockout round. His side lost on away goals with the aggregate score 4-4. • Bayern coach Ottmar Hitzfeld has never won the UEFA Cup before, although he has twice triumphed in the UEFA Champions League – with BV Borussia Dortmund in 1996/97 and in his first spell with Bayern in 2000/01. -

Discussion Papers
1432 Discussion Papers Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 2014 Career Prospects and Eff ort Incentives: Evidence from Professional Soccer Jeanine Miklós-Thal and Hannes Ullrich Opinions expressed in this paper are those of the author(s) and do not necessarily reflect views of the institute. IMPRESSUM © DIW Berlin, 2014 DIW Berlin German Institute for Economic Research Mohrenstr. 58 10117 Berlin Tel. +49 (30) 897 89-0 Fax +49 (30) 897 89-200 http://www.diw.de ISSN electronic edition 1619-4535 Papers can be downloaded free of charge from the DIW Berlin website: http://www.diw.de/discussionpapers Discussion Papers of DIW Berlin are indexed in RePEc and SSRN: http://ideas.repec.org/s/diw/diwwpp.html http://www.ssrn.com/link/DIW-Berlin-German-Inst-Econ-Res.html Career Prospects and Effort Incentives: Evidence from Professional Soccer∗ Jeanine Mikl´os-Thaly Hannes Ullrichz Abstract It is difficult to test the prediction that future career prospects create implicit effort incentives because researchers cannot randomly \assign" career prospects to economic agents. To overcome this challenge, we use data from professional soccer, where employees of the same club face different external career opportunities de- pending on their nationality. We test whether the career prospect of being selected to a Euro Cup national team affects players' pre-Cup performances, using nationals of countries that did not participate in the Euro Cup as a control group. We find that the Euro Cup career prospect has positive effects on the performances of play- ers with intermediate chances of being selected to their national team, but negative effects on the performances of players whose selection is very probable. -

BMO Management Strategies of Football Clubs in the Dutch Eredivisie
BSc-Thesis – BMO Management strategies of football clubs in the Dutch Eredivisie Name Student: Mylan Pouwels Registration Number: 991110669120 University: Wageningen University & Research (WUR) Study: BBC (Business) Thesis Mentor: Jos Bijman Date: 1-23-2020 Chair Group: BMO Course Code: YSS-81812 Foreword From an early age I already like football. I like it to play football by myself, to watch it on television, but also to read articles about football. The opportunity to combine my love for football with a scientific research for my Bachelor Thesis, could not be better for me. During an orientating conversation about the topic for my Bachelor Thesis with my thesis mentor Jos Bijman, I mentioned that I was always interested in the management strategies of organizations. What kind of choices an organization makes, what kind of resources an organization uses, what an organization wants to achieve and its performances. Following closely this process in large organizations is something I like to do in my leisure time. My thesis mentor Jos Bijman asked for my hobbies and he mentioned that there was a possibility to combine my interests in the management strategies of organizations with my main hobby football. In this way the topic Management strategies of football clubs in the Dutch Eredivisie was created. The Bachelor Thesis Management strategies of football clubs in the Dutch Eredivisie is executed in a qualitative research, using a literature study. This Thesis is written in the context of my graduation of the study Business-and Consumer Studies (specialization Business) at the Wageningen University and Research. From October 28 2019 until January 23 I have been working on the research and writing of my Thesis. -

Magisterarbeit
MAGISTERARBEIT Titel der Magisterarbeit Vom Fußballer zur Marke Die mediale Imagekonstruktion von Bastian Schweinsteiger Verfasserin: Verena Runtsch, Bakk. phil. Angestrebter akademischer Grad: Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 841 Studienrichtung lt. Studienblatt: Magisterstudium Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Betreuer: OR tit. Univ.- Prof. Dr. Wolfgang Duchkowitsch INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung und Erkenntnisinteresse.............................................................. 6 1.1 Forschungsstand................................................................................... 8 I THEORETISCHER HINTERGRUND 2. Image........................................................................................................... 11 2.1 Begriffsdefinition und Funktionen.......................................................... 11 2.2 Image als Konstrukt............................................................................... 12 2.3 Inszenierung.......................................................................................... 15 2.4 Methoden der Inszenierung................................................................... 16 3. Helden, Stars und Vorbilder......................................................................... 18 3.1 Faszination Held.................................................................................... 18 3.2 Stars und Sternchen.............................................................................. 19 3.3 Vorbilder............................................................................................... -

Genie Im Konflikt Diego
RUND > DAS FUSSBALLMAGAZIN_Nr. 20, MÄRZ 2007 2,80€ Nr. 20, MÄRZ 2007 20, Nr. RUND FUSSBALLMAGAZIN DAS WWW.RUND-MAGAZIN.DE DAS FUSSBALLMAGAZIN RUND Schalke 04 Darüber streiten die Altintop-Zwillinge Dopingtest Wenn Profi s nicht pinkeln können Hansa Rostock Reportage: Ein Klub überrascht sich selbst Diego: Genie im Konfl ikt Wie der Vater die Karriere des Bremer Stars gefährdet Schweiz_5,50sfr_Österreich_3,20€_Luxemburg_3,20€_Spanien_3,80€_Griechenland_4,00€_Italien_3,80€ rrund0307_001_Titel.inddund0307_001_Titel.indd 1 008.02.20078.02.2007 221:13:161:13:16 UUhrhr RUND Einlaufen LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, der Bremer Diego war der überragende Spieler der Hinrunde in der Schleswig-Holsteins: in Wakendorf II, 1400 Einwohner, rund 40 Ki- Fußballbundesliga. Zu rechnen war damit nicht, schließlich kam der lometer nördlich von Hamburg. RUND hat genau dies erkannt und ist Brasilianer bei seinem letzten Klub, dem FC Porto, nur unregelmäßig ab sofort Hauptsponsor der G-Jugend-Mannschaft des TuS Wakendorf- zum Einsatz und saß dort monatelang auf der Tribüne. Angeblich pass- Götzberg. Mit Hilfe eines ausgeklügelten und fl ächendeckenden Sich- te er nicht in das taktische Konzept von Trainer Co Adriaanse. In Bre- tungssystems wurden die besten Vier- bis Siebenjährigen des Dorfes men musste der 22-Jährige die Nachfo lge von Werder-Dirigent Johan gescoutet. Doch überzeugen Sie sich selbst: Unsere große Fotostrecke Micoud antreten, was ihm viele Skeptiker nicht zugetraut hatten. Aber ab Seite acht zeigt, wie sich das RUND-Perspektivteam auf die Welt- Diego hat sich im kalten Bremen gut zurechtgefunden, wenn ihn auch meisterschaft 2026 vorbereitet. heute noch der Alltag im Norden Deutschlands vor Rätsel stellt. -

Baden-Württemberg A
NOVEMBER 2018 publication NEW IN local global local Baden-Württemberg a A GUIDE FOR TALENTS AND CORPORATES Exploring the DNA of Innovation How start-ups are reinventing the region Working in BW: Welcome to the most attractive destination for "the new" Communities: Who they are, how they came 1 CONNECTING GLOBAL MINDS You have a bright idea for a book, article, web content or design? You are interested in an internship in Germany? You want to support us at our conferences and activities at international trade shows? You have to write a master thesis? Do not hesitate to contact us - we want your ideas! Our Projects & Media • Hannover Messe: Global Business & Markets since 1998 • Partner Country Russia 2005, 2013 • Partner Country India 2006 • Partner Country Turkey 2007 • Partner Country Italy 2010 • Partner Country France 2011 • Partner Country China 2012 Join us! • Partner Country Holland 2014 • Partner Country Poland 2017 In the middle • CeBIT Flat World Forum 2009 - 2011 • CeBIT International Business Area 2013-2015 of Stuttgart • Deutscher Außenwirtschaftstag 1999-2013 • GlobalConnect 2008 - 2018 • didacta 2013- 2016 • edubiz 2010- 2018 • sourcing_asia 2004 - 2011 • Business Baden-Württemberg 2007-2014 • AUMA, AFIDA 2005 - 2014 – Exhibition Markets • Metropolitan Solutions 2015 - 2016 • WirdWirt - Stuttgarter Gastronomen im Gespräch 2016 • Gastro.Startup.Berlin 2017 • New in BW since 2018 Contact us: Marketing www.localglobal.com Publishing [email protected] Facebook: facebook.com/localglobal/ Events 2 Twitter: @localglobal_de Where the new is at home Brand-new, contemporary, and original - welcome to the most attractive destination for innovation Baden-Württemberg wasn’t always the wealthy region it is today. -

Knappenschmiede Magazin 2016 / 2017 2
Knappenschmiede Magazin 2016 / 2017 2 www.knappenschmiede.de 3 instagram.com/knappenschmiede facebook.com/knappenschmiede twitter.com/knappenschmiede Snapchat: schmiedesnaps 4 VORWORT Der Sommer ist vorbei und unsere elf Teams aus der muss. Geduld ist ein entscheidender Faktor in der Knappenschmiede sind wieder am Ball. Die Saison Ausbildung und Förderung junger Spieler. 2016/2017 läuft und wie immer haben wir uns auch für diese Spielzeit viel vorgenommen. Auch die Konkurrenz gerade in unserer Region ist enorm und hat zuletzt viel Wert auf die Jugendarbeit Unser erstes, unser oberstes Ziel ist und bleibt, jun- gelegt. Woanders wird auch gut ausgebildet. Das ge Talenten auf dem Weg in den Profifußball sport- wissen wir, doch dies ist nur ein weiterer Ansporn lich und menschlich zu begleiten – im Idealfall für für uns. Ansporn, uns nicht zurückzulehnen, sondern die Arena, für uns, für den S04. Das ist uns in den alle Kräfte in unserer täglichen Arbeit mit den Jungs zurückliegenden Jahren immer wieder hervorragend zu bündeln. Nachwuchs ist Schalke wichtig, und wir gelungen. Absolventen der Knappeschmiede werden sind stolz auf das, was die Knappenschmiede, was zudem national wie international sehr geschätzt. der gesamte Club, was alle beteiligten Mitarbeiter Nachwuchsarbeit made in Schalke ist ein Gütesie- leisten: modernste Ausbildungsarbeit. gel, das für Qualität bürgt. Julian Draxler und jüngst Leroy Sane oder Max Meyer sind aktuelle Beispiele Überzeugen Sie sich selbst davon. Auf dem Platz bei dafür, ohne all die anderen vergessen zu wollen. einem Spiel unserer Junioren. In der VELTNS-Arena. Wenn sie Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwe- Unser zweites Ziel ist es natürlich, dass unsere des und Max Meyer im DFB-Trikot zuschauen. -

German Bundesliga 1 1995-96
BORUSSIA DORTMUND Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 2.65 Home Defence 0.82 Away Attack 1.82 Away Defence 1.41 Goalkeeper STEFAN KLOS (97) WOLFGANG DE BEER (99) HARALD SCHUMACHER (100) Penalty Taker STEFAN REUTER (60) ANDREAS MOLLER(80) MICHAEL ZORC (100) MICHAEL ZORC 20 RUBEN SOSA 87 HEIKO HERRLICH 30 STEFFEN FREUND 90 ANDREAS MOLLER 40 JORG HEINRICH 93 KARLHEINZ RIEDLE 50 JULIO CESAR 96 LARS RICKEN 58 RENE TRETSCHOK 99 JURGEN KOHLER 65 CARSTEN WOLTERS 100 PATRIK BERGER 71 STEPHANE CHAPUISAT 75 STEFAN REUTER 79 MATTHIAS SAMMER 83 FC BAYERN MUNCHEN Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 2.06 Home Defence 1.18 Away Attack 1.82 Away Defence 1.53 Goalkeeper OLIVER KAHN (94) MICHAEL PROBST(97) SVEN SCHEUR (100) Penalty Taker MEHMET SCHOLL (50) JURGEN KLINSMANN (100) JURGEN KLINSMANN 22 ANDREAS HERZOG 90 ALEXANDER ZICKLER 35 JEAN-PIERRE PAPIN 93 MEHMET SCHOLL 47 CIRIOCO SFORZA 96 EMIL KOSTADINOV 55 OLIVER KREUZER 98 THOMAS HELMER 62 LOTHAR MATTHAUS 100 CHRISTIAN NERLINGER 69 THOMAS STRUNZ 76 CHRISTIAN ZIEGE 81 MARKUS BABBEL 84 DIETMAR HAMANN 87 FC SCHALKE 04 Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 1.65 Home Defence 0.94 Away Attack 1.00 Away Defence 1.18 Goalkeeper JENS LEHMANN (94) JORG ALBRECHT (100) Penalty Taker INGO ANDERBRUGGE MARTIN MAX 28 ANDREAS MULLER 98 YOURI MULDER 53 UWE WEIDEMANN 100 INGO ANDERBRUGGE 66 THOMAS LINKE 73 OLAF THON 80 MICHAEL BUSKENS 85 DAVID WAGNER 90 TOM DOOLEY 92 WALDEMAR KSIENZYK 94 RADOSLAV LATAL 96 BORUSSIA MONCHENGLADBACH Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 1.71 Home Defence 1.29 Away Attack 1.35 Away Defence 1.71 Goalkeeper