Swr2-Musikstunde-20121024.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
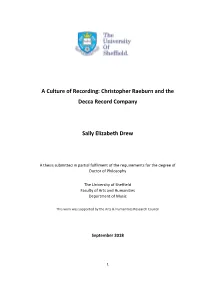
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company Sally Elizabeth Drew A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Sheffield Faculty of Arts and Humanities Department of Music This work was supported by the Arts & Humanities Research Council September 2018 1 2 Abstract This thesis examines the working culture of the Decca Record Company, and how group interaction and individual agency have made an impact on the production of music recordings. Founded in London in 1929, Decca built a global reputation as a pioneer of sound recording with access to the world’s leading musicians. With its roots in manufacturing and experimental wartime engineering, the company developed a peerless classical music catalogue that showcased technological innovation alongside artistic accomplishment. This investigation focuses specifically on the contribution of the recording producer at Decca in creating this legacy, as can be illustrated by the career of Christopher Raeburn, the company’s most prolific producer and specialist in opera and vocal repertoire. It is the first study to examine Raeburn’s archive, and is supported with unpublished memoirs, private papers and recorded interviews with colleagues, collaborators and artists. Using these sources, the thesis considers the history and functions of the staff producer within Decca’s wider operational structure in parallel with the personal aspirations of the individual in exerting control, choice and authority on the process and product of recording. Having been recruited to Decca by John Culshaw in 1957, Raeburn’s fifty-year career spanned seminal moments of the company’s artistic and commercial lifecycle: from assisting in exploiting the dramatic potential of stereo technology in Culshaw’s Ring during the 1960s to his serving as audio producer for the 1990 The Three Tenors Concert international phenomenon. -
Annals Liceu
GRAN TEATRE DEL LICEU I' Temporada d'òpera 1984/85 I f - CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU GENERALIl;�r DE CATALUNYA AJUNTAMENT DE BARCELONA SOCIETAT DEL GRAN TEATIlE DEL LICEU ,..------- (fi),�------------------� I SIEGFRIED Eso a menudo; la comida pasa Òpera en 3 actes es en cuanto a buena, pero Llibret i música de Richard Wagner postres, , , " sólo hay las tres banalidades de siempre, En Flo los postres son tantos que requieren una carta aparte: más de 20 postres hechos en casa, que son 20 suculentas tentaciones, Es que no puede haber una buena «brasserie» sin buenos postres, ¡QUE "BRASSERIE"! LA BRASSERIE FlO .. on LA LAI. Funció de Gala de a Dijous, 14 març de 1985 ' les 21 h ., funció núm. 37, torn B . 17 de 1985 a les 17 h ., Diumenge, març de ' funció núm. 38 , torn. T Dimecres, 20 de març de 1985 a les 21 h " funció núm. 39, torn A' Jonqueres, 10· BARCELONA Reservas Tel. 311 80 31 GRAN TEATRE DEL LICEU Barcelona --------(�--------� SIEGFRIED Siegfried: Reiner Goldberg Mime: Wolf Appel Wotan, el vianant: Peter W imberger Alberich: Walter Berry Fafner, el dragó: Malcolm Smith Erda: Martha Szirmay Brünnhilde: Elisabeth Payer-Tucci L'ocell: Rebeca Littig Director d'orquestra: Matthias Kuntzsch Direcció escènica: Werner M. Esser Decoracions: Teatro Comunale Giuseppe Verdi (Trieste) Violins concertinos: Jaume Franceschi a Josep M. Alpiste Comentaris a càrrec dels Drs. Roger Alier, Xosé Aviñoa i Oriol Martorell, del Departament d'Art de la Universitat de Barcelona. ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU --------------------(!!)--------------------� -

ARSC Journal
THE MARKETPLACE HOW WELL DID EDISON RECORDS SELL? During the latter part of 1919 Thomas A. Edison, Inc. began to keep cumulative sales figures for those records that were still available. The documents were continued into 1920 and then stopped. While the documents included sales figures for all series of discs time allowed me to copy only those figures for the higher priced classical series. Thus the present article includes the 82,000 ($2.00); 82,500 ($2.50); 83,000 ($3.00) and 84,000 ($4.00) series. Should there be sufficient interest it may be possible to do the other series at a later date. While the document did list some of the special Tone-Test records pressing figures were included for only two of them. I have arbitrarily excluded them and propose to discuss the Edison Tone Tests at a later date. The documents also originally included supplementary listings, which, for the sake of convenience, have been merged into the regular listings. The type copy of the major portion of the listings has been taken from regular Edison numerical catalogs and forms the framework of my forthcoming Complete Edison Disc Numerical Catalog. Several things may be noted: 1) Many of the sales figures seem surprisingly small and many of the records must be classed as rarities; 2) Deletion was not always because of poor sales-mold damage also played a part; 3) Records were retained even with extremely disappointing sales. Without a knowledge of the reason for discontinuance we cannot assume anything concerning records that had already been discontinued. -

Anonymous 17Th-Century Hungarian Dances)
U naseho barty C U naseho Barty C ÔÔ NAH-sheh-ho BAR-tee C (anonymous 17th-century Hungarian dances) Ubaldus C ü-BAHL-düss C (known also as Hucbald [HÜK-bahlt], Hugbaldus [hük-BAHL- düss], and Uchubaldus [ü-kü-BAHL-düss]) Uchubaldus C ü-kü-BAHL-düss C (known also as Ubaldus [ü-BAHL-düss], Hugbaldus [hük-BAHL-düss] and Hucbald [HÜK-bahlt]) Uber C Alexander Uber C ah-leck-SAHN-tur OO-bur Uber C Christian Benjamin Uber C KRIH-stihahn BENN-yah-minn OO-bur Uber C Christian Friedrich Hermann Uber C KRIH-stihahn FREET-rihh HEHR-mahn OO- bur Uber allen gipfeln ist ruh C Über allen Gipfeln ist Ruh C Ü-bur AHL-lunn GHIPP-fulln isst ROO C (Wanderer's Night Song) C (composition by Franz Liszt [FRAHNZ LISST]) Uber den selbstmord C Über den Selbstmord C Ü-bur dayn ZELLBST-mawrt C (On Suicide) C (song by Hanns Eisler [HAHNSS ¦SS-lur]) Uber die dauer des exils C Über die Dauer des Exils C Ü-bur dee DAHÔÔ-ur dess eck- SEELSS C (Thoughts on the Duration of Exile) C (song by Hanns Eisler [HAHNSS ¦SS-lur]) Uberlaufer C Der Überlaufer C dayr Ü-bur-lahôô-fur C The Defector C (poem from Des Knaben Wunderhorn [dess k’NAHAH-bunn VÔÔN-tur-hawrn] — The Youth’s Magic Horn — set to music by Johannes Brahms [yo-HAHN-nuss {BRAHMZ} BRAHAHMSS]) Uberlebenden C An die Überlebenden C ahn dee Ü-bur-lay-bunn-dunn C (To the Survivors) C (song by Hanns Eisler [HAHNSS ¦SS-lur] Uberti C Antonio Uberti C ahn-TAW-neeo oo-BAYR-tee Uberto C oo-BAYR-toh C (character in the opera La donna del lago [lah DOHN-nah dayl LAH-go] — The Lady of the Lake; music by Gioachino Rossini [johah-KEE-no -

Constructing the Archive: an Annotated Catalogue of the Deon Van Der Walt
(De)constructing the archive: An annotated catalogue of the Deon van der Walt Collection in the NMMU Library Frederick Jacobus Buys January 2014 Submitted in partial fulfilment for the degree of Master of Music (Performing Arts) at the Nelson Mandela Metropolitan University Supervisor: Prof Zelda Potgieter TABLE OF CONTENTS Page DECLARATION i ABSTRACT ii OPSOMMING iii KEY WORDS iv ACKNOWLEDGEMENTS v CHAPTER 1 – INTRODUCTION TO THIS STUDY 1 1. Aim of the research 1 2. Context & Rationale 2 3. Outlay of Chapters 4 CHAPTER 2 - (DE)CONSTRUCTING THE ARCHIVE: A BRIEF LITERATURE REVIEW 5 CHAPTER 3 - DEON VAN DER WALT: A LIFE CUT SHORT 9 CHAPTER 4 - THE DEON VAN DER WALT COLLECTION: AN ANNOTATED CATALOGUE 12 CHAPTER 5 - CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 18 1. The current state of the Deon van der Walt Collection 18 2. Suggestions and recommendations for the future of the Deon van der Walt Collection 21 SOURCES 24 APPENDIX A PERFORMANCE AND RECORDING LIST 29 APPEDIX B ANNOTED CATALOGUE OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION 41 APPENDIX C NELSON MANDELA METROPOLITAN UNIVERSTITY LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (NMMU LIS) - CIRCULATION OF THE DEON VAN DER WALT (DVW) COLLECTION (DONATION) 280 APPENDIX D PAPER DELIVERED BY ZELDA POTGIETER AT THE OFFICIAL OPENING OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION, SOUTH CAMPUS LIBRARY, NMMU, ON 20 SEPTEMBER 2007 282 i DECLARATION I, Frederick Jacobus Buys (student no. 211267325), hereby declare that this treatise, in partial fulfilment for the degree M.Mus (Performing Arts), is my own work and that it has not previously been submitted for assessment or completion of any postgraduate qualification to another University or for another qualification. -

Chronology 1916-1937 (Vienna Years)
Chronology 1916-1937 (Vienna Years) 8 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe; first regular (not guest) performance with Vienna Opera Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Miller, Max; Gallos, Kilian; Reichmann (or Hugo Reichenberger??), cond., Vienna Opera 18 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Gallos, Kilian; Betetto, Hermit; Marian, Samiel; Reichwein, cond., Vienna Opera 25 Aug 1916 Die Meistersinger; LL, Eva Weidemann, Sachs; Moest, Pogner; Handtner, Beckmesser; Duhan, Kothner; Miller, Walther; Maikl, David; Kittel, Magdalena; Schalk, cond., Vienna Opera 28 Aug 1916 Der Evangelimann; LL, Martha Stehmann, Friedrich; Paalen, Magdalena; Hofbauer, Johannes; Erik Schmedes, Mathias; Reichenberger, cond., Vienna Opera 30 Aug 1916?? Tannhäuser: LL Elisabeth Schmedes, Tannhäuser; Hans Duhan, Wolfram; ??? cond. Vienna Opera 11 Sep 1916 Tales of Hoffmann; LL, Antonia/Giulietta Hessl, Olympia; Kittel, Niklaus; Hochheim, Hoffmann; Breuer, Cochenille et al; Fischer, Coppelius et al; Reichenberger, cond., Vienna Opera 16 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla Gutheil-Schoder, Carmen; Miller, Don José; Duhan, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 23 Sep 1916 Die Jüdin; LL, Recha Lindner, Sigismund; Maikl, Leopold; Elizza, Eudora; Zec, Cardinal Brogni; Miller, Eleazar; Reichenberger, cond., Vienna Opera 26 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla ???, Carmen; Piccaver, Don José; Fischer, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 4 Oct 1916 Strauss: Ariadne auf Naxos; Premiere -

110308-10 Bk Lohengrineu 13/01/2005 03:29Pm Page 12
110308-10 bk LohengrinEU 13/01/2005 03:29pm Page 12 her in his arms, reproaching her for bringing their @ Ortrud comes forward, declaring the swan to be happiness to an end. She begs him to stay, to witness her Elsa’s brother, the heir to Brabant, whom she had repentance, but he is adamant. The men urge him to bewitched with the help of her own pagan gods. WAGNER stay, to lead them into battle, but in vain. He promises, Lohengrin kneels in prayer, and when the white dove of however, that Germany will be victorious, never to be the Holy Grail appears, he unties the swan. As it sinks defeated by the hordes from the East. Shouts announce down, Gottfried emerges. Ortrud sinks down, with a the appearance of the swan. cry, while Gottfried bows to the king and greets Elsa. Lohengrin Lohengrin leaps quickly into the boat, which is drawn ! Lohengrin greets the swan. Sorrowfully he turns away by the white dove. Elsa sees him, as he makes his towards it, telling Elsa that her brother is still alive, and sad departure. She faints into her brother’s arms, as the G WIN would have returned to her a year later. He leaves his knight disappears, sailing away into the distance. AN DG horn, sword, and ring for Gottfried, kisses Elsa, and G A F SS moves towards the boat. L E Keith Anderson O N W Mark Obert-Thorn Mark Obert-Thorn is one of the world’s most respected transfer artist/engineers. He has worked for a number of specialist labels, including Pearl, Biddulph, Romophone and Music & Arts. -

De Muzikale Geschiedenis Van De Bayreuther Festspiele Afl. 20 Door Johan Maarsingh
De muzikale geschiedenis van de Bayreuther Festspiele afl. 20 door Johan Maarsingh In deze aflevering van de muzikale geschiedenis van de Bayreuther Festspiele staan de jaren ‘60 centraal. De aandacht gaat uit naar opnamen die niet of nauwelijks bekend zijn, omdat ze niet (gemakkelijk) op cd te koop waren en nu op het internet zijn te beluisteren. Ze bieden alternatieve bezettingen ten opzichte van officieel uitgebrachte opnamen. Dat de geluidskwaliteit vaak niet van het hoogste niveau is, mag als bijzaak gelden. Lohengrin 1962 Tijdens de voorbereidingen van de Festspiele in 1962 werd deze opname gemaakt van de tweede akte Lohengrin. Hierin is Irene Dalis te horen als Ortrud en Ramón Vinay als Telramund. Wolfgang Sawallisch dirigent. Overigens is dit een afwijkende bezetting ten opzichte van de opname op de plaat: Ortrud wordt daar vertolkt door Astrid Varnay. Het is een fragment uit een uitzending van de BBC Radio. Het inleidend commentaar klinkt uit de mond van Deryck Cooke. https://youtu.be/trertAJqp_E Bayreuther Festspiele op televisie. In 1963 heeft de Duitse televisie vanuit Bayreuth de eerste scène uit het derde bedrijf van Die Meistersinger von Nürnberg uitgezonden. Het is van een latere voorstelling in dat jaar, want hierin zien we Josef Greindl als Sachs en Wolfgang Windgassen als Stolzing. De band is niet meer van goede kwaliteit. Via deze link is zo toch een indruk te verkrijgen van Wielands tweede enscenering van deze opera. Helaas moeten we het stellen zonder Festwiese. Deze werd niet opgenomen. Misschien was dat te moeilijk geweest met de toenmalige opname techniek. Tegenwoordig gaat dat anders en komt de eerste voorstelling van een nieuwe productie in de bioscoop. -

Bruno Walter (Ca
[To view this image, refer to the print version of this title.] Erik Ryding and Rebecca Pechefsky Yale University Press New Haven and London Frontispiece: Bruno Walter (ca. ). Courtesy of Österreichisches Theatermuseum. Copyright © by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections and of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Designed by Sonia L. Shannon Set in Bulmer type by The Composing Room of Michigan, Grand Rapids, Mich. Printed in the United States of America by R. R. Donnelley,Harrisonburg, Va. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Ryding, Erik S., – Bruno Walter : a world elsewhere / by Erik Ryding and Rebecca Pechefsky. p. cm. Includes bibliographical references, filmography,and indexes. ISBN --- (cloth : alk. paper) . Walter, Bruno, ‒. Conductors (Music)— Biography. I. Pechefsky,Rebecca. II. Title. ML.W R .Ј—dc [B] - A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. For Emily, Mary, and William In memoriam Rachel Kemper and Howard Pechefsky Contents Illustrations follow pages and Preface xi Acknowledgments xv Bruno Schlesinger Berlin, Cologne, Hamburg,– Kapellmeister Walter Breslau, Pressburg, Riga, Berlin,‒ -

Richard Wagner Tristan Und Isolde Wolfgang Sawallisch
Richard Wagner Tristan und Isolde LIVE Windgassen · Nilsson Hoffmann · Saedén · Greindl Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele Wolfgang Sawallisch ORFEO D’OR Live Recording 26. Juli 1958 „Bayreuther Festspiele Live“. Das Inte- resse der Öffentlichkeit daran ist groß, die Edition erhielt bereits zahlreiche in- ternationale Preise. Die Absicht aller Be- teiligten ist nichts weniger als Nostalgie oder eine Verklärung der Vergangen- Das „neue Bayreuth“, wie es seit 1951 heit, vielmehr die spannende Wieder- von Wieland und Wolfgang Wagner be- entdeckung großartiger Momente der gründet und erfolgreich etabliert wur- Festspiele. Die sorgfältig erarbeitete de, suchte von Anfang an gezielt die Herausgabe der Mitschnitte soll erin- Vermittlung durch die damals existie- nern und vergegenwärtigen helfen, renden Medien, vor allem den Hörfunk indem musikalische Highlights aus der und die Schallplatte. Die Live-Übertra- Aufführungsgeschichte der Bayreuther gungen im Bayerischen Rundfunk und Festspiele wieder zugänglich gemacht angeschlossenen Sendern in Deutsch- und nacherlebbar werden. land, Europa und Übersee entwickelten sich binnen kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der alljährlichen Festspiele – und sind es bis heute geblieben. Nicht Katharina Wagner, zuletzt wird dadurch vielen Wagneren- Festspielleitung thusiasten weltweit eine zumindest akustische Teilnahme am Festspielge- schehen ermöglicht. Zugleich wurden Since its inception in 1951, ‚New Bay- und werden damit die künstlerischen reuth‘, founded and successfully run Leistungen der -

Decca Discography
DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982. -

Inhalt Bandl Vorwort XXVII Einleitung I Vorspiel Auf Dem Theater — Eine Stimme Zur Rechten Zeit ...I Vollendung Und Ende
Inhalt Bandl Vorwort XXVII Einleitung i Vorspiel auf dem Theater — Eine Stimme zur rechten Zeit .... i Vollendung und Ende des Belcanto: Enrico Caruso 3 Vom Erbe — über das Erben 9 I. Kapitel Dialog mit der Ewigkeit 19 In der Welt der Erinnerung zählt die Zeit nicht 19 Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 26 Sänger und Schallplatte 28 Von Treue und Untreue 34 II. Kapitel Belcanto 39 Goldenes Zeitalter 39 Heiliger Geist - Hermaphrodit - Modern Heroe - Die übernatürlich schöne Stimme 46 Paradigma: Farinelli 48 Das Ende der Gesangskunst? 55 III. Kapitel Der ferne Klang oder: Die alte Schule 59 Nachtigall: Adelina Patti 59 • Auf Flügeln des Gesanges: Marcella Sembrich 67 Exkurs: Die Schule der Mathilde Marchesi 73 Assoluta: Lilli Lehmann 76 • Yankee-Diva: Lillian Nordica 83 • Der letzte Rokoko-Tenor: Fernando de Lucia 88 • La voix unique du monde: Fran cesco Tamagno 99 • Exkurs: Die Zerstörung des Helden: Francesco Tamagno und die Otello-Tradition 104 • Magisches Wispern: Victor Maurel 112 • La Gloria d'Italia: Mattia Batristini 115 • Der vollkommene Sänger: Pol Plancon 122 IV. Kapitel Richard Wagner: Die menschliche Stimme ist die Grundlage aller Musik 127 Der Darsteller ist der wahre Künstler 127 Die Oper oder: Das Narrenhaus für allen Wahnsinn der Welt . 129 Kesting, Jürgen digitalisiert durch: Die grossen Sänger IDS Luzern 2010 Der dramatische Gesang 132 Paradigma I - Die Utopie von der vollkommenen Tenorstimme oder: Joseph Tichatschek 137 Paradigma II - Das Gesangsgenie ohne Stimme oder: Wilhelmine Schröder-Devrient 139 Wenn sich die Theorie der Wirklichkeit nicht fügt 144 Gesang als Handlung 147 Die Frage des Belcanto 149 Gesang und Sprache: Wagner, der Lautkomponist 159 Entwicklungen des Wagner-Gesangs 163 V.