Das Gründungscharisma Lebendig Halten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
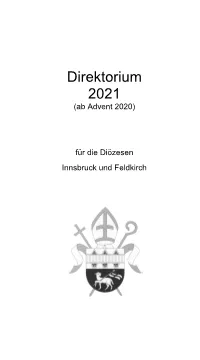
Direktorium 2021 (Ab Advent 2020)
Direktorium 2021 (ab Advent 2020) für die Diözesen Innsbruck und Feldkirch 3 Direktorium Ordnung für die Liturgie nach römischem Ritus zum Gebrauch für die Diözesen Innsbruck und Feldkirch für das Jahr 2021 (ab Advent 2020) Im Auftrag des Diözesanbischofs Hermann Glettler von Innsbruck und des Diözesanbischofs Benno Elbs von Feldkirch Für den Inhalt des liturgischen Kalendariums: Jakob Patsch, Christian Nuener Für den Inhalt der Kurz-Schematismen: Generalvikariate der Diözesen Innsbruck und Feldkirch Herausgegeben und verlegt vom Bischöflichen Ordinariat der Diözese Innsbruck, Riedgasse 11, 6020 Innsbruck 4 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS Abkürzungsverzeichnis 5 Kirchenjahr 2020/2021 7 Allgemeine Hinweise 8 1. Besondere Feiern 8 1.1. Kirchweihfest, Patrozinium oder Titelfest und andere Eigenfeste 8 1.2. Herz-Jesu-Freitag, Herz-Mariä-Samstag und monatlicher Gebetstag um geistliche Berufe 8 1.3. Trauungsmessen 9 1.4. Begräbnismessen 9 2. Bemerkungen zu einzelnen Teilen des Wortgottesdienstes 9 2.1. Zur Auswahl der Lesungen 9 2.2. Antwortpsalm mit Kehrvers (Responsorium) 10 2.3. Credo 10 3. Präfationen 10 4. Gesänge 10 5. Liturgische Kleidung 11 6. Applikationsverpflichtung 11 7. Binations- und Trinationsmessen 11 8. Bitt- und Quatembertage 11 9. Zur Beichtjurisdiktion 12 10. Zum Gedächnis der verstorbenen Mitbrüder 12 11. Liturgische Dienste von Laien: Ausbildungen 13 Kirchensammlungen 14 Kalendarium 2020/2021 20 Vorschau und bewegliche Feste 2021/2022 240 Kurz-Schematismus der Diözese Innsbruck 241 Kurz-Schematismus der Diözese Feldkirch 299 Abkürzungsverzeichnis 5 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS Liturgische Ränge: Liturgische Farben: H Hochfest GR (gr) grün F Fest R (r) rot G gebotener Gedenktag SCHW schwarz g nichtgebotener Gedenktag V (v) violett W (w) weiß Sonstige Abkürzungen: I–VIII Bd I–VIII des Meßlek- folg vom folgenden Tag tionars 1982–1986 Gb Glaubensbote ad lib ad libitum (nach Geb Gebet(e) freiem Ermessen) Gg Gabengebet AEM Allgemeine Einfüh- GK Gründer von Kirchen rung in das röm. -
Kulturführer Soll Dazu Einladen, Die Kultur Der Ferienregion Achensee Kennen Zu Lernen
Schutzgebühr Euro 1,-- Lvmuvs! bvg!Tdisjuu! voe!Usjuu Lvmuvsg isfs!Bdifotff Lvmuvsjogpsnbujpofo wpo!B!cjt![ xxx/bdifotff/jogp 2-3 Lebensart nennt man, was Kultur ist: In Tirol gehören Bergwandern und gutes Essen ebenso dazu wie der Besuch einer Ausstellung und eines Konzerts. Das Urlaubsland Tirol verbindet Natur, Kultur und Sport in idealer Weise. Dieser Kulturführer soll dazu einladen, die Kultur der Ferienregion Achensee kennen zu lernen. Fünf Orte – Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und Wiesing – werden mit ihren Kirchen, Kapellen, Museen, historischen Gebäuden und Denkmälern vorgestellt. Wir sind Ihnen für Vorschläge, die diesen Kulturführer noch attraktiver machen, jederzeit dankbar, und wir würden uns über Ihre Anregungen freuen. Tourismusverband Achensee Rathaus 387 A-6215 Achensee Tel. +43/(0)5246/5300 Fax +43/(0)5246/5333 www.achensee.info [email protected] Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Achensee Tourismus Herstellung: Agentur TAURUS, Kufstein Der Herausgeber haftet nicht für die Verbindlichkeit der angegebenen Preise. Änderung der Öffnungszeiten und Preisänderung vorbehalten. (Stand September 2008) 4-5 Häuserer Bichl Kapelle .......................................................... 34 Eggerer Kapelle ................................................................... 36 Buchauer Kapelle................................................................. 37 Hauskapelle Prälatenhaus ..................................................... 37 Hechenberg Bildstock.......................................................... -

(2007), Heft Nr. 4
ZEICHEN DER ZEIT ERHÖHTE SPEICHERKAPAZITÄT Für die Entdeckung des GMR-Effekts werden 2007 der französische Wissen- schaftler Albert Fert und der deutsche Physiker Peter Grünberg mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. In der Auflösung der Abkürzung verbirgt sich dahinter der Ausdruck „Giant Magnetoresistance“. Es handelt sich dabei um eine Technik zur Auslesung von gespeicherten Daten auf Computer-Festplatten. Unabhängig von- einander hatten die beiden herausgefunden, dass sehr schwache magnetische Veränderungen den elektrischen Widerstand sehr stark verändern können. Ein neu entwickelter hoch empfindlicher Lesekopf machte diese Entdeckung für die Compu- tertechnologie verwertbar. Denn je dichter eine Festplatte mit Informationen voll gepackt wird, desto schwächer sind die einzelnen magnetischen Felder, desto empfindlicher muss aber auch der Lesekopf sein. Festplatten in der heute üblichen Größe und Speicherkapazität wurden mit dieser Entdeckung erst möglich. Wer erinnert sich noch an die alten 5,25 Zoll-Disketten, auf denen kaum Daten Platz hatten? Kein Megabyte konnte man unterbringen. In den neuen Computern sind Festplatten von über 100 Gigabyte keine Seltenheit mehr. Wie sich die Zeiten ändern! Und das alles dank einer sehr praktischen und gut umgesetzten Erfindung aus dem Bereich der Nanotechnologie. Vom diesjährigen Physik-Nobelpreis profi- tieren nicht nur die beiden Preisträger und die Fachwissenschaft, sondern alle Computernutzer. Schon lange wird davon gesprochen, dass wir uns in einer Informations- und Wissensgesellschaft befinden. Der eigentliche Reichtum unserer Zeit besteht in der weltweit jederzeit verfügbaren Menge an Information und Wissen. Dabei ist die Menge an Daten, die täglich umgesetzt werden, schon längst nicht mehr zu über- schauen. Das gilt für den privaten Datenverbrauch ebenso wie für das im Internet gespeicherte globale Wissen der Menschheit. -

Justice and Peace Scotland Catholic Social Thought Quotations (2020)
Justice and Peace Scotland Catholic Social Thought Quotations (2020) The church has a long tradition of teaching which speaks to issues of human rights, development, peacebuilding and social justice. This is called Catholic Social Thought, and is comprised of Scripture, teachings of the Saints, Papal encyclicals, and documents from Bishops Conferences around the world, collated together in documents known as ‘Catholic Social Doctrine’, or Catholic Social Teaching. It is a constantly evolving body of work, as the Church reads the ‘signs of the times’ and responds to situations of injustice. We have also included teachings from contemporary Catholic figures, recognised for their faith and work for social justice, peacebuilding, and integral human development as part of the Church’s mission to witness to Christ in the world. The quotes below have been collated with the intention of being included in parish newsletters / bulletins to reflect either the Mass readings for that week, or a significant date in the social justice calendar. They can also be used in schools, or for personal/ group prayer or reflection. These teachings are shared (week by week) as jpeg images on the Justice and Peace Scotland Facebook, Twitter and Instagram accounts, and all members are encouraged to share them through parish, diocesan, and personal accounts. Anyone with an interest in obtaining these pictures independently (e.g – for inclusion on a parish website in advance) should contact [email protected] CST quotes for Sundays in 2021 will be available December 2020. For more information please contact the Justice and Peace Scotland office. Or alternatively sign up to the Justice &Peace Scotland newsletter. -

Diapositiva 1
Catastro de la Oferta Programática de la red SENAME Departamento de Planificación y Control de Gestión Santiago, Abril 2018 PRESENTACIÓN La Oferta Programática del Servicio Nacional de Menores (SENAME) puede definirse como el conjunto de proyectos ejecutados por los distintos Organismos Colaboradores Acreditados de SENAME, que han sido reconocidos como tales a través de un acto administrativo del mismo Servicio y que cuentan con financiamiento para el desarrollo de sus labores dirigidas a la atención de niños, niñas y adolescentes, además de los centros que son administrados directamente, los que cuentan con funcionarios del Servicio y con presupuesto asignado a través de la Ley de Presupuesto. 1 El propósito central de la realización del documento “Catastro de la Oferta Programática de SENAME” es entregar información de los proyectos de que se dispone en cada región del país, para facilitar a cualquier usuario el acceso a esta información y el conocimiento de los recursos y servicios de esta Red de Protección Social a la Infancia y Adolescencia. Asimismo, su elaboración da respuesta a la necesidad de colaboración con los distintos actores relacionados con el SENAME. Es así que se prevé será de gran utilidad para los Tribunales de Justicia en el conocimiento y eventual derivación de niños, niñas y adolescentes a la red regional; los Gobiernos Regionales y Municipios en la perspectiva de la focalización de la atención que otorga la red de SENAME, como también internamente, para las Direcciones Regionales de SENAME en el desarrollo y la supervisión de la oferta programática de la región, las Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias para la entrega de información de los proyectos, Departamentos, Unidades, centros y proyectos de la red, etc. -

Managing Dependencies in Complex Global Software Development Projects
Die approbierte Originalversion dieser Dissertation ist an der Hauptbibliothek der Technischen Universität Wien aufgestellt (http://www.ub.tuwien.ac.at). The approved original version of this thesis is available at the main library of the Vienna University of Technology (http://www.ub.tuwien.ac.at/englweb/). DISSERTATION Managing Dependencies in Complex Global Software Development Projects Ausgeführt zum Zwecke der Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der technischen Wissenschaften/der Naturwissenschaften unter der Leitung von Prof. Stefan Biffl 188 (Institutsnummer) Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme Eingereicht and der Technischen Universität Wien Fakultät für Informatik von Dipl.Ing. Matthias Heindl 9826997 1230 Wien, Maurer Langegasse 39-41/1/6 [email protected] Wien, am eigenhändige Unterschrift Managing Dependencies in Complex Global Software Development Projects DEUTSCHE KURZFASSUNG Global verteilte Softwareentwicklungsprojekte (GSD Projekte) sind komplex aufgrund zahlreicher Faktoren, wie z.B. einer üblicherweise hohen Anzahl von Anforderungen, der Verteiltheit der Projektteilnehmer, und der Unmenge an Abhängigkeiten in Arbeitsergebnissen (Anforderungsbeschreibungen, Testfallspezifikationen, Source Code). Eine wesentliche Herausforderung in solchen Projekten besteht darin, all diese Arbeitsergebnisse konsistent zu halten. Dies ist wichtig, um sicher zu stellen, dass die Dokumentation durchgängig und aussagekräftig bleibt und um Fehler in der Software aufgrund von fehlerhafter Dokumentation -

Orgelstadt Innsbruck City of Organs
Orgelstadt Innsbruck City of organs . Città degli organi Programm . Program . Programma 2013 Vorwort Innsbrucks Orgelschatz erklingt wieder Innsbruck’s organ treasures to resound anew Il tesoro organistico di Innsbruck risuona ancora „Die Königin der Instrumente“: So wird die Orgel “The Queen of Instruments” is what the organ is “Il re tra gli strumenti”: una definizione vera- genannt und das trifft wahrlich zu. Nicht nur fondly called and the soubriquet suits it to per- mente calzante dell’organo. Non soltanto la ihre Größe, sondern auch ihr imposanter, aber fection. Not only its imposing size, but its spine- sua grandezza è impressionante, ma anche zugleich sanfter und eleganter Klang ist immer tingling and at the same time gentle, elegant il suo suono maestoso e al contempo dolce wieder eindrucksvoll. Es ist bewundernswert, tones make a lasting impact, engrave an abid- ed elegante. È ammirevole come gli organisti wie souverän und brillant die Organistinnen ing memory of every concert. It is truly breath- riescano a padroneggiare con maestria questo und Organisten diese mächtigen, einzigartigen taking to witness the brilliance with which potente e straordinario strumento musicale. Instrumente beherrschen. organists master this magnificent instrument. I “re” di Innsbruck, come l’organo Ebert del Innsbrucks „Königinnen“ wie die Ebert-Orgel Innsbruck’s very own „Queens“, such as the Ebert 1558 nella Hofkirche, l’organo rinascimentale aus dem Jahr 1558 in der Hofkirche, die Re- Organ in the Imperial Church built in 1558, the nella Cappella d’argento, l’organo Pirchner nel naissance-Orgel in der Silbernen Kapelle, die Renaissance Organ in the Silver Chapel, the Duomo di San Giacomo e altri ancora sparsi Pirchner-Orgel im Dom zu St. -

Orgelstadt Innsbruck 2021
OrgelstadtInnsbruck, Innsbruck city of organs Programm 2021 Program 2021 Alle Orgeldispositionen finden Sie auf: www.innsbruck.gv.at Bildung | Kultur Kulturprojekte Orgelstadt Innsbruck Orgeldispositionen Konzerte | Concerts Konzerte Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ebenfalls zu den Orgeldispositionen. Dom St. Jakob 19.06. | 11.00 Uhr 26.06. | 11.00 Uhr 28.06. | 12.15 Uhr 29.06. | 12.15 Uhr 30.06. | 12.15 Uhr 01.07. | 12.15 Uhr 02.07. | 12.15 Uhr 03.07. | 12.15 Uhr 10.07. | 11.00 Uhr 17.07. | 11.00 Uhr 24.07. | 11.00 Uhr 31.07. | 11.00 Uhr 5 14.08. | 19.00 Uhr 09.09. | 18.00 Uhr 26.09. | 18.00 Uhr 06.12. | 16.00 Uhr (Vorplatz) 07.12. | 16.00 Uhr (Vorplatz) 08.12. | 16.00 Uhr (Vorplatz) Hofkirche 9 15.07. | 17.30 Uhr 29.07. | 17.30 Uhr 12.08. | 17.30 Uhr 26.08. | 17.30 Uhr 02.09. | 17.30 Uhr 16.09. | 17.30 Uhr 30.09. | 17.30 Uhr Stiftskirche Wilten 17 06.05. | 20.00 Uhr 13.05. | 20.00 Uhr 20.05. | 20.00 Uhr Basilika Wilten 09.08. | 20.30 Uhr 16.08. | 20.30 Uhr 23.08. | 20.30 Uhr 30.08. | 20.30 Uhr 23 06.09. | 20.30 Uhr 13.09. | 20.30 Uhr Pfarrkirche Mariahilf 27 09.05. | 20.00 Uhr Georgskapelle – Altes Landhaus 29.04. | 17.00 Uhr 27.05. | 17.00 Uhr 24.06. | 17.00 Uhr 30.09. | 17.00 Uhr 29 28.10. | 17.00 Uhr 26.11. -

Fotoaktion „Glücksorte Für Glücksmomente“ Spielen Sie Glücksfee Oder Glücksbote Und Entscheiden Mit
Jahrgang 61 Freitag, den 3. Juli 2020 Nummer 27 Fotoaktion „Glücksorte für Glücksmomente“ Spielen Sie Glücksfee oder Glücksbote und entscheiden mit Mehr zur Fotoaktion des Mehrgenerationentreffs – für viele wohl auch ein „Ort für Glücksgefühle“ - erfahren Sie auf Seite 11 Infotafel www.memmelsdorf.de Infotafel www.memmelsdorf.de Feuerwehr Polizei Kommunaler Notdienst & Notarzt Tel.: 110 Tel.: 0173 3 96 52 12 Ärztliche Notdienste Tel.: 112 für Schäden an Straßen, Wasser- und Kanalleitungen sowie Umweltschäden, Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern Giftnotruf die an Feiertagen sofort behoben Tel.: 01805 19 12 12 Tel.: 089 1 92 40 werden müssen Am Wochenende und an Feiertagen (Fr. ab 13:00 Uhr bis Mo. 08:00 Uhr) Mittwochnachmittags und -nachts (Mi. ab 13:00 Uhr bis Do. 08:00 Uhr) Gemeinde Memmelsdorf Eintrittskarten sind nur im Bürgerbüro der Gemeinde Memmelsdorf erhält- Der ärztliche Bereitschaftsdienst lich. der Kassenärztlichen Vereinigung Mo. und Di. 08:00 – 12:00 Uhr Tel.: 116 117 und 13:30 – 15:00 Uhr Gemeinde- und Pfarrbücherei Mi. 08:00 – 12:00 Uhr Memmelsdorf Ärztlicher Notfalldienst und 15:00 – 18:00 Uhr Tel.: 0951 2 99 46 89 Tel. 09542 7 74 38 55 Do. 08:00 – 12:00 Uhr Di. 09.30 – 11:30 Uhr Bereitschaftspraxis Scheßlitz Fr. 07:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr Oberend 29, 96110 Scheßlitz Do. Geänderte Öffnungszeiten16:00 – 19:00 Uhr Tel.: 0951 40 96 -0 So. 10:00 – 12:00 Uhr Mi. und Fr. 16:00 – 20:00 Uhr Fax: 0951 40 96 96 Online-Katalog unter Sa. und So. 09:00 – 21:00 Uhr E-Mail: [email protected] www.buecherei-memmelsdorf.de Vorfeiertag 18:00 – 20:00 Uhr Homepage: www.memmelsdorf.de Feiertag 09:00 – 21:00 Uhr Gemeinde- und Pfarrbücherei Rathaus: Lichteneiche Kinderärztlicher Notfalldienst Rathausplatz 1, 96117 Memmelsdorf im EG der Schule für Jung und Alt Welche/r Kinderarzt/-ärztin Notdienst Tel.: 0951 40 73 95 80 hat, erfahren Sie über den Anrufbeant- Gemeinde Memmelsdorf Mi. -

Cronología Del Padre José Kentenich AÑO DIA Y MES 1885 18 Noviembre Nacimiento Del P. José Kentenich En Gymnich, Colonia, Al
Cronología del Padre José Kentenich AÑO DIA Y MES Nacimiento del P. José Kentenich en Gymnich, Colonia, 1885 18 noviembre Alemania. 19 noviembre Bautizo en la parroquia de san Kunibert, en Gymnich. Después de 1891 Entrada en la escuela Primaria Pública. Pascua 1892 Primer semestre Estadía en Estrasburgo. Ingreso en Oberhausen al orfanato y en la escuela de San 1894 12 de abril Vicente. Domingo in 1897 Primera Comunión. Albis 24 septiembre Confirmación. 1899 15 de agosto Diploma de estudios en la Escuela Primaria. Comienzo de los estudios humanísticos en Ehrenbreitstein, 23 septiembre Coblenza. 1904 27 de julio Diploma de madurez, fin de estudios humanísticos. 27 agosto Solicitud de admisión en el noviciado de los padres palotinos. Comienzo del noviciado en la Casa Madre de los padres 24 septiembre palotinos en Limburgo junto al rio Lahn. 1905 Otoño Comienzo de estudios de filosofía. Fin del noviciado, primera profesión temporal a la comunidad 1906 24 septiembre de los padres palotinos. Comienzo de los estudios de teología. 11 octubre Recibe la tonsura (primera de las órdenes menores). 1906- 07 Larga enfermedad. Vacaciones en Schoenstatt. 1907 24 septiembre Segunda profesión. 11 octubre Ordenes menores. 1908 24 septiembre Tercera profesión 1909 29 julio Denegación transitoria de la admisión a la profesión perpetua. 24 agosto Admisión a la profesión perpetua. 24 septiembre Profesión perpetua. 10 octubre Subdiaconado. 1910 28 marzo Diaconado. 8 julio Ordenación sacerdotal. 10 julio Primera Misa. 1911 18 septiembre Profesor en el colegio de Ehrenbreitstein, Coblenza. 1912 8 septiembre Traslado a Schoenstatt Octubre Nombramiento de director espiritual de la casa de estudios de Schoenstatt. -

Franz Jagerstatter, Austria, Farmer August 9. Franz Jagerstatter
Franz Jagerstatter, Austria, Farmer August 9. Franz Jagerstatter. Jagerstatter started out like your average wild kid. As a teenager, he fathered a child out of wedlock, led a motorcycle gang, and got arrested for street fighting. But when he met the woman he soon married, she introduced him to Jesus, prayed with him, helped him grow in faith. And soon Jagerstatter stood all-in for Jesus Christ, which put him at odds with the Nazis. On this date in 1943, Jagerstatter was executed by guillotine. Sometimes it’s better to lose your head than to lose your integrity. In 1938, German troops marched into Austria, took over, and it legally became part of the Third Reich. They held a vote to determine whether Austria would adopt the Nazi leadership, and more than 99% of the population approved. The church—having seen what happened to clergy who disagreed with the Germans—took the position that it was the duty of all Austrians to obey legitimate authorities. And the entire village of Saint Radegund voted in favor of the Nazis, except one man. Franz Jagerstatter believed that Christianity and Nazism were completely incompatible. Oil and water. Good and evil. The thought of believing in your country taking the place of believing in God was absurd. In about five years, he was drafted, and he refused to enter the war and fight for Hitler. Franz swore it was impossible to be a good Catholic and a true Nazi. His bishop—who believed as Franz did but did not want to face the consequences—confronted Franz, said that it was not his place to decide whether the war was righteous or unrighteous, said it was Franz’s duty to serve. -

Franz Jägerstätter Und Der Gerechte Krieg. Ein Oberösterreichischer Bauer Als Wegbereiter Der Modernen Bellum Iustum-Theorie Der Katholischen Kirche
Franz Jägerstätter und der gerechte Krieg. Ein oberösterreichischer Bauer als Wegbereiter der modernen bellum iustum-Theorie der katholischen Kirche Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra theologiae eingereicht von Stefanie Flattinger bei Ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt Remele Institut für Ethik und Gesellschaftslehre an der Kath.-Theol. Fakultät der Karl Franzens- Universität Graz Graz 2009 Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung.............................................................................................................................. 5 1. Die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.8 1.1 Definition ................................................................................................................... 8 1.1.1 Das ius ad bellum...................................................................................................... 8 1.1.2 Das ius in bello.......................................................................................................... 9 1.1.3 Wehrdienstverweigerung und bellum iustum-Theorie ........................................... 10 1.2 Historische Entwicklung.......................................................................................... 11 1.2.1 Die frühe Kirche ..................................................................................................... 11 1.2.2 Augustinus .............................................................................................................. 12 1.2.3 Legitimierung der