On 3-2007.Kern on 3-2007.Kern.Qxd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Katolický Týdeník 46
Katolický týdeník 46 10. – 16. listopadu 2020 / 33. neděle v mezidobí Ročník XXXI / Cena 15 Kč Nenávist Na Bílou horu pro smíření není odpověď, 400 let od bitvy na Bílé hoře zní po útocích si křesťané různých církví z Vídně připomněli minulou neděli při ekumenických nešporách „Dost bylo násilí. Pojďme u tamní mohyly. Poté v Aleji společně posílit mír Českých exulantů slavnostně a bratrství,“ vyzval odhalili Kříž smíření. papež František na svém twitterovém účtu poté, Od mohyly, symbolického místa smr- co dvacetiletý Rakušan ti, k symbolu smíření kráčel v chlad- útočil 2. listopadu večer ném nedělním odpoledni průvod na připomínku bitvy, která se odehrála v centru Vídně. 8. listopadu 1620. V modlitbě se spojily církve i židovská obec, aby vyznaly minu- lá zranění, prosily za odpuštění a naději Podobně tragický teroristický útok Ví- do budoucna. deň nezažila bezmála 40 let. O Vánocích Ekumenické nešpory vedli předseda 1985 teroristé zabíjeli na vídeňském le- České biskupské konference Jan Graub- tišti, v roce 1981 před vídeňskou syna- ner a předseda Ekumenické rady církví gogou na Seitenstettengasse. Právě zde a synodní senior Českobratrské církve začal i v pondělí 2. listopadu střílet mla- evangelické Daniel Ženatý. Úryvek z Ja- dý džihádista, rodák z vídeňského před- nova evangelia přečetl u mohyly arcibis- městí s albánskými kořeny, a zabil čtyři kup Graubner: „Neprosím však jen za lidi a dvě desítky zranil. Jeho samotného ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve později zastřelila policie. mne uvěří; aby všichni byli jedno jako „Papež František svěřuje oběti Bo- ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni by- žímu milosrdenství a úpěnlivě pro- li v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě sí Pána, aby násilí a nenávist skončily poslal.“ a bylo podporováno mírové soužití ve V následné Ženatého promluvě za- společnosti. -

Das Gründungscharisma Lebendig Halten
HUBERTUS BRANTZEN AUFTRAG UND SENDUNG ANREGUNGEN AUS DER ANSPRACHE VON PAPST FRANZISKUS AN DAS GENERALKAPITEL DER SCHÖNSTATT-PATRES Die Ansprache, die Papst Franziskus am 3. September 2015 im Konsistoriensaal an die Vertreter der Schönstatt-Patres hielt, ist unter mehreren Gesichtspunkten bemerkenswert. Einerseits kann sie als Anregung für den priesterlichen Dienst im Allgemeinen verstanden werden. In entsprechender Abwandlung könnte sie bei je- der Priesterweihe, bei jedem Priesterjubiläum, vor Diözesanpriestern ebenso wie vor Ordenspriestern gehalten werden. Andererseits bezieht sich Papst Franziskus gleich zu Beginn seiner Ausführungen auf das Gründungscharisma der Schönstatt-Bewegung, das es an die jüngere Ge- neration weiterzugeben gilt, und zwar „durch die geistliche Kraft, die dieses Cha- risma in sich trägt“. Durch diese inhaltliche Konditionierung der folgenden Gedan- ken macht der Papst die Ansprache zu einer spezifischen Ansprache für die Schönstatt-Bewegung, besonders ihre Priester, aber auch für alle Mitglieder der Bewegung. Das Gründungscharisma lebendig halten Eines der entscheidenden Probleme aller Ordensgemeinschaften und Geistlichen Bewegungen ist die nachhaltige Lebendigkeit deren Gründungscharismas. Wie in jeder Vergemeinschaftung und Etablierung einer Gründungsidee oder Gründungs- erfahrung besteht die Gefahr einer Verhärtung und Formalisierung, durch die die ursprüngliche Kraft, Dynamik und Relevanz verloren gehen. Zu Beginn eines solchen Prozesses steht eine überwältigende Erfahrung. Konkret auf die Schönstatt-Bewegung angewandt: Eine unscheinbare Kapelle wird zu ei- nem Gnadenort durch das Bündnis mit Maria und zum Ausgangspunkt der tiefgrei- fenden Erneuerung und Formung einer Gemeinschaft von Jugendlichen. Diese Er- fahrung besitzt eine solche explosive Kraft, dass sich davon drei folgende Genera- tionen davon anstecken und überzeugen lassen. Diese drei Generationen erleben den Gründer selbst oder Zeugen, die im direkten Kontakt mit dem Gründer standen. -
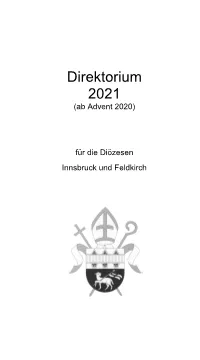
Direktorium 2021 (Ab Advent 2020)
Direktorium 2021 (ab Advent 2020) für die Diözesen Innsbruck und Feldkirch 3 Direktorium Ordnung für die Liturgie nach römischem Ritus zum Gebrauch für die Diözesen Innsbruck und Feldkirch für das Jahr 2021 (ab Advent 2020) Im Auftrag des Diözesanbischofs Hermann Glettler von Innsbruck und des Diözesanbischofs Benno Elbs von Feldkirch Für den Inhalt des liturgischen Kalendariums: Jakob Patsch, Christian Nuener Für den Inhalt der Kurz-Schematismen: Generalvikariate der Diözesen Innsbruck und Feldkirch Herausgegeben und verlegt vom Bischöflichen Ordinariat der Diözese Innsbruck, Riedgasse 11, 6020 Innsbruck 4 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS Abkürzungsverzeichnis 5 Kirchenjahr 2020/2021 7 Allgemeine Hinweise 8 1. Besondere Feiern 8 1.1. Kirchweihfest, Patrozinium oder Titelfest und andere Eigenfeste 8 1.2. Herz-Jesu-Freitag, Herz-Mariä-Samstag und monatlicher Gebetstag um geistliche Berufe 8 1.3. Trauungsmessen 9 1.4. Begräbnismessen 9 2. Bemerkungen zu einzelnen Teilen des Wortgottesdienstes 9 2.1. Zur Auswahl der Lesungen 9 2.2. Antwortpsalm mit Kehrvers (Responsorium) 10 2.3. Credo 10 3. Präfationen 10 4. Gesänge 10 5. Liturgische Kleidung 11 6. Applikationsverpflichtung 11 7. Binations- und Trinationsmessen 11 8. Bitt- und Quatembertage 11 9. Zur Beichtjurisdiktion 12 10. Zum Gedächnis der verstorbenen Mitbrüder 12 11. Liturgische Dienste von Laien: Ausbildungen 13 Kirchensammlungen 14 Kalendarium 2020/2021 20 Vorschau und bewegliche Feste 2021/2022 240 Kurz-Schematismus der Diözese Innsbruck 241 Kurz-Schematismus der Diözese Feldkirch 299 Abkürzungsverzeichnis 5 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS Liturgische Ränge: Liturgische Farben: H Hochfest GR (gr) grün F Fest R (r) rot G gebotener Gedenktag SCHW schwarz g nichtgebotener Gedenktag V (v) violett W (w) weiß Sonstige Abkürzungen: I–VIII Bd I–VIII des Meßlek- folg vom folgenden Tag tionars 1982–1986 Gb Glaubensbote ad lib ad libitum (nach Geb Gebet(e) freiem Ermessen) Gg Gabengebet AEM Allgemeine Einfüh- GK Gründer von Kirchen rung in das röm. -
Kulturführer Soll Dazu Einladen, Die Kultur Der Ferienregion Achensee Kennen Zu Lernen
Schutzgebühr Euro 1,-- Lvmuvs! bvg!Tdisjuu! voe!Usjuu Lvmuvsg isfs!Bdifotff Lvmuvsjogpsnbujpofo wpo!B!cjt![ xxx/bdifotff/jogp 2-3 Lebensart nennt man, was Kultur ist: In Tirol gehören Bergwandern und gutes Essen ebenso dazu wie der Besuch einer Ausstellung und eines Konzerts. Das Urlaubsland Tirol verbindet Natur, Kultur und Sport in idealer Weise. Dieser Kulturführer soll dazu einladen, die Kultur der Ferienregion Achensee kennen zu lernen. Fünf Orte – Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und Wiesing – werden mit ihren Kirchen, Kapellen, Museen, historischen Gebäuden und Denkmälern vorgestellt. Wir sind Ihnen für Vorschläge, die diesen Kulturführer noch attraktiver machen, jederzeit dankbar, und wir würden uns über Ihre Anregungen freuen. Tourismusverband Achensee Rathaus 387 A-6215 Achensee Tel. +43/(0)5246/5300 Fax +43/(0)5246/5333 www.achensee.info [email protected] Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Achensee Tourismus Herstellung: Agentur TAURUS, Kufstein Der Herausgeber haftet nicht für die Verbindlichkeit der angegebenen Preise. Änderung der Öffnungszeiten und Preisänderung vorbehalten. (Stand September 2008) 4-5 Häuserer Bichl Kapelle .......................................................... 34 Eggerer Kapelle ................................................................... 36 Buchauer Kapelle................................................................. 37 Hauskapelle Prälatenhaus ..................................................... 37 Hechenberg Bildstock.......................................................... -

(2007), Heft Nr. 4
ZEICHEN DER ZEIT ERHÖHTE SPEICHERKAPAZITÄT Für die Entdeckung des GMR-Effekts werden 2007 der französische Wissen- schaftler Albert Fert und der deutsche Physiker Peter Grünberg mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. In der Auflösung der Abkürzung verbirgt sich dahinter der Ausdruck „Giant Magnetoresistance“. Es handelt sich dabei um eine Technik zur Auslesung von gespeicherten Daten auf Computer-Festplatten. Unabhängig von- einander hatten die beiden herausgefunden, dass sehr schwache magnetische Veränderungen den elektrischen Widerstand sehr stark verändern können. Ein neu entwickelter hoch empfindlicher Lesekopf machte diese Entdeckung für die Compu- tertechnologie verwertbar. Denn je dichter eine Festplatte mit Informationen voll gepackt wird, desto schwächer sind die einzelnen magnetischen Felder, desto empfindlicher muss aber auch der Lesekopf sein. Festplatten in der heute üblichen Größe und Speicherkapazität wurden mit dieser Entdeckung erst möglich. Wer erinnert sich noch an die alten 5,25 Zoll-Disketten, auf denen kaum Daten Platz hatten? Kein Megabyte konnte man unterbringen. In den neuen Computern sind Festplatten von über 100 Gigabyte keine Seltenheit mehr. Wie sich die Zeiten ändern! Und das alles dank einer sehr praktischen und gut umgesetzten Erfindung aus dem Bereich der Nanotechnologie. Vom diesjährigen Physik-Nobelpreis profi- tieren nicht nur die beiden Preisträger und die Fachwissenschaft, sondern alle Computernutzer. Schon lange wird davon gesprochen, dass wir uns in einer Informations- und Wissensgesellschaft befinden. Der eigentliche Reichtum unserer Zeit besteht in der weltweit jederzeit verfügbaren Menge an Information und Wissen. Dabei ist die Menge an Daten, die täglich umgesetzt werden, schon längst nicht mehr zu über- schauen. Das gilt für den privaten Datenverbrauch ebenso wie für das im Internet gespeicherte globale Wissen der Menschheit. -

Montabaur 2 Nr
Jahrgang 49 - Freitag, den 05. März 2021 - Nr. 9 Wochenblatt VG Montabaur 2 Nr. 9/2021 Ihre Heimatgemeinde Notrufe und Bereitschaftsdienste finden Sie: ■ Polizei Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8:30 Uhr. Telefon-Nummer .................................................. 110 Krankenwagen / Service-Nr. Stadt Polizeiinspektion Deutsches Rotes Kreuz Montabaur ........................................... 02602/9226-0 Rettungsdienst Montabaur Polizeiinspektion Rhein-Lahn-Westerwald .................................. 19222 ab Seite 21 Westerburg ........................................... 02663/98050 aus allen Ortsnetzen Polizeiautobahnstation ■ Haustierärztlicher Notdienstring Bladernheim ..23 Horressen......25 Montabaur ........................................... 02602/9327-0 für die Bereiche Bad Ems, Bendorf, Koblenz, Nassau, Elgendorf .......24 Reckenthal.....25 Neuhäusel, Neuwied und Vallendar... 0159 0136 7099 Eschelbach... 24 Wirzenborn ....25 ■ Feuerwehr / Rettungsdienst Ettersdorf.......24 der Verbandsgemeinde Montabaur, Telefon ................................................................. 112 ■ Störungsdienste Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung ■ Ärzte Bereitschaftsdienst - außerhalb der Dienstzeit: Ahrbach- Ärztliche Bereitschaftspraxis Montabaur ISDN-Nummer.................................... 02602/101414 Brüderkrankenhaus Montabaur, oder Funktelefonnummer.................... 0171/3109441 gemeinden Koblenzer Straße. 11-13, Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung 56410 Montabaur Bereitschaftsdienst: ......................... -

Bekanntes Aus Dem Leben Der NS-Opfer
Bekanntes aus dem Leben der NS-Opfer Hedwig Löb, Vorderer Rebstock 14, Montabaur: Hier befand sich der Wohnsitz von Hedwig Löb. Hedwig Löb war Witwe. Ihr Mann, Moritz Löb, betrieb eines Eisen- und Ofenhandlung. Auch Hedwig Löb durfte nicht mehr in Montabaur bleiben. Am 11. Februar 1939 war sie in Frankfurt gemeldet. Sie wohnte zuerst in der Karlstraße 19 und ab 4. November 1940 in der Sternstraße 19. Am 1. September 1942 wurde sie durch die Gestapo Frankfurt / Main zum Ghetto Theresienstadt deportiert. Am 29. September 1942 kam sie in ein Vernichtungslager nach Treblinka. Adolf und Betty Heimann mit Tochter Ingeborg, Vorderer Rebstock 23, Mtb: Hier wohnte die Familie Heimann und betrieb ein Ladenlokal für Manufakturwaren. - Nach der Reichspogromnacht mussten die Heimanns ihr kleines Haus zu einem Spottpreis verkaufen, sollten aber vorerst noch in Montabaur bleiben. Adolf und Betty Heimann hatten eine Tochter namens Ingeborg, die psychisch leicht behindert war. Da sie nicht alleine leben konnte, wurde sie in den Kriegsjahren von ihren Eltern getrennt und 1940 in die Jacoby’sche Anstalt für Nerven- und Gemütskranke nach Bendorf-Sayn eingewiesen. Ihre Eltern, Adolf und Betty Heimann, wurden im August 1941 in die ehemalige Bergarbeitersiedlung in Friedrichssegen/Lahn eingewiesen, um dort Zwangsarbeit zu verrichten. Die Männer sortierten Alteisen und Schrott in der zwangsarisierten Firma „Friedrichssegener Eisenhandel“, die Frauen wurden im Ton- und Dachziegelwerk Friedrichssegen bei der Klinkerproduktion eingesetzt. Die Arbeit war körperlich sehr hart und erfolgte unter den allerschlechtesten Bedingungen. Die Unterkünfte waren verkommen, die Lebensbedingungen mehr als primitiv. Adolf und Betty Heimann wurden am 10. Juli 1942 über Frankfurt am Main in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort ermordet. -

Justice and Peace Scotland Catholic Social Thought Quotations (2020)
Justice and Peace Scotland Catholic Social Thought Quotations (2020) The church has a long tradition of teaching which speaks to issues of human rights, development, peacebuilding and social justice. This is called Catholic Social Thought, and is comprised of Scripture, teachings of the Saints, Papal encyclicals, and documents from Bishops Conferences around the world, collated together in documents known as ‘Catholic Social Doctrine’, or Catholic Social Teaching. It is a constantly evolving body of work, as the Church reads the ‘signs of the times’ and responds to situations of injustice. We have also included teachings from contemporary Catholic figures, recognised for their faith and work for social justice, peacebuilding, and integral human development as part of the Church’s mission to witness to Christ in the world. The quotes below have been collated with the intention of being included in parish newsletters / bulletins to reflect either the Mass readings for that week, or a significant date in the social justice calendar. They can also be used in schools, or for personal/ group prayer or reflection. These teachings are shared (week by week) as jpeg images on the Justice and Peace Scotland Facebook, Twitter and Instagram accounts, and all members are encouraged to share them through parish, diocesan, and personal accounts. Anyone with an interest in obtaining these pictures independently (e.g – for inclusion on a parish website in advance) should contact [email protected] CST quotes for Sundays in 2021 will be available December 2020. For more information please contact the Justice and Peace Scotland office. Or alternatively sign up to the Justice &Peace Scotland newsletter. -

Diapositiva 1
Catastro de la Oferta Programática de la red SENAME Departamento de Planificación y Control de Gestión Santiago, Abril 2018 PRESENTACIÓN La Oferta Programática del Servicio Nacional de Menores (SENAME) puede definirse como el conjunto de proyectos ejecutados por los distintos Organismos Colaboradores Acreditados de SENAME, que han sido reconocidos como tales a través de un acto administrativo del mismo Servicio y que cuentan con financiamiento para el desarrollo de sus labores dirigidas a la atención de niños, niñas y adolescentes, además de los centros que son administrados directamente, los que cuentan con funcionarios del Servicio y con presupuesto asignado a través de la Ley de Presupuesto. 1 El propósito central de la realización del documento “Catastro de la Oferta Programática de SENAME” es entregar información de los proyectos de que se dispone en cada región del país, para facilitar a cualquier usuario el acceso a esta información y el conocimiento de los recursos y servicios de esta Red de Protección Social a la Infancia y Adolescencia. Asimismo, su elaboración da respuesta a la necesidad de colaboración con los distintos actores relacionados con el SENAME. Es así que se prevé será de gran utilidad para los Tribunales de Justicia en el conocimiento y eventual derivación de niños, niñas y adolescentes a la red regional; los Gobiernos Regionales y Municipios en la perspectiva de la focalización de la atención que otorga la red de SENAME, como también internamente, para las Direcciones Regionales de SENAME en el desarrollo y la supervisión de la oferta programática de la región, las Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias para la entrega de información de los proyectos, Departamentos, Unidades, centros y proyectos de la red, etc. -

Gottesdienstordnung Vom 29.05.2021 Bis 31.08.2021
Kath. Pfarrei St. Laurentius Rosenstr. 13, 56412 Nentershausen Tel: 06485 –880060 Mail: [email protected] Homepage: www.sankt-laurentius.de Gottesdienstordnung vom 29.05.2021 bis 31.08.2021 Samstag, 29.05. Vorabend zum Dreifaltigkeitssonntag NIEDERAHR 11.00 Dankamt Diamanthochzeit der Ehel. Anneliese und Albert Fachbach NENTERSHAUSEN 14.30 Trauung des Brautpaares Sarah Stähler & Daniel Bernhard NENTERSHAUSEN 16.30 Beichtgelegenheit (bis 17.30 Uhr) HUNDSANGEN 18.00 Vorabendmesse NIEDERAHR 18.00 Vorabendmesse BODEN 18.00 Vorabendmesse Sonntag, 30.05. DREIFALTIGKEITSSONNTAG RUPPACH 09.00 Hochamt (mit Gedenken an Pater Richard Henkes) HADAMAR 10.30 Hochamt auf dem Herzenberg NENTERSHAUSEN 10.45 Hochamt MEUDT 10.45 Hochamt WALLMEROD 10.45 Hochamt zur Kirchweih GROßHOLBACH 10.45 Hochamt zum Patrozinium RUPPACH 18.00 Maiandacht - Abschluss des Marienmontas mit sakr. Segen Montag, 31.05. WALLMEROD 09.00 Dankamt zur Kirchweih STEINEFRENZ 18.00 Maiandacht DAHLEN 18.00 Heilige Messe Dienstag, 01.06. Hl. Justin, Philosoph, Märtyrer GIROD 09.00 Heilige Messe KLEINHOLBACH 17.30 Abendlob BEROD 18.00 Heilige Messe Mittwoch, 02.06. Hl. Marcellinus und hl. Petrus, Märtyrer in Rom GÖRGESHAUSEN 18.00 Vorabendmesse zu Fronleichnam mit sakr. Segen DREIKIRCHEN 18.00 Vorabendmesse zu Fronleichnam mit sakr. Segen NIEDERAHR 18.00 Vorabendmesse zu Fronleichnam mit sakr. Segen HEILIGENROTH 18.00 Hochamt zum Patrozinium Donnerstag, 03.06. HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI – FRONLEICHNAM NIEDERERBACH 09.00 Hochamt mit sakr. Segen HUNDSANGEN 09.00 Hochamt mit sakr. Segen BEROD 09.00 Hochamt mit sakr. Segen GROßHOLBACH 09.00 Hochamt mit sakr. Segen NENTERSHAUSEN 10.45 Hochamt mit sakr. Segen STEINEFRENZ 10.45 Hochamt mit sakr. -

Managing Dependencies in Complex Global Software Development Projects
Die approbierte Originalversion dieser Dissertation ist an der Hauptbibliothek der Technischen Universität Wien aufgestellt (http://www.ub.tuwien.ac.at). The approved original version of this thesis is available at the main library of the Vienna University of Technology (http://www.ub.tuwien.ac.at/englweb/). DISSERTATION Managing Dependencies in Complex Global Software Development Projects Ausgeführt zum Zwecke der Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der technischen Wissenschaften/der Naturwissenschaften unter der Leitung von Prof. Stefan Biffl 188 (Institutsnummer) Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme Eingereicht and der Technischen Universität Wien Fakultät für Informatik von Dipl.Ing. Matthias Heindl 9826997 1230 Wien, Maurer Langegasse 39-41/1/6 [email protected] Wien, am eigenhändige Unterschrift Managing Dependencies in Complex Global Software Development Projects DEUTSCHE KURZFASSUNG Global verteilte Softwareentwicklungsprojekte (GSD Projekte) sind komplex aufgrund zahlreicher Faktoren, wie z.B. einer üblicherweise hohen Anzahl von Anforderungen, der Verteiltheit der Projektteilnehmer, und der Unmenge an Abhängigkeiten in Arbeitsergebnissen (Anforderungsbeschreibungen, Testfallspezifikationen, Source Code). Eine wesentliche Herausforderung in solchen Projekten besteht darin, all diese Arbeitsergebnisse konsistent zu halten. Dies ist wichtig, um sicher zu stellen, dass die Dokumentation durchgängig und aussagekräftig bleibt und um Fehler in der Software aufgrund von fehlerhafter Dokumentation -

Excel Catalogue
Saint John the Evangelist Parish Library Catalogue AUTHOR TITLE Call Number Biography Abbott, Faith Acts of Faith: a memoir Abbott, Faith Abrams, Bill Traditions of Christmas J Abrams Abrams, Richard I. Illustrated Life of Jesus 704.9 AB Accattoli, Luigi When a Pope ask forgiveness 232.2 AC Accorsi, William Friendship's First Thanksgiving J Accorsi Biography More, Thomas, Ackroyd, Peter Life of Thomas More Sir, Saint Adair, John Pilgrim's Way 914.1 AD Cry of the Deer: meditations on the hymn Adam, David of St. Patrick 242 AD Adoff, Arnold Touch the Poem J 811 AD Aesop Aesop for Children J 398.2 AE Parish Author Ahearn, Anita Andreini Copper Range Chronicle 977.499 AH Curse of the Coins: Adventures with Sister Philomena, Special Agent to the Pope no. Ahern Dianne 3 J Ahern Secrets of Siena: Adventures with Sister Philomena, Special Agent to the Pope no. Ahern Dianne 4 J Ahern Break-In at the Basilica: Adventrues with Sister Philomena, Special Agent to the Ahern, Dianne Pope no.2 J Ahern Lost in Peter's Tomb: Adventures with Sister Philomena, Special Agent to the Ahern, Dianne Pope no. 1 J Ahern Ahern, Dianne Today I Made My First Communion J 265.3 AH Ahern, Dianne Today I Made My First Reconciliation J 265.6 AH Ahern, Dianne Today I was Baptized J 264.02 AH Ahern, Dianne Today Someone I Loved Passed Away J 265.85 AH Ahern, Dianne Today we Became Engaged 241 AH YA Biography Ahmedi, Farah Story of My Life Ahmedi Aikman, David Great Souls 920 AK Akapan, Uwem Say You're one of the Them Fiction Akpan Biography Gruner, Alban, Francis Fatima Priest Nicholas Albom, Mitch Five people you meet in Heaven Fiction Albom Albom, Mitch Tuesdays with Morrie 378 AL Albom,.