Josef Mengele Der Arzt Von Auschwitz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

From Humiliation to Humanity Reconciling Helen Goldman’S Testimony with the Forensic Strictures of the Frankfurt Auschwitz Trial
S: I. M. O. N. Vol. 8|2021|No.1 SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. Andrew Clark Wisely From Humiliation to Humanity Reconciling Helen Goldman’s Testimony with the Forensic Strictures of the Frankfurt Auschwitz Trial Abstract On 3 September 1964, during the Frankfurt Auschwitz trial, Helen Goldman accused SS camp doctor Franz Lucas of selecting her mother and siblings for the gas chamber when the family arrived at Birkenau in May 1944. Although she could identify Lucas, the court con- sidered her information under cross-examination too inconsistent to build a case against Lucas. To appreciate Goldman’s authority, we must remove her from the humiliation of the West German legal gaze and inquire instead how she is seen through the lens of witness hospitality (directly by Emmi Bonhoeffer) and psychiatric assessment (indirectly by Dr Walter von Baeyer). The appearance of Auschwitz survivor Helen (Kaufman) Goldman in the court- room of the Frankfurt Auschwitz trial on 3 September 1964 was hard to forget for all onlookers. Goldman accused the former SS camp doctor Dr Franz Lucas of se- lecting her mother and younger siblings for the gas chamber on the day the family arrived at Birkenau in May 1944.1 Lucas, considered the best behaved of the twenty defendants during the twenty-month-long trial, claimed not to recognise his accus- er, who after identifying him from a line-up became increasingly distraught under cross-examination. Ultimately, the court rejected Goldman’s accusations, choosing instead to believe survivors of Ravensbrück who recounted that Lucas had helped them survive the final months of the war.2 Goldman’s breakdown of credibility echoed the experience of many prosecution witnesses in West German postwar tri- als after 1949. -

FRA Handbook for Teachers
Excursion to the past – teaching for the future: Handbook for teachers 1 This Handbook covers most of the articles as enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular those relating to Chapter I to IV - dignity, freedoms, equality, solidarity and citizens’ rights. Cover image: © Michael St. Maur Sheil/CORBIS October Auschwitz, Poland Michael St. Maur Sheil Encyclopedia FRA - European Union Agency for Fundamental Rights Schwarzenbergplatz 11 1040 - Wien Austria Tel.: +43 (0)1 580 30 - 0 Fax: +43 (0)1 580 30 - 691 E-Mail: [email protected] www.fra.europa.eu Excursion to the past – teaching for the future: Handbook for teachers FOREWORD Th e Holocaust has taught us that without respect and application of basic human rights the unspeakable can become a reality. Th ere is therefore a close connection between the Holocaust and subsequent human rights developments. Th e adoption of the Universal Declaration of Human Rights in , and later the adoption of European regional human rights instruments, was followed by a gradual coming to terms with the lessons of the Holocaust and its signifi cance for the values that strengthen the European Union today. Th e European Union recognises the Holocaust as a key and seminal event in European history and heritage. Th e values that underpin the European Union and are common to all its Member States have key aspects related directly to the experience of the Jewish populations during the period before, during and after the Second World War. Th e concepts of the universality and indivisibility of human rights become even more pronounced when we look back at the Holocaust and realise the need to remain vocal and vigilant on the question of human rights. -
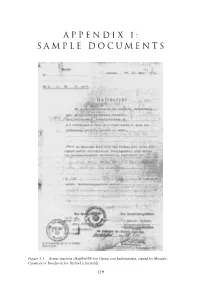
Appendix 1: Sample Docum Ents
APPENDIX 1: SAMPLE DOCUMENTS Figure 1.1. Arrest warrant (Haftbefehl) for Georg von Sauberzweig, signed by Morgen. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 129 130 Appendix 1 Figure 1.2. Judgment against Sauberzweig. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde Appendix 1 131 Figure 1.3. Hitler’s rejection of Sauberzweig’s appeal. Courtesy of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 132 Appendix 1 Figure 1.4. Confi rmation of Sauberzweig’s execution. Courtesy of Bundesarchiv Berlin- Lichterfelde Appendix 1 133 Figure 1.5. Letter from Morgen to Maria Wachter. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut APPENDIX 2: PHOTOS Figure 2.1. Konrad Morgen 1938. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut 134 Appendix 2 135 Figure 2.2. Konrad Morgen in his SS uniform. Estate of Konrad Morgen, courtesy of the Fritz Bauer Institut 136 Appendix 2 Figure 2.3. Karl Otto Koch. Courtesy of the US National Archives Appendix 2 137 Figure 2.4. Karl and Ilse Koch with their son, at Buchwald. Corbis Images Figure 2.5. Odilo Globocnik 138 Appendix 2 Figure 2.6. Hermann Fegelein. Courtesy of Yad Vashem Figure 2.7. Ilse Koch. Courtesy of Yad Vashem Appendix 2 139 Figure 2.8. Waldemar Hoven. Courtesy of Yad Vashem Figure 2.9. Christian Wirth. Courtesy of Yad Vashem 140 Appendix 2 Figure 2.10. Jaroslawa Mirowska. Private collection NOTES Preface 1. The execution of Karl Otto Koch, former commandant of Buchenwald, is well documented. The execution of Hermann Florstedt, former commandant of Majdanek, is disputed by a member of his family (Lindner (1997)). -

Nachwort Zur Dritten Auflage
Nachwort zur dritten Auflage Seit Erscheinen der Erstauflage dieses Buches im Jahre 1993 haben sich hinsicht- lich der Rezeption des Verfolgungsschicksals der Zeugen Jehovas im „Dritten Reich" eine Reihe gravierender Veränderungen vollzogen. Jahrzehntelang blieb den Zeugen Jehovas eine öffentliche Würdigung als Opfer- gruppe versagt. Auch in der Wissenschaft stieß ihre Geschichte im großen und ganzen auf kein Interesse. Dieses Los teilen die Zeugen Jehovas mit anderen Grup- pen von Nazi-Verfolgten, deren gesellschaftliche Marginalisierang auch nach 1945 fortdauerte, beispielsweise den Sinti und Roma. Im Osten Deutschlands, wo unter Verweis auf die revolutionäre Tradition der herrschenden Partei und die im eigenen Land angeblich erfolgte Einlösung des antifaschistischen Vermächtnisses die Bevölkerung von der Verantwortung für die Vergangenheit freigesprochen bzw. exkulpiert wurde, waren die Zeugen Jehovas, die nach ihrem Verbot in der DDR im August 1950 erneuter Verfolgung ausgesetzt waren, allenfalls ein Thema für die Staatssicherheit. Sie wurden feindlicher Nach- richtentätigkeit und staatsfeindliche Handlungen bezichtigt. Um den für die DDR mißlichen Umstand, daß es sich bei den Zeugen Jehovas um Nazi-Verfolgte han- delte, zu begegnen, wurde vor keiner Diffamierung zurückgeschreckt: Bei der Füh- rung der Zeugen Jehovas habe es sich um „vom Großkapital gekaufte", „faschi- stisch kompromittierte religiös-politische Abenteurer" gehandelt, die um die „Gunst der Nazis" geworben und sich später zum „massenweisen Verrat der eigenen Glau- bensbrüder an die Gestapo" bereit erklärt hätten1. Im Westen Deutschlands, wo in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten Erin- nerungsverweigerung und Schuldabwehr in der Bevölkerung vorherrschten und der Reintegration der Verantwortlichen aus Verwaltung, Kriegswirtschaft und Wehrmacht weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde als der Rehabilitation der Nazi-Verfolgten, beschränkte sich lange Zeit die Beschäftigung mit „Verfolgung und Widerstand" im wesentlichen auf den 20. -

Thesis Title the Lagermuseum Creative Manuscript and 'Encountering Auschwitz: Touring the Auschwitz-Birkenau State Museum' C
Thesis Title The Lagermuseum Creative Manuscript and ‘Encountering Auschwitz: Touring the Auschwitz-Birkenau State Museum’ Critical Thesis Author Dr Claire Griffiths, BA (Hons), MA, PhD Qualification Creative and Critical Writing PhD Institution University of East Anglia, Norwich School of Literature, Drama and Creative Writing Date January 2015 Word Count 91,102 (excluding appendices) This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived there from must be in accordance with current UK Copyright Law. In addition, any quotation or extract must include full attribution. Abstract The Lagermuseum My creative manuscript – an extract of a longer novel – seeks to illuminate a little- known aspect of the history of the Auschwitz concentration and death camp complex, namely the trade and display of prisoner artworks. However, it is also concerned with exposing the governing paradigms inherent to contemporary encounters with the Holocaust, calling attention to the curatorial processes present in all interrogations of this most contentious historical subject. Questions relating to ownership, display and representational hierarchies permeate the text, characterised by a shape-shifting curator figure and artworks which refuse to adhere to the canon he creates for them. The Lagermuseum is thus in constant dialogue with my critical thesis, examining the fictional devices which often remain unacknowledged within established -

Intimacy Imprisoned: Intimate Human Relations in The
INTIMACY IMPRISONED: INTIMATE HUMAN RELATIONS IN THE HOLOCAUST CAMPS In fulfillment of EUH 6990 Dr. Daniel E. Miller 1 December 2000 Donna R. Fluharty 2 Each person surviving the Holocaust has their own personal narrative. A great number of these narratives have been written; many have been published. It is important for personal accounts to be told by each survivor, as each narrative brings a different perspective to the combined history. Knowing this, I dedicate my research to the narratives I was unable to read, whether they were simply unavailable or, unfortunately, unwritten. More importantly, this research is dedicated to those whose stories will never be told. 3 In his book Man’s Search for Meaning, Viktor Frankl states that a human being is able to withstand any condition if there is sufficient meaning to his existence, a theme which permeates the entire work. 1 For a significant number of people, the right to this search for meaning was denied by a Holocaust which took the lives of an undetermined number of European Jews, war criminals, homosexuals, Gypsies, children, and mentally or physically handicapped persons. This denial of humanness was an essential component of Adolph Hitler’s plan to elevate the Aryan nation and rid the world of undesirables. In spite of laws which dictated human associations, through the triumph of the human spirit, certain prisoners of the Nazi ghettos, labor camps, and death camps were able to survive. Many of these survivors have graced the academic and public world with a written account of their experiences as prisoners of the Nazis. -

Titel Strafverfahren
HESSISCHES LANDESARCHIV – HESSISCHES HAUPTSTAATSARCHIV ________________________________________________________ Bestand 461: Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt am Main Strafverfahren ./. Robert Mulka u.a. (1. Auschwitz-Prozess) Az. 4 Ks 2/63 HHStAW Abt. 461, Nr. 37638/1-456 bearbeitet von Susanne Straßburg Allgemeine Verfahrensangaben Delikt(e) Mord (NSG) Beihilfe zum Mord (NSG) Laufzeit 1958-1997 Justiz-Aktenzeichen 4 Ks 2/63 Sonstige Behördensignaturen 4 Js 444/59 ./. Beyer u.a. (Vorermittlungen) Verfahrensart Strafverfahren Verfahrensangaben Bd. 1-133: Hauptakten (in Bd. 95-127 Hauptverhandlungsprotokolle; in Bd. 128-133 Urteil) Bd. 134: Urteil, gebundene Ausgabe Bd. 135-153: Vollstreckungshefte Bd. 154: Sonderheft Strafvollstreckung Bd. 155-156: Bewährungshefte Bd. 157-165: Gnadenhefte Bd. 166-170: Haftsonderhefte Bd. 171-189: Pflichtverteidigergebühren Bd. 190-220: Kostenhefte Bd. 221-224: Sonderhefte Bd. 225-233: Entschädigungshefte Bd. 234-236: Ladungshefte Bd. 237: Anlage zum Protokoll vom 3.5.1965 Bd. 238-242: Gutachten Bd. 243-267: Handakten Bd. 268: Fahndungsheft Baer Bd. 269: Auslobung Baer Bd. 270: Sonderheft Anzeigen Bd. 271-272: Sonderhefte Nebenkläger Bd. 273-274: Ermittlungsakten betr. Robert Mulka, 4 Js 117/64 Bd. 275-276: Zuschriften Bd. 277-279: Berichtshefte Bd. 280-281: Beiakte betr. Josef Klehr, Gns 3/80, Handakten 1-2 Bd. 282: Sonderheft Höcker Bd. 283: Zustellungsurkunden Bd. 284: Übersetzung der polnischen Anklage vom 28.10.1947 Bd. 285: Fernschreiben Bd. 286; Handakte Auschwitz der OStA I Bd. 287-292: Pressehefte Bd. 293-358: Akten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg Bd. 359-360: Anlageband 12 Bd. 361: Protokolle ./. Dr. Lucas Bd. 362: Kostenheft i.S. Dr. Schatz Bd. 363: Akte der Zentralen Stelle des Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg Bd. -

Jewish Genocide in Galicia
Jewish Genocide in Galicia Jewish Genocide in Galicia 2nd Edition With Appendix: Vernichtungslager ‘Bełżec’ Robin O’Neil Published by © Copyright Robin O’Neil 2015 JEWISH GENOCIDE IN GALICIA All rights reserved. The right of Robin O’Nei to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, nor translated into a machine language, without the written permission of the publisher. Condition of sale This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. ISBN Frontispiece: The Rabka 4 + 1 - incorporating the original book cover of Rudolf Reder’s ‘Bełżec’, 1946. 2nd Edition Part 1 2016: The Rabka Four + 1. First published 2011 under the title ‘The Rabka Four’. Contents Academic Excellence In Murder......................................i Dedication....................................................................... ii Lives Remembered .........................................................iv Note on Language...........................................................vi The Hunting Grounds for the Rabka 4 + 1 (zbV) 1941-1944 .........................................................................x -

Law and Morality Under Evil Conditions: the SS Judge Konrad Morgen
DOI: 10.5235/Jurisprudence.3.2.367 (2012) 3(2) Jurisprudence 367–390 Law and Morality under Evil Conditions: The SS Judge Konrad Morgen Herlinde Pauer-Studer* 1. INTRODUCTION The main test for the dispute between legal positivists and natural law theorists1 has been the existence of wicked legal systems—first and foremost, the striking case of the Nazi legal system. In Anglo-American legal theory the issue of Nazi law has to a large extent been seen in light of the exchange between HLA Hart and Lon L Fuller * Research for this paper was funded by the ERC Advanced Research Grant ‘Distortions of Normativ- ity’. I owe thanks to several colleagues for their interest in the project and their most valuable feedback. For extensive discussions on the case of the SS judge Konrad Morgen and helpful comments on an earlier version of this paper I would like to thank J David Velleman, who also provided the archive material from the US National Archives. Thanks also to Joan C Tronto for comments on an earlier draft of this paper. Parts of this paper were presented at a conference on ‘Authority, Legality, and Legitimacy’ funded by the ERC project ‘Distortions of Normativity’ at the University of Vienna in May 2011. I would like to thank the participants of this conference, especially Julian Fink, Klaus Günther, Thomas Mertens, Liam Murphy, Fabienne Peter, Joseph Raz and Kristen Rundle for help- ful responses and discussion. I also thank David Dyzenhaus, Veli Mitova, Carolyn Benson, Alexandra Couto and Christoph Hanisch for valuable discussions on the issue of Nazi law. -

Auschwitz Gesamt
„GERICHTSTAG HALTEN ÜBER UNS SELBST“ (FRITZ BAUER) SZENISCHE LESUNG AUSCHWITZPROZESS Unter Mitwirkung des Gipsy-Swing-Ensembles Roberto Rosenberger Buchcafé Bad Hersfeld, 27. Januar 2016, 20:00 Uhr Aus Anlass des Tages der Befreiung des VernicHtungslagers AuscHwitz Programm Einführung Szenische Lesung Anlagen: - Kurzvita Oswald Kaduk, WilHelm Boger, Stefan Baretzki - Urteil 1. Frankfurter AuscHwitz-Prozeß (ohne Begründung) - Sonstige Urteile AuscHwitz-Täter im In- und Ausland (nicHt vollständig) 1 „GERICHTSTAG HALTEN ÜBER UNS SELBST“ (FRITZ BAUER) SZENISCHE LESUNG AUSCHWITZPROZESS Unter Mitwirkung des Gipsy-Swing-Ensembles Roberto Rosenberger Buchcafé Bad Hersfeld, 27. Januar 2016, 20:00 Uhr Aus Anlass des Tages der Befreiung des VernicHtungslagers AuscHwitz. SZENISCHE LESUNG Rollen - Richter - Staatsanwalt - Angeklagte Oswald Kaduk WilHelm Boger Stefan Baretzki - Zeugin Texteinrichtung: Dieter Schenk Mit freundlicHer Unterstützung des Fritz Bauer Instituts Frankfurt a.M. PROGRAMM Begrüßung durch das Buchcafé Einführung: Dieter Schenk Fritz Bauer und der AuscHwitzprozess Gipsy-Swing/Eröffnung I VerHör Angeklagter Oswald Kaduk Richter/Staatsanwalt Zeugin (Auszug VerneHmung Anna ScHmidt) Gipsy-Swing/Zwischenmusik II VerHör Angeklagter WilHelm Boger Richter Zeugin (Auszüge VerneHmung Maryla RosentHal u.a.) Gipsy-Swing/Zwischenmusik III VerHör Angeklagter Stefan Baretzki Richter/Staatsanwalt Zeugin (Auszüge VerneHmung Lilliy Jansen u.a.) Gipsy-Swing/Zwischenmusik IV Plädoyer Staatsanwalt (AusscHnitt Allgemeiner Teil) V Video Angeklagte im -

Genesi E Funzioni Del Campo Di Birkenau
AAARGH Giugno 2008 Carlo Mattogno Genesi e funzioni del campo di Birkenau Robert Jan van Pelt è stato uno dei primi scrittori ad avere accennato all'importanza di Auschwitz nei progetti delle SS di colonizzazione dei territori orientali occupati. Nel libro da lui scritto in collaborazione con Debórah Dwork egli ha affermato che «la creazione del campo di Birkenau, che dalla fine del 1942 era diventato il maggiore centro di annientamento ebraico d'Europa, era collegata direttamente al programma di Himmler di trasformare Auschwitz in un paradigma di colonizzazione tedesca all'Est»1. Successivamente van Pelt ha cercato di sviluppare questa tesi in riferimento soprattutto all'Alta Slesia 2, ma ulteriori ricerche hanno poi documentato che questo paradigma era parte di un progetto molto più vasto, il “Generalplan Ost”, il “progetto generale Est”, che coinvolse i campi di Birkenau, di Lublino e di Stutthof come semplici centri di raccolta di manodopera, prima di prigionieri di guerra sovietici, poi di Ebrei. Questa nuova interpretazione è stata sostenuta in particolare da Jan Erik Schulte, autore di un importante articolo intitolato «Vom Arbeits- zum Vernichtungslager. Die Entstehungsgeschichte von Auschwitz-Birkenau 1941/42» (Dal campo di lavoro al campo di sterminio. Storia della genesi di Auschwitz- Birkenau 1941-1942)3 che delinea appunto la storia iniziale del campo di Birkenau, inquadrandola nel “Generalplan Ost”. Ne riassumo i punti essenziali, inserendoli in una prospettiva più ampia. Nelle cosiddette annotazioni di Cracovia, Rudolf Höss, il primo comandante di Auschwitz, scrisse: 1 D. Dwork, R. J. van Pelt, Auschwitz 1270 to the present. W.W. Norton & Company. -

Destruction and Human Remains
Destruction and human remains HUMAN REMAINS AND VIOLENCE Destruction and human remains Destruction and Destruction and human remains investigates a crucial question frequently neglected in academic debate in the fields of mass violence and human remains genocide studies: what is done to the bodies of the victims after they are killed? In the context of mass violence, death does not constitute Disposal and concealment in the end of the executors’ work. Their victims’ remains are often treated genocide and mass violence and manipulated in very specific ways, amounting in some cases to true social engineering with often remarkable ingenuity. To address these seldom-documented phenomena, this volume includes chapters based Edited by ÉLISABETH ANSTETT on extensive primary and archival research to explore why, how and by whom these acts have been committed through recent history. and JEAN-MARC DREYFUS The book opens this line of enquiry by investigating the ideological, technical and practical motivations for the varying practices pursued by the perpetrator, examining a diverse range of historical events from throughout the twentieth century and across the globe. These nine original chapters explore this demolition of the body through the use of often systemic, bureaucratic and industrial processes, whether by disposal, concealment, exhibition or complete bodily annihilation, to display the intentions and socio-political frameworks of governments, perpetrators and bystanders. A NST Never before has a single publication brought together the extensive amount of work devoted to the human body on the one hand and to E mass violence on the other, and until now the question of the body in TTand the context of mass violence has remained a largely unexplored area.