287 Kunst Des 19. Jahrhunderts 30. Mai 2018 30
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oil Sketches and Paintings 1660 - 1930 Recent Acquisitions
Oil Sketches and Paintings 1660 - 1930 Recent Acquisitions 2013 Kunsthandel Barer Strasse 44 - D-80799 Munich - Germany Tel. +49 89 28 06 40 - Fax +49 89 28 17 57 - Mobile +49 172 890 86 40 [email protected] - www.daxermarschall.com My special thanks go to Sabine Ratzenberger, Simone Brenner and Diek Groenewald, for their research and their work on the text. I am also grateful to them for so expertly supervising the production of the catalogue. We are much indebted to all those whose scholarship and expertise have helped in the preparation of this catalogue. In particular, our thanks go to: Sandrine Balan, Alexandra Bouillot-Chartier, Corinne Chorier, Sue Cubitt, Roland Dorn, Jürgen Ecker, Jean-Jacques Fernier, Matthias Fischer, Silke Francksen-Mansfeld, Claus Grimm, Jean- François Heim, Sigmar Holsten, Saskia Hüneke, Mathias Ary Jan, Gerhard Kehlenbeck, Michael Koch, Wolfgang Krug, Marit Lange, Thomas le Claire, Angelika and Bruce Livie, Mechthild Lucke, Verena Marschall, Wolfram Morath-Vogel, Claudia Nordhoff, Elisabeth Nüdling, Johan Olssen, Max Pinnau, Herbert Rott, John Schlichte Bergen, Eva Schmidbauer, Gerd Spitzer, Andreas Stolzenburg, Jesper Svenningsen, Rudolf Theilmann, Wolf Zech. his catalogue, Oil Sketches and Paintings nser diesjähriger Katalog 'Oil Sketches and Paintings 2013' erreicht T2013, will be with you in time for TEFAF, USie pünktlich zur TEFAF, the European Fine Art Fair in Maastricht, the European Fine Art Fair in Maastricht. 14. - 24. März 2013. TEFAF runs from 14-24 March 2013. Die in dem Katalog veröffentlichten Gemälde geben Ihnen einen The selection of paintings in this catalogue is Einblick in das aktuelle Angebot der Galerie. Ohne ein reiches Netzwerk an designed to provide insights into the current Beziehungen zu Sammlern, Wissenschaftlern, Museen, Kollegen, Käufern und focus of the gallery’s activities. -

Achenbach 1995 Sigrid Achenbach: Käthe Kollwitz (1867–1945)
Originalveröffentlichung in: Doosry, Yasmin ; Lauterbach, Christiane ; Pommeranz, Johannes (Hrsgg.): Die Frucht der Verheißung : Zitrusfrüchte in Kunst und Kultur ; Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 19. Mai - 11. September 2011, Nürnberg 2011 Achenbach 1995 Sigrid Achenbach: Käthe Kollwitz (1867–1945). Zeichnungen und seltene Graphik im Berliner Kupferstichkabinett (Bilderhefte der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 79–81). Berlin 1995. Adams/Adams 1987 Len Adams/Yvonne Adams: Meissen portrait figures. London 1987. Alberg 1984 Werner Alberg: Die „Madonna con santi“. Darstellungen der venezianischen und florentinischen Malerei. Diss. Bochum 1984. Alberti 1912 Leon Battista Alberti: Zehn Bücher über die Baukunst. Übersetzung von Max Theuer. Wien/Leipzig 1912 (ca. 1432). Albertus Magnus 1867 Albertus Magnus: Alberti Magni ex ordine praedicatorum de Vegetabilibus libri VII, historiae naturalis pars XVIII. Ed. Criticam ab Ernesto Meyero coeptam absolvit Carolus Jessen. Berlin 1867. Albrecht 2008 Peter Albrecht: Die Absatzstrategien im Bereich Handel. In: Kaufhold/Leuschner/Märtl 2880, S. 736–792. Alciati 1577 Andrea Alciati: Emblemata. Antwerpen 1577. Allen/Hubbs 1980 Sally G. Allen/Joanna Hubbs: Outrunning Atalanta: Feminine Destiny in Alchemical Transmutation. In: Signs 6, 1980, Nr. 2, Studies in Change, S. 210–229. Alpers 1998 Svetlana Alpers: Kunst als Beschreibung. Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Köln 2. Aufl. 1998 (1983). Alzheimer/Rausch/Reder/Selheim 2010 Heidrun Alzheimer/Fred G. Rausch/Klaus Reder/Claudia -

Jessica Backhaus -- Resume
Jessica Backhaus -- Resume RESIDENCE: Berlin, Germany SOLO EXHIBITIONS: 2019 – "A TRILOGY", MiCamera/Mutty, Castiglione delle Stiviere, Italy. 2019 – "A TRILOGY", Galerie Anja Knoess, Cologne, Germany. 2018 – "A TRILOGY and six degrees of freedom ", Goethe-Institut, Paris, France. 2018 – "A TRILOGY and six degrees of freedom", Design Offices, Frankfurt, Germany. 2018 – "A TRILOGY and six degrees of freedom", Copenhagen Photo Festival, Copenhagen, Denmark. 2018 – "A TRILOGY and six degrees of freedom", Tschick Galerie, Linz, Austria. 2018 – "A TRILOGY", Robert Morat Galerie, Berlin, Germany. 2018 – "A TRILOGY", Darmstädter Tage der Fotografie, Darmstadt, Germany. 2018 – "A TRILOGY and six degrees of freedom", Carlos Carvalho Arte Contemporanea, Lisbon, Portugal. 2017 – "Rinascita" – Jessica Backhaus, Fortezza del Girifalco, Cortona, Italy. 2017 – "Memory", Centrum Kultury Zamek, Poznan, Poland. 2017 – "Six degrees of freedom" in cooperation with Petra Becker/International Art Bridge at Ballwanz Lebenswelten, Frankfurt, Germany. 2017 – "Six degrees of freedom", Wouter van Leeuwen Gallery, Amsterdam, The Netherlands. 2017 – “Six degrees of freedom”, Micamera, Milan, Italy 2016 – “Six degrees of freedom”, Galerie Anja Knoess, Cologne, Germany 2016 – “Six degrees of freedom”, Robert Morat Galerie, Berlin, Germany 2014 – “Once, still and forever”, Micamera, Milan, Italy 2013 – “Once, still and forever”, Stieglitz 19, Antwerp, Belgium 2013 – “Classic-Contemporary”, Kunsthalle Erfurt, Erfurt, Germany 2013 – “Once, still and forever”, Robert Klein -

Daxer & M Arschall 20 16
XXIII Daxer & Marschall 2016 Recent Acquisitions, Catalogue XXIII, 2016 Barer Strasse 44 | 80799 Munich | Germany Tel. +49 89 28 06 40 | Fax +49 89 28 17 57 | Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] | www.daxermarschall.com 2 Paintings, Oil Sketches and Sculptures, 1630-1928 My special thanks go to Simone Brenner and Diek Groenewald for their research and their work on the text. I am also grateful to them for so expertly supervising the production of the catalogue. We are much indebted to all those whose scholarship and expertise have helped in the preparation of this catalogue. In particular, our thanks go to: Martina Baumgärtel, John Bergen, Brigitte Brandstetter, Regine Buxtorf, Thomas le Claire, Sue Cubitt, Francesca Dini, Marina Ducrey, Isabel Feder, Sabine Grabner Sibylle Gross, Mechthild Haas, Frode Haverkamp, Kilian Heck, Ursula Härting, Jean-François Heim, Gerhard Kehlenbeck, Michael Koch, Rudolf Koella. Miriam Krohne, Bjørn Li, Philip Mansmann, Marianne von Manstein, Dan Malan, Verena Marschall, Giuliano Matteucci, Hans Mühle, Werner Murrer, Anette Niethammer, Astrid Nielsen, Claudia Nordhoff. Otto Naumann, Susanne Neubauer, Marcel Perse, Max Pinnau, Mara Pricoco, Katrin Rieder, Herbert Rott, Hermann A. Schlögl, Arnika Schmidt, Annegret Schmidt-Philipps, Ines Schwarzer, Atelier Streck, Caspar Svenningsen, Jörg Trempler, Gert-Dieter Ulferts, Gregor J. M. Weber, Gregor Wedekind, Eric Zafran, Wolf Zech, Christiane Zeiller. Our latest catalogue Paintings, Oil Sketches and Unser diesjähriger Katalog Paintings, Oil Sketches and Sculptures erreicht Sculptures appears in good time for TEFAF, The sie pünktlich zur TEFAF, The European Fine Art Fair in Maastricht. European Fine Art Fair in Maastricht. Viele Werke kommen direkt aus privaten Sammlungen und waren seit Jahren, Many of the works being sold come directly from manchmal Jahrzehnten nicht mehr auf dem Markt. -

Kat. Lithographie 30.#1BF1E.Qxd
. r J r e d i e n h c S . P . J www.j-p-schneider.com Editor: J. P. Schneider jr. Kunsthandlung Catalogue entries: Max Andreas (MA) Dr. Eva Habermehl (EH) Dr. Roland Dorn (RD) Translations: Bronwen Saunders Rossmarkt 23 Photography: D-60311 Frankfurt am Main Marthe Andreas +49 (0)69 281033 Layout and reproduction: [email protected] Michael Imhof Verlag, Petersberg www.j-p-schneider.com Print: Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg © J. P. Schneider jr. Verlag 2017 ISBN 978-3-9802873-3-3 Prices on request German Catalogue available CONTENT Foreword .................................................................................... 7 17 Johann Heinrich Hasselhorst Bei Civita Castellana (Near Civita Castellana) ....................... 42 18 Eduard Wilhelm Pose 1 Johann Jakob Jung Römische Campagna mit Aquädukt Die Heilige Familie (The Holy Family) .................................... 8 (Campagna Romagna with Aqueduct) ................................... 44 2 Johann Rasso Januarius Zick 19 Carl Morgenstern Kreuzigung, Golgatha (Crucifixion, Golgotha) ........................ 10 Golf von Sorrent (Gulf of Sorrento) ........................................ 46 3 Wilhelm Altheim 20 Eduard Wilhelm Pose Der barmherzige Samariter (The Good Samaritan) .................. 12 Haus des Tasso, Sorrent (House of Torquato Tasso, Sorrento) .... 49 4 Joseph Carl Cogel(s) 21 Gustav Friedrich Papperitz Blick auf die Stadt Frankfurt am Main Abendliche Landschaft bei Rom mit Castel Gandolfo (View of the City of Frankfurt am Main) ............................... -

Archäologie Und Politik
3 ROBERT BORN Zwischen Kulturschutz und Kulturgutraub Deutsche Archäologie in Rumänien vor und während der Besatzungszeit (1916–1918) De la protejarea patrimoniului cultural la furtul bunurilor culturale Arheologia germană în România înainte și în timpul ocupației (1916–1918) Between Cultural Protection and Looting German Archaeology in Romania before and during the Occupation (1916 to 1918) 84 ROBERT BORN Abb. 1: Alexandru TzigaraSamurcaș Fig. 1: Alexandru TzigaraSamurcaș împre Fig. 1: Alexandru TzigaraSamurcaș gemeinsam mit Kaiser Wilhelm II. und ună cu Împăratul German Wilhelm al IIlea together with the German emperor Feldmarschall August von Mackensen vor și Mareșalul August von Mackensen la Wilhelm II and Field Marshal August von der Kirche in Curtea de Argeș im Septem biserica Curtea de Argeș în septembrie Mackensen at the Church in Curtea de ber 1917 (A. TzigaraSamurcaș, Curtea de 1917 (Alexandru TzigaraSamurcaș. Curtea Argeș in September 1917 (A. TzigaraSamur Argeș, Rumanien in Wort und Bild 1.19/20, de Argeș, în: Rumanien in Wort und Bild caș, Curtea de Argeș, Rumanien in Wort 1917, 3–5). 1.19/20, 1917, 3–5). und Bild 1.19/20, 1917, 3–5). Die Übersetzungen dieses Artikels stammen vom Autor selbst. i Traducerile acestui articol au fost realizate de către autor. The translations of this article have been produced by the author. ROBERT BORN 85 Als Kaiser Wilhelm II. im Herbst 1917 În cadrul unei călătorii în Balcani în In the autumn of 1917, emperor Wil im Rahmen einer Balkanreise länger toamna anului 1917, împăratul Wilhelm helm II had an extended stay in Roma in Rumänien weilte, besuchte er neben al IIlea a petrecut o perioadă mai lungă nia as part of a trip to the Balkans den für die weitere Kriegsführung wich de timp în România. -

Download Press Release
Exhibition Facts Press conference 30 January 2020 | 10 am Opening 30 January 2020 | 18.30 pm Duration 31 January – 26 July 2020 Venue Colonade Hall Curator Dr. Marianne von Manstein Bernhard von Waldkirch Works ca. 60 Catalogue Available for EUR 39.90 (German) onsite at the Museum Shop as well as via www.albertina.at Contact Albertinaplatz 1 | 1010 Vienna T +43 (01) 534 83 0 [email protected] www.albertina.at Opening Hours Daily 10 am – 6 pm Wednesdays & Fridays 10 am – 9pm Press contact Fiona Sara Schmidt T +43 (01) 534 83 511 | M +43 (0)699 12178720 [email protected] Sarah Wulbrandt T +43 (01) 534 83 512 | M +43 (0)699 10981743 [email protected] Wilhelm Leibl The Art of Seeing! 31 January – 26 July 2020 Encouraged by Courbet, influenced by Manet, and esteemed by Van Gogh, Wilhelm Leibl (1844–1900) was among the most important representatives of realism in Europe. His work as an artist centered on human beings in their everyday realities. And with his retreat from the city to the rural world, Leibl founded a style of modern figural painting in which the truth of nature took priority over the idyllic and narrative tendencies of traditional genre painting. Wilhelm Leibl’s guiding principle was not that his models be beautiful, but that they be “well perceived.” Leibl painted primarily portraits and indoor scenes featuring rural figures, with his emphasis consistently on the “how” of painterly execution. The Cologne native studied in Munich, where he quickly made a name for himself with his talent. -

Kulturbericht 2012 Kulturbericht
Kulturbericht-2012-FX.indd 1 Kulturbericht 2012 Kulturbericht 12.05.13 21:04 2 0 12 KULTURBERICHT 2012 Überblick Kulturangelegenheiten Bundesmuseen Österreichische Nationalbibliothek Bundestheater Denkmalschutz Museumsquartier Stiftungen Weitere Kulturangelegenheiten EU- und internationale Kulturangelegenheiten Restitution Impressum Herausgeber Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Kultursektion, Minoritenplatz 5, 1014 Wien Redaktion Michael P. Franz, Ruth-Veronika Pröckl Cover Christina Brandauer, Wien Grafische Gestaltung, Satz Peter Sachartschenko, Wien Herstellung AV + Astoria Druckzentrum, Wien Inhalt Überblick Kulturangelegenheiten Seite 7 Kulturbudget 2012 Seite 8 Museumsaufgaben Seite 8 Bundestheater Seite 11 Bundesmuseen Seite 13 Albertina Seite 14 Österreichische Galerie Belvedere Seite 26 Kunsthistorisches Museum, Museum für Völkerkunde, Seite 36 Österreichisches Theatermuseum MAK – Österreichisches Museum für angewandte Seite 58 Kunst/Gegenwartskunst Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig – mumok Seite 70 Naturhistorisches Museum Seite 80 Technisches Museum mit Österreichischer Mediathek Seite 97 Österreichische Nationalbibliothek Seite 111 Bundestheater Seite 123 Bundestheater-Holding Seite 125 Burgtheater Seite 129 Wiener Staatsoper Seite 135 Volksoper Wien Seite 144 Wiener Staatsballett Seite 151 ART for ART Theater Service Seite 156 Denkmalschutz Seite 159 Bedeutung von Denkmalschutz Seite 160 Abteilung Denkmalschutz des Bundesministeriums für Seite 160 Unterricht, Kunst und Kultur Bundesdenkmalamt Seite 167 -
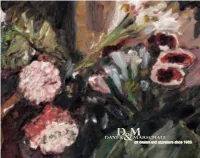
Daxer & M Arschall 20 17
XXIV Daxer & Marschall 2017 Recent Acquisitions, Catalogue XXIV, 2017 Barer Strasse 44 | 80799 Munich | Germany Tel. +49 89 28 06 40 | Fax +49 89 28 17 57 | Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] | www.daxermarschall.com 2 Paintings, Oil Sketches and Sculpture, 1760-1940 My special thanks go to Simone Brenner and Diek Groenewald for their research and their work on the text. I am also grateful to them for so expertly supervising the production of the catalogue. We are much indebted to all those whose scholarship and expertise have helped in the preparation of this catalogue. In particular, our thanks go to: Paolo Antonacci, Helmut Börsch-Supan, Thomas le Claire, Sue Cubitt, Eveline Deneer, Roland Dorn, Christine Farese Sperken, Stefan Hammenbeck, Kilian Heck, Gerhard Kehlenbeck, Rupert Keim, Cathrin Klingsöhr-Leroy, Isabel von Klitzing, Anna-Carola Krausse, Marit Lange, Bjørn Li, Philip Mansmann, Verena Marschall, Sascha Mehringer, Werner Murrer, Hans-Joachim Neidhardt, Max Pinnau, Klaus Rohrandt, Annegret Schmidt-Philipps, Anastasiya Shtemenko, Gerd Spitzer, Talabardon & Gautier, Niels Vodder, Vanessa Voigt, Diane Webb, Gregor J. M. Weber, Wolf Zech. Our latest catalogue Oil Sketches, Paintings and Unser diesjähriger Katalog Oil Sketches, Paintings and Sculpture, 2017 Sculpture, 2017 comes to you in good time for this erreicht Sie pünktlich zum Kunstmarktereignis des Jahres, TEFAF, The year’s TEFAF, The European Fine Art Fair in Maas- European Fine Art Fair, Maastricht, 9. - 19. März 2017. tricht. TEFAF is the international art market high point of the year. It runs from 9 to 19 March 2017. Der Katalog präsentiert Werke, die unseren qualitativen und ästhetischen Maßstäben gerecht werden. -

“Une Exposition (In)Complète”: Courbet in Vienna, 1873
Christian Huemer “Une exposition (in)complète”: Courbet in Vienna, 1873 Nineteenth-Century Art Worldwide 11, no. 2 (Summer 2012) Citation: Christian Huemer, “‘Une exposition (in)complète’: Courbet in Vienna, 1873,” Nineteenth-Century Art Worldwide 11, no. 2 (Summer 2012), http://www.19thc- artworldwide.org/summer12/christian-huemer-courbet-in-vienna. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art. Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. Huemer: “Une exposition (in)complète”: Courbet in Vienna, 1873 Nineteenth-Century Art Worldwide 11, no. 2 (Summer 2012) “Une exposition (in)complète”: Courbet in Vienna, 1873 by Christian Huemer “All I want to save is my paintings,” Gustave Courbet wrote from Ornans to his friend Jules Castagnary on February 9, 1873.[1] The artist was rightly worried that the French Chamber would decide to seize all his real estate and personal assets to finance the reconstruction of the Vendôme Column. A prominent member of the Paris Commune, Courbet had played a fundamental role in the destruction of that symbol of Napoleonic Rule. Immediately after the event, in 1871, the Versailles War Council had sentenced him to a fine of five hundred francs and six months imprisonment. Subsequently, the new government of the Third Republic wanted to make him financially responsible for the Column’s reconstruction. While Courbet was of the opinion that he could not be punished twice for the same offense, he nevertheless immediately took the necessary precautions to safeguard his property. In another letter to Castagnary, he wrote, “we will be decentralizing and it won’t matter much if I do not live in France.”[2] In the midst of these turbulent months Courbet was making ambitious plans for an exposition complète[3] of his works at the 1873 World Exposition in Vienna. -

Downloaded from Https
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2009 Bibliography of books published in 2008 and of some books published earlier Siehr, Kurt G DOI: https://doi.org/10.1017/s0940739109990257 Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-154546 Journal Article Published Version Originally published at: Siehr, Kurt G (2009). Bibliography of books published in 2008 and of some books published earlier. International Journal of Cultural Property, 16(4):419-445. DOI: https://doi.org/10.1017/s0940739109990257 International Journal of Cultural Property (2009) 16:419–445. Printed in the USA. Copyright © 2009 International Cultural Property Society doi:10.1017/S0940739109990257 BOOK NOTES Bibliography of Books Published in 2008 and of Some Books Published Earlier Kurt G. Siehr* Advisory Committee on the Assessment of Restitution Applications for Items of Cultural Value and the Second World war (ed.). Report 2007. The Hague 2008. 84 pp., colored and black and white illustrations. No ISBN. No price. This is the latest report of the Dutch Restitution Committee. Under the new decree, the recommendations of the committee are binding, and a deadline for a “liberal- ized claim policy” has been set for April 4, 2007. After that date normal rules apply, as do normal statute of limitations. In 2007 there were 31 objects recommended to be granted and 22 objects rejected to be returned. In the report 16 recommendations are reproduced partially recommending the return and sometimes rejecting a return application. -

Deutsche Nationalbibliografie 2013 a 36
Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2013 A 36 Stand: 04. September 2013 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2013 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-ReiheA36_2013-8 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie-