Beiträge Zu Centaurea Cyanus L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tehtid
T.C SELÇUK ÜN İVERS İTES İ FEN B İLİMLER İ ENST İTÜSÜ Tehtid Altındaki Centaurea lycaonica Boiss.& Heldr. (Compositae) Populasyonlarındaki Genetik Çe şitlili ğin Belirlenmesi Üzerine Moleküler Bir Çalı şma EDA ÖZEL YÜKSEK L İSANS TEZ İ BİYOLOJ İ ANAB İLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK ÜN İVERS İTES İ FEN B İLİMLER İ ENST İTÜSÜ Tehtid Altındaki Centaurea lycaonica Boiss.& Heldr. (Compositae) Populasyonlarındaki Genetik Çe şitlili ğin Belirlenmesi Üzerine Moleküler Bir Çalı şma EDA ÖZEL YÜKSEK L İSANS TEZ İ BİYOLOJ İ ANAB İLİM DALI Bu tez 12.08.2008 tarihinde a şağıdaki jüri tarafından oybirli ği ile kabul edilmi ştir. Prof.Dr. Kuddisi ERTU ĞRUL Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Doç. Dr. Hüseyin DURAL (Danı şman) (Üye) (Üye) i ÖZET Yüksek Lisans Tezi Tehtid Altındaki Centaurea lycaonica Boiss.& Heldr. (Compositae) Populasyonlarındaki Genetik Çe şitlili ğin Belirlenmesi Üzerine Moleküler Bir Çalı şma Eda ÖZEL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danı şman: Prof. Dr. Kuddisi ERTU ĞRUL Temmuz 2008, 58 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Kuddisi ERTU ĞRUL Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Doç. Dr. Hüseyin DURAL Ülkemizde Centaurea cinsi içinde oldukça fazla sayıda lokal yayılı ş gösteren ve nesli tehdit altında endemik tür olmasına ra ğmen bu türlerin gen havuzlarının ne derecede genetik çe şitlili ğe sahip oldu ğu hakkında hiçbir bilgi yoktur. Çalı şmanın temel amacı, ilk olarak 1845 yılında Konya civarından ke şfedilen ve şu anda tehlike altında olan C. lycaonica Boiss. & Heldr. türünün populasyon içi genetik çe şitlili ğini moleküler yöntemlerle belirlemektir. Bu çalı şmada, Konya çevresinde yayılı ş gösteren lokal endemik türlerden birisi olan C. -

Asteraceae) Taxa from Turkey
© 2018 The Japan Mendel Society Cytologia 83(3): 317–321 Karyological Investigation on Seven Centaurea L. (Asteraceae) Taxa from Turkey Neslihan Tasar1, Gulden Dogan2* and Yasar Kiran2 1 Munzur University, Tunceli Vocational School, Department of Organic Agriculture, Tunceli, Turkey 2 Firat University, Science Fac., Biology Department, Elazig, Turkey Received March 29, 2018; accepted May 1, 2018 Summary The somatic chromosome numbers and karyotypes were examined in seven species of genus Cen- taurea L. distributed in Turkey. The chromosome numbers were determined as 2n=2x=16 in C. behen L. and C. solstitialis L.; 2n=2x=18 in C. cynarocephala Wagenitz and C. agregata Fisch. & Mey. ex DC. ssp. agregata; 2n=2x=20 in C. iberica Trev. ex Sprengel; 2n=2x=26 in C. balsamita Lam.; 2n=4x=36 in C. virgata Lam. All of the chromosomes had centromeres at median point (M), median region (m), and submedian region (sm). Sat- ellite chromosomes (sat-chromosomes) were observed only in C. virgata. The findings for each of the analyzed taxa are compared each other and with the results of previous studies. Key words Asteraceae, Centaurea, Chromosome number, Karyotype, Turkey. The genus Centaurea L. is a polymorphous genus growing in Turkey (Wagenitz 1975, Wagenitz and Hell- belonging to the tribe Cardueae Cass. of the family wig 1997, Davis et al. 1988, Guner 2000). Asteraceae, and comprises 400–700 species of annual, A close correlation among karyology, pollen morphol- biennial and perennial grasses, rarely dwarf shrubs pre- ogy and systematic in the subtribe Centaureinae have dominantly distributed in Europe and Asia (Dittrich been demonstrated where basic chromosome numbers 1977, Wagenitz and Hellwig 1996, Bancheva and Greil- are considered a key character for sectional classification huber 2006). -

Karyomorphological Features of Turkish Centaurea (Subgenus Cyanus, Asteraceae) Species and Its Taxonomic Importance
Turkish Journal of Botany Turk J Bot (2019) 43: 538-550 http://journals.tubitak.gov.tr/botany/ © TÜBİTAK Research Article doi:10.3906/bot-1811-28 Karyomorphological features of Turkish Centaurea (subgenus Cyanus, Asteraceae) species and its taxonomic importance Emrah ŞİRİN*, Meryem BOZKURT, Tuna UYSAL, Kuddisi ERTUĞRUL Department of Biology, Faculty of Science, Selçuk University, Konya, Turkey Received: 19.11.2018 Accepted/Published Online: 25.02.2019 Final Version: 08.07.2019 Abstract: In this study, the karyomorphology of 20 Turkish Centaurea (subgenus Cyanus) taxa was examined. The number of chromosomes of 11 taxa belonging to the subgenus Cyanus was determined for the first time. As a result of the karyomorphological studies, the number of basic chromosomes was determined to be x = 8, 10, and 12 in annuals and x = 10 and 11 in perennials. The populations are tetraploid in the seven perennial taxa and polyploidy is not rare for this group. On the other hand, all annual taxa are diploid. Considering the asymmetry indices, we can conclude that most taxa have symmetrical karyotypes. The most common karyotype formulas are 40 metacentric chromosomes (m), 20m, and 16m + 4 submetacentric chromosomes, respectively. A satellite was detected in the majority of the taxa, but it was observed to be mainly localized on the short arm of the chromosome. Satellites are located mainly on the second chromosome. Key words: Asymmetry, chromosome counts, endemic, karyomorphology, metacentric 1. Introduction 2012). Cyanus, a subgenus, is represented by approximately Cytotaxonomy is a branch of cytogenetics in which 25 species worldwide (Hellwig, 2004). karyological features are systematically evaluated for According to recent definitions of Centaurea (Susanna evolutionary purposes (Siljak-Yakovlev and Peruzzi, 2012). -
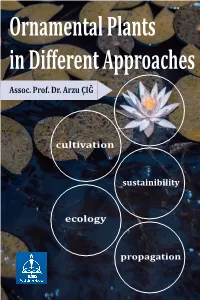
Ornamental Plants in Different Approaches
Ornamental Plants in Different Approaches Assoc. Prof. Dr. Arzu ÇIĞ cultivation sustainibility ecology propagation ORNAMENTAL PLANTS IN DIFFERENT APPROACHES EDITOR Assoc. Prof. Dr. Arzu ÇIĞ AUTHORS Atilla DURSUN Feran AŞUR Husrev MENNAN Görkem ÖRÜK Kazım MAVİ İbrahim ÇELİK Murat Ertuğrul YAZGAN Muhemet Zeki KARİPÇİN Mustafa Ercan ÖZZAMBAK Funda ANKAYA Ramazan MAMMADOV Emrah ZEYBEKOĞLU Şevket ALP Halit KARAGÖZ Arzu ÇIĞ Jovana OSTOJIĆ Bihter Çolak ESETLILI Meltem Yağmur WALLACE Elif BOZDOGAN SERT Murat TURAN Elif AKPINAR KÜLEKÇİ Samim KAYIKÇI Firat PALA Zehra Tugba GUZEL Mirjana LJUBOJEVIĆ Fulya UZUNOĞLU Nazire MİKAİL Selin TEMİZEL Slavica VUKOVIĆ Meral DOĞAN Ali SALMAN İbrahim Halil HATİPOĞLU Dragana ŠUNJKA İsmail Hakkı ÜRÜN Fazilet PARLAKOVA KARAGÖZ Atakan PİRLİ Nihan BAŞ ZEYBEKOĞLU M. Anıl ÖRÜK Copyright © 2020 by iksad publishing house All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic Development and Social Researches Publications® (The Licence Number of Publicator: 2014/31220) TURKEY TR: +90 342 606 06 75 USA: +1 631 685 0 853 E mail: [email protected] www.iksadyayinevi.com It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. Iksad Publications – 2020© ISBN: 978-625-7687-07-2 Cover Design: İbrahim KAYA December / 2020 Ankara / Turkey Size = 16 x 24 cm CONTENTS PREFACE Assoc. Prof. Dr. Arzu ÇIĞ……………………………………………1 CHAPTER 1 DOUBLE FLOWER TRAIT IN ORNAMENTAL PLANTS: FROM HISTORICAL PERSPECTIVE TO MOLECULAR MECHANISMS Prof. -

Centaurea Revisited: a Molecular Survey of the Jacea Group
Annals of Botany 98: 741–753, 2006 doi:10.1093/aob/mcl157, available online at www.aob.oxfordjournals.org Centaurea Revisited: A Molecular Survey of the Jacea Group N. GARCIA-JACAS1,*, T. UYSAL 2, K. ROMASHCHENKO3,V.N.SUA´ REZ-SANTIAGO4, K. ERTUG˘ RUL2 and A. SUSANNA1 1Botanic Institute of Barcelona (CSIC-ICUB), Passeig del Migdia s.n., E-08038 Barcelona, Spain, 2Department of Biology, Faculty of Science and Art, Selcuk University, Konya, Turkey, 3Institute of Botany M. G. Kholodny, Tereshchenkovska 2, 01601 Kiev, Ukraine and 4Department of Botany, Science Faculty, University of Granada, 18071 Granada, Spain Received: 9 December 2005 Returned for revision: 11 April 2006 Accepted: 6 June 2006 Published electronically: 27 July 2006 Background and Aims The genus Centaurea has traditionally been considered to be a complicated taxon. No attempt at phylogenetic reconstruction has been made since recent revisions in circumscription, and previous reconstructions did not include a good representation of species. A new molecular survey is thus needed. Methods Phylogenetic analyses were conducted using sequences of the internal transcribed spacers (ITS) 1 and 2 and the 5.8S gene. Parsimony and Bayesian approaches were used. Key Results A close correlation between geography and the phylogenetic tree based on ITS sequences was found in all the analyses, with three main groups being resolved: (1) comprising the most widely distributed circum- Mediterranean/Eurosiberian sections; (2) the western Mediterranean sections; and (3) the eastern Mediterranean and Irano-Turanian sections. The results show that the sectional classification in current use needs major revision, with many old sections being merged into larger ones. -

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLBAŞI’NA ENDEMİK CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH. & MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Aslı GÜNÖZ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lisans Tezi GÖLBAŞI’NA ENDEMİK CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH.&MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Aslı GÜNÖZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Yeşim OKAY Araştırmada, günümüzde sadece Ankara–Gölbaşı’nda sınırlı bir alanda yaşamakta olan endemik bitki Centaurea tchihatcheffii Fish.&Mey. (Sevgi Çiçeği) tohumlarının çimlenmeleri üzerine; suda bekletme (10 saat ve 24 saat), GA3 çözeltisinde bekletme (10 ppm ve 100 ppm’lik çözeltilerde 24 saat), 3, 4 ve 5 ay süre ile 0 °C’de katlama ortamında bekletme uygulamalarının ve tohum çimlenme ortamındaki farklı pH derecelerinin (6.5 pH, 7.5 pH ve 8.5 pH) etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Ankara-Gölbaşı’ndan 2005 ve 2006 yıllarında toplanan C. tchihatcheffii tohumları kullanılmıştır. GA3 çözeltisinde bekletilen ve 4-5 ay katlamada tutulan tohumlarda çimlenme oranları yüksek bulunmuştur. 8.5 pH derecesindeki ortamlarda ve 2005 yılı tohumlarında çimlenme oranları daha düşük düzeylerde belirlenmiştir. Haziran 2008, 89 sayfa Anahtar Kelimeler: Centaurea tchihatcheffii, tohum, çimlenme, endemik, suda bekletme, GA3, katlama i ABSTRACT Master Thesis RESEARCHES ON SEED GERMINATION OF ENDEMIC CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH.& MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) IN GÖLBAŞI PROVINCE. Aslı GÜNÖZ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Horticulture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim OKAY The research aims to investigate the effect of soaking in water (10 hours and 24 hours), in GA3 solution (10 ppm and 100 ppm concentrations for 24 hours), stratification for 3, 4 and 5 months at 0°C and effect of different pH in seed germination medium (6.5pH, 7.5pH and 8.5pH) on seed germination of endemic plant C. -

Critically Endangered Endemic Centaurea Tchihatcheffii Fisch
African Journal of Agricultural Research Vol. 5(25), pp. 3536-3541, December 2010 Special Review Available online at http://www.academicjournals.org/AJAR DOI: 10.5897/AJAR10.004 ISSN 1991-637X ©2010 Academic Journals Review Critically endangered endemic Centaurea tchihatcheffii Fisch. and Mey. and its propagation possibilities Y. Okay* and K. Demir 1Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ankara University, 06110 Ankara-Turkey. Accepted 9 August, 2010 Centaurea tchihatcheffii Fisch. and Mey., is a critically endangered endemic species, which grows on limited area around Golbasi district of Ankara province. It has attractive pink, red, purple flowers, the colours of which change with maturation. It has a high potential as out door ornamental plant and as cut flower. Its natural habitat is continuously on decrease because of uncontrolled plucking, intense construction activities and urbanization. The most important reason why the generation of the species is endangered is strong anthropogenic pressure. Therefore, the protection of this plant is of great importance. Study of propagation possibilities for the protection of this species, is of primary importance. This paper reviews C. tchihatcheffii, propagation studies. Key words: Critically endangered endemic (CR), propagation, Centaurea tchihatcheffii Fisch. and Mey. INTRODUCTION The floristic richness and diversity of a country gains extinction. Turkish laws ban trade in critically endangered importance with its number of rare and endemic „critically species, however, due to loopholes in the law, the flowers endangered (CR)‟ plant species (Ekim et al., 2000; IUCN, of C. tchihatcheffi are collected for illegal use in cut flower 2001; Vural, 2006). The endemism rate of Anatolia, which industry in the cut flower markets of Ankara. -

Short Communication COMPARISON of the ESSENTIAL OILS OF
Turk J. Pharm. Sci. 10 (2), 313-318, 2013 Short Communication COMPARISON OF THE ESSENTIAL OILS OF DIFFERENT COLORED Centaurea tchihatcheffii FISCH. & MEY. FLOWERS Kemal Hiisnii Can BA§ER ' , Betiil DEMİRCI , Sadık ERİK 1Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, 26470 Eski§ehir, TURKEY 2King Saud University, College of Science, Botany and Microbiology Department, 11451 Riyadh, SAUDI ARABIA Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Biology, Beytepe, Ankara, TURKEY Abstract The potential role of flower color in the yield and composition of essential oil was investigated in the endemic Centaurea tchihatcheffii Fisch.&Mey. (Asteraceae). Essential oils obtained by hydrodistillation from different colored flowers of C. tchihatcheffii were separately analyzed by gas chromatography (GC) and gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS), simultaneously. The main constituent both oils was found as germacrene D (17.6% and 17.4%). The flower color difference was shown not to play a role in essential oil yield and composition. Key words: Asteraceae, Centaurea tchihatcheffii, Essential oil, Germacrene D. Farkh Renkteki Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey. Çiçek Uçucu Yağların Karşılaştinlması Bu çalismada, Asteraceae familyasına ait endemik bir tür olan Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey. türüne ait farkh renkteki çiçek örneklerinin uçucu yağ kimyasal bileşimleri karsilaştırılmistır. Uçucu yağlar su distilasyonu yöntemi He elde edilmiştir. Elde edilen uçucu yağlar gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisi/kütle -

Centaurea Amaena Boiss. & Balansa'nin Autekolojisi Ve
i Yüksek Lisans Tezi Lisans Yüksek T.C. Bayram ATASAGUN B ATASAGUN Bayram ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI CENTAUREA AMAENA BOISS. & BALANSA’NIN AUTEKOLOJİSİ VE KORUMA BİYOLOJİSİ İ YOLOJ Hazırlayan Bayram ATASAGUN İ ANAB Danışman İLİ Prof. Dr. Ahmet AKSOY M DALI 2012 M DALI Yüksek Lisans Tezi Temmuz 2012 KAYSERİ ii i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI CENTAUREA AMAENA BOISS. & BALANSA’NIN AUTEKOLOJİSİ VE KORUMA BİYOLOJİSİ (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Bayram ATASAGUN Danışman Prof. Dr. Ahmet AKSOY Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FBY-11-3678 kodlu proje ile desteklenmiştir. Temmuz 2012 KAYSERİ ii Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim. Bayram ATASAGUN iii “Centaurea amaena Boiss. & Balansa’nın Autekolojisi ve Koruma Biyolojisi” adlı Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Tezi Hazırlayan Danışman Bayram ATASAGUN Prof. Dr. Ahmet AKSOY Biyoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKSOY iv v TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim süresince engin bilgi ve tecrübeleriyle bana yol gösteren, desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen, danışman hocam sayın Prof. Dr. Ahmet AKSOY’a en içten teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım sırasında böceklerin tayininde yardımcı olan Prof. Dr. Aydın TUNÇBİLEK’e, kromozom çalışmaları için Doç. Dr. Esra MARTİN’e, dağılış haritaları için Arş. Gör. Ahmet Emin KARKINLI’ya, toprak analizlerinde yardımcı olan Arş. Gör. Oğuzhan UZUN’a teşekkür ederim. Laboratuvar imkanlarını kullanmama olanak sağlayan önceki danışman hocam Prof. -

Endemik Olan Bazi Türlerin (Centaurea Tchihatcheffii
ENDEMİK OLAN BAZI TÜRLERİN (CENTAUREA TCHIHATCHEFFII, THERMOPSIS TURCICA, LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ve SIDERITIS AMASIACA) MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN ICP-OES ile BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜLŞEN YILDIRIM ŞENYER DANIŞMAN Doç.Dr. LAÇİNE AKSOY KİMYA ANABİLİM DALI EKİM, 2014 Bu tez çalışması 13. FEN. BİL. 31 nolu proje ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDEMİK OLAN BAZI TÜRLERİN (CENTAUREA TCHIHATCHEFFII, THERMOPSIS TURCICA, LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ve SIDERITIS AMASIACA) MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN ICP-OES ile BELİRLENMESİ GÜLŞEN YILDIRIM ŞENYER DANIŞMAN Doç.Dr. LAÇİNE AKSOY KİMYA ANABİLİM DALI EKİM, 2014 TEZ ONAY SAYFASI Gülşen YILDIRIM ŞENYER tarafından hazırlanan “ENDEMİK OLAN BAZI TÜRLERİN (CENTAUREA TCHIHATCHEFFII, THERMOPSIS TURCICA, LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ve SIDERITIS AMASIACA) MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN ICP-OES ile BELİRLENMESİ” adlı tez çalışması lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 14/10/2014 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Doç. Dr. Laçine AKSOY Başkan : Doç. Dr. Meltem DİLEK AKÜ Mühendislik Fakültesi Üye : Doç. Dr. Laçine AKSOY AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Üye : Yrd. Doç. Dr. Ömer HAZMAN AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ........./......../........ tarih -
Assessment of the Extracts of Centaurea Tchihatcheffii Fischer for Anti-Inflammatory and Analgesic Activities in Animal Models
Koca et al Tropical Journal of Pharmaceutical Research, June 2009; 8 (3): 193-200 © Pharmacotherapy Group, Faculty of Pharmacy, University of Benin, Benin City, 300001 Nigeria. All rights reserved . Available online at http://www.tjpr.org Research Article Assessment of the Extracts of Centaurea tchihatcheffii Fischer for Anti-inflammatory and Analgesic Activities in Animal Models Ufuk Koca, Gülnur Toker and Esra Küpeli Akkol * Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Gazi University, Etiler 06330, Ankara, Turkey Abstract Purpose: To evaluate the ethanol extracts of the flowers, leaves, and stems of Centaurea tchihatcheffii Fischer & C.A. Meyer (Asteraceae) for their anti-inflammatory and analgesic activities in male Swiss albino mice. Methods: For the evaluation of anti-inflammatory activity, hind paw oedema was induced in the mice ) with carrageenan and prostaglandin-E2 (PGE 2 and the mice received either 100 and 200 mg/kg body weight doses of the flower extract or 200 mg/kg body weight dose of the leaf and stem extracts. Furthermore, ear oedema was induced in other groups of mice with 12-O-tetradecanoyl-13-acetate (TPA) and then administered with 0.5 mg/ear dose of the extract of either of the three plant parts. In order to evaluate analgesic activity, p-benzoquinone-induced abdominal constriction test was used with 100, 200 and 400 mg/kg body weight doses of the flower or 200mg/kg body weight dose of the leaf and stem extracts administered. Indomethacin and acetylsalicylic acid were the reference drugs for anti- inflamatory and analgesic evaluations, respectively. Phytochemical screening of the flower extract was carried out by thin layer chromatography (TLC). -

Larvicidal Activity of Centaurea Bruguierana Ssp. Belangerana Against Anopheles Stephensi Larvae
Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2011), 10 (4): 829-833 Copyright © 2011 by School of Pharmacy Received: February 2010 Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services Accepted: May 2010 Original Article Larvicidal Activity of Centaurea bruguierana ssp. belangerana Against Anopheles stephensi Larvae Mahnaz Khanavia* , Afsaneh Rajabia, Masoud Behzada, Abbas Hadjiakhoondia, Hassan Vatandoostb and Mohammad Reza Abaeeb aDepartment of Pharmacognosy and Medicinal Plants Research Center, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 14155-6451, Iran. bDepartment of Medical Entomology, School of Public Health and Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Abstract In this study, the total 80% of MeOH extract and also petroleum ether, CHCl3, EtOAc, n-BuOH, and the remaining MeOH fractions obtained by solvent-solvent fractionation of the whole flowering samples ofCentaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mzt. ssp. belangerana (DC.) Bornm. (Asteraceae), namely “Baad-Avard”, collected from Borazjan in Bushehr Province (Bushehr, Iran) were investigated for larvicidal activity against malaria vector, Anopheles stephensi Liston, according to WHO methods. The mortality rate of total extract and petroleum ether fraction in concentration of 40 ppm were 28% and 86% respectively and the other fractions were inactive. The probit regression analysis for the dose-response to petroleum ether fraction treatment of larvae exhibited the LC50 and LC90 values of 15.7 ppm and 48.3 ppm, respectively. As results showed, the larvicidal activity of the petroleum ether fraction would be due to the nonpolar compounds in the plant which further isolation and purification would obtain the more active compounds in lower concentrations useful for preparation of biological insecticides.