Die Turmgräber Von Palmyra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Read the Full PDF
en Books published to date in the continuing series o .:: -m -I J> SOVIET ADVANCES IN THE MIDDLE EAST, George Lenczowski, 1971. 176 C pages, $4.00 ;; Explores and analyzes recent Soviet policies in the Middle East in terms of their historical background, ideological foundations and pragmatic application in the 2 political, economic and military sectors. n PRIVATE ENTERPRISE AND SOCIALISM IN THE MIDDLE EAST, Howard S. Ellis, m 1970. 123 pages, $3.00 en Summarizes recent economic developments in the Middle East. Discusses the 2- significance of Soviet economic relations with countries in the area and suggests new approaches for American economic assistance. -I :::I: TRADE PATTERNS IN THE MIDDLE EAST, Lee E. Preston in association with m Karim A. Nashashibi, 1970. 93 pages, $3.00 3: Analyzes trade flows within the Middle East and between that area and other areas of the world. Describes special trade relationships between individual -C Middle Eastern countries and certain others, such as Lebanon-France, U.S .S.R. C Egypt, and U.S.-Israel. r m THE DILEMMA OF ISRAEL, Harry B. Ellis, 1970. 107 pages, $3.00 m Traces the history of modern Israel. Analyzes Israel 's internal political, eco J> nomic, and social structure and its relationships with the Arabs, the United en Nations, and the United States. -I JERUSALEM: KEYSTONE OF AN ARAB-ISRAELI SETTLEMENT, Richard H. Pfaff, 1969. 54 pages, $2.00 Suggests and analyzes seven policy choices for the United States. Discusses the religious significance of Jerusalem to Christians, Jews, and Moslems, and points out the cultural gulf between the Arabs of the Old City and the Western r oriented Israelis of West Jerusalem. -

Melammu: the Ancient World in an Age of Globalization Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge
Melammu: The Ancient World in an Age of Globalization Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge Series Editors Ian T. Baldwin, Jürgen Renn, Dagmar Schäfer, Robert Schlögl, Bernard F. Schutz Edition Open Access Development Team Lindy Divarci, Nina Ruge, Matthias Schemmel, Kai Surendorf Scientific Board Markus Antonietti, Antonio Becchi, Fabio Bevilacqua, William G. Boltz, Jens Braarvik, Horst Bredekamp, Jed Z. Buchwald, Olivier Darrigol, Thomas Duve, Mike Edmunds, Fynn Ole Engler, Robert K. Englund, Mordechai Feingold, Rivka Feldhay, Gideon Freudenthal, Paolo Galluzzi, Kostas Gavroglu, Mark Geller, Domenico Giulini, Günther Görz, Gerd Graßhoff, James Hough, Man- fred Laubichler, Glenn Most, Klaus Müllen, Pier Daniele Napolitani, Alessandro Nova, Hermann Parzinger, Dan Potts, Sabine Schmidtke, Circe Silva da Silva, Ana Simões, Dieter Stein, Richard Stephenson, Mark Stitt, Noel M. Swerdlow, Liba Taub, Martin Vingron, Scott Walter, Norton Wise, Gerhard Wolf, Rüdiger Wolfrum, Gereon Wolters, Zhang Baichun Proceedings 7 Edition Open Access 2014 Melammu The Ancient World in an Age of Globalization Edited by Markham J. Geller (with the cooperation of Sergei Ignatov and Theodor Lekov) Edition Open Access 2014 Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge Proceedings 7 Proceedings of the Sixth Symposium of the Melammu Project, held in Sophia, Bulgaria, September 1–3, 2008. Communicated by: Jens Braarvig Edited by: Markham J. Geller Editorial Team: Lindy Divarci, Beatrice Hermann, Linda Jauch -

Pointed Arch and Ablaq Alessandro Camiz
Key Engineering Materials Vol. 628 (2015) pp 9-14 © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.628.9 Morphology of Roman, Islamic and Medieval seismic design: pointed arch and ablaq Alessandro Camiz * * Laboratorio di Lettura e Progetto dell’Architettura Dipartimento di Architettura e Progetto “Sapienza” Università di Roma Via Antonio Gramsci 53, 00197, Rome Italy [email protected] Keywords: Urban morphology, architecture, seismic design, Islamic, typology, middle ages Abstract. In ancient written sources earthquakes were mostly interpreted as a divine punishment for human sins, only few authors instead interpreted the seismic event as a phenomenon independent from human actions. Considering the built architectures as material documents, several examples can be found, suggesting that there was an empyrical knowledge of the consequences of earthquakes on buildings. Modern literature on the topic, mostly within engineering studies, lacking an historical approach, assumes that in ancient times science ignored the physical nature of seismic events and consequently declares that architects couldn’t consider dynamics in their projects. The close examination of some examples shows clearly that Roman, Islamic and Medieval architects had an empirical knowledge of dynamics, probably based on post-seismic reconstruction. This knowledge developed through history, so it is possible to outline a history of seismic design way before the Lisbon earthquake (1775), considered by many authors as the beginning of the history of seismic design. Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh. Psalms, 60, 2 Seismic design and ancient material culture The cultural evolution of earthquake knowledge since ancient times reveals an interesting double track: on one hand the religious culture and on the other the scientific and material culture. -

The Euphrates in Crisis: Channels of Cooperation for Channels of Cooperation the Euphratesa Threatened in Crisis: River Research Paper M
The Euphrates in Crisis:The Euphrates a Channels of Cooperation for Research Paper M. Nouar Shamout with Glada Lahn Energy, Environment and Resources | April 2015 The Euphrates in Crisis Threatened River Threatened Channels of Cooperation for a Threatened River M. Nouar Shamout withM. Nouar Glada Lahn Chatham House Contents Summary 2 Introduction 7 The Euphrates’ Characteristics and Infrastructure 10 What is Happening to the Euphrates? 19 Shared Future Challenges 21 The Way Forward 26 Conclusion 35 Appendix A: Indicators and Methodology 37 Appendix B: The History of Interstate Negotiations 39 Over the Euphrates River About the Authors 42 Acknowledgments 43 1 | Chatham House The Euphrates in Crisis: Channels of Cooperation for a Threatened River Summary The Euphrates River is of critical importance for water, food and energy security in Turkey, Syria and Iraq. Flowing south-east for 2,700 kilometres from eastern Turkey to the Persian Gulf, it supports over 60 million people and – along with the Tigris, with which it runs almost in parallel – has a rich history of sustaining civilization on the Mesopotamian plains. This vast water resource is in crisis. Degradation of the river from over-exploitation, population growth, pollution and other factors has been a serious problem for many years. Now war and violent upheaval in Syria and Iraq are worsening the situation: threatening key infrastructure and preventing policy cooperation. Without urgent attention, stresses on the river’s resources will add to the already catastrophic humanitarian crisis created by the conflict. In the longer term, a vision for cross-border coordination is essential if the river is to retain its vital role in the region. -
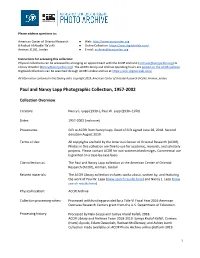
Paul and Nancy Lapp Collection Finding
Please address questions to: American Center of Oriental Research ● Web: http://www.acorjordan.org 8 Rashad Al Abadle Tla’a Ali ● Online Collection: https://acor.digitalrelab.com/ Amman 11181, Jordan ● E-mail: [email protected] Instructions for accessing this collection: Physical collections can be accessed by arranging an appointment with the ACOR Archivist ([email protected]) or Library Director ([email protected]). The ACOR Library and Archive operating hours are posted on the ACOR website. Digitized collections can be searched through ACOR’s online archive at https://acor.digitalrelab.com/. All information contained in this finding aid is Copyright 2019, American Center of Oriental Research (ACOR), Amman, Jordan. Paul and Nancy Lapp Photographic Collection, 1957-2002 Collection Overview Creators: Nancy L. Lapp (1930-), Paul W. Lapp (1930–1970) Dates: 1957-2002 (inclusive) Provenance: Gift to ACOR from Nancy Lapp. Deed of Gift signed June 28, 2018. Second donation August 2019. Terms of Use: All copyrights are held by the American Center of Oriental Research (ACOR). Photos in this collection are free to use for academic, research, and scholarly projects. Please contact ACOR for non-watermarked images. Commercial use is granted on a case-by-case basis. Cite collection as: The Paul and Nancy Lapp collection at the American Center of Oriental Research (ACOR), Amman, Jordan Related materials: The ACOR Library collection includes works about, written by, and featuring the work of Paul W. Lapp (View search results here) and Nancy L. Lapp (View search results here) Physical location: ACOR Archive Collection processing notes: Processed with funding provided by a Title VI Fiscal Year 2016 American Overseas Research Centers grant from the U.S. -

Que Nous Apprennent Les Textes De Mari Sur L'oronte ?
Syria Archéologie, art et histoire IV | 2016 Le fleuve rebelle Que nous apprennent les textes de Mari sur l’Oronte ? Bertrand Lafont Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/syria/4809 DOI : 10.4000/syria.4809 ISSN : 2076-8435 Éditeur IFPO - Institut français du Proche-Orient Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2016 Pagination : 29-87 ISBN : 978-2-35159-725-5 ISSN : 0039-7946 Référence électronique Bertrand Lafont, « Que nous apprennent les textes de Mari sur l’Oronte ? », Syria [En ligne], IV | 2016, mis en ligne le 01 décembre 2018, consulté le 07 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/ syria/4809 ; DOI : https://doi.org/10.4000/syria.4809 © Presses IFPO QUE NOUS APPRENNENT LES TEXTES DE MARI SUR L’ORONTE ? Bertrand LAFONT Résumé – Entre l’époque des archives d’Ebla et celle d’Al-Amarna, il s’écoule presque un millénaire entier (ca 2400-1400 av. J.-C.), durant lequel la documentation écrite est pratiquement absente des régions de Syrie centrale et occidentale. Au XVIIIe s. av. J.-C., les archives de Mari sont donc quasiment les seules à procurer, pour quelques dizaines d’années, des informations sur les régions situées entre Euphrate et Méditerranée, avec lesquelles le royaume de Mari a entretenu des relations à l’époque de ses derniers souverains. Il est question dans cette communication de la place importante occupée par les capitales rivales qu’étaient alors Alep et Qaṭna, du statut qui était à cette époque celui de la vallée de l’Oronte et du rôle joué par les ports maritimes de Byblos et d’Ugarit. -

Agnes Henning, Die Turmgräber Von Palmyra. Eine Lokale Bauform Im Kaiserzeitlichen Syrien Als Aus- Druck Kultureller Identität
Rom und die Provinzen 417 Agnes Henning, Die Turmgräber von Palmyra. Eine lokale Bauform im kaiserzeitlichen Syrien als Aus- druck kultureller Identität. Orient-Archäologie, Band .Publisher Marie Leidorf, Rahden . pages, illustrations, plates, several plans, foldout plans. This book offers asomewhat enlarged version of a doctoral thesis passed in at the University of Co- logne under the supervision of Hennervon Hesberg. The author could use the new topographical survey of the site now published by Klaus Schnädelbach (Topo- graphia Palmyrena .Topography. Documentsd’ar- chéologie syrienne [Damascus ]) and the photogrammetrical documentationofsome tombs by ateam of the Technical University Berlin. The necropolis of Palmyra, or rather four separate cemeteries surroundingthe ancient city, is certainly the biggest remaining necropolis of the Near East ex- cludingEgypt. Among the varieties of tombs found in Palmyra, the towers are the most conspicuousinthe modern landscape and unique in the region. The view of the Valley of Tombs (Wadi al-Qubur), the best- preserved part of the necropolis, is dominatedby towers and has struck all visitors, from the early mod- ern travelers to the tourists flocking Palmyra until a 418 Besprechungen few years ago. In spite of havingbeen freely accessible in real life rather than ablessed afterlife (Le repas des through centuries, an astonishing number of towers morts et le »banquet funèbre« àPalmyre. Ann. arch. are still standing to aconsiderable height, and their arabes syriennes. Rev. d’arch. et d’hist. , , – = decoration, whenever present, is well preserved. All Scripta varia [Paris ] –]). For the first time a graves,however, have been opened and emptied by collection of sculptural fragments recovered from the generations of robbers,while the portraits of the de- Elahbel tower tomb is published in this book (pp. -
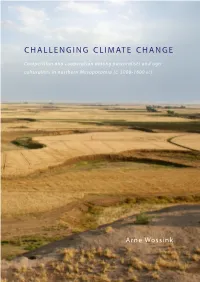
Challenging Climate Change
Wossink CHALLENGING C L I M AT E CHANGE CHALLENGING C L I M AT E CHANGE Competition and cooperation among pastoralists and agri- Throughout history, climate change has been an important driving force culturalists in northern Mesopotamia (c. 3000-1600 BC) behind human behaviour. This archaeological study seeks to understand the complex interrelations between that behaviour and climatic fluctu- ations, focussing on how climate affected the social relations between neighbouring communities of occasionally differing nature. It is argued CHALLENGING that developments in these relations will fall within a continuum between competition on one end and cooperation on the other. The adoption of a particular strategy depends on whether that strategy is advantageous to a community in terms of the maintenance of its well-being when faced with adverse climate change. This model will be applied to northern Mesopotamia between 3000 and 1600 BC. Local palaeoclimate proxy records demonstrate that aridity in- C L I M AT E creased significantly during this period. Within this geographical, chrono- logical, and climatic framework, this study looks at changes in settlement patterns as an indication of competition among sedentary agriculturalist communities, and the development of the Amorite ethnic identity as re- flecting cooperation among sedentary and more mobile pastoralist com- CHANGE munities. ISBN 978-90-8890-031-0 Sidestone Press Sidestone Arne Wossink ISBN: 978-90-8890-031-0 Bestelnummer: SSP52410001 69380780 9 789088 900310 Challenging climate change Competition and cooperation among pastoralists and agriculturalists in northern Mesopotamia (c. 3000-1600 BC) Arne Wossink Sidestone Press This publication is a result of the project Settling the steppe. -

Estudio Y Caracterización De Construcciones Bizantinas En Siria
Entre arqueología y arquitectura: estudio y caracterización de construcciones bizantinas en Siria Camilla Mileto, Fernando Vegas, Valentina Cristini, Soledad García Sáez Universitat Politécnica de Valéncia, Valencia, Spain página siguiente Abstract Fig. 7 A team of architects and experts from Universitat Politècnica de València, Spain Acceso a una de las tumbas estudiadas en has characterized and documented a couple of archaeological sites of Byzanti- Tall as-Sinn (autores) ne origin in Syria, settled along the river Euphrates, known as the cities of Tall as-Sinn and Halabiye. The text figures out the surveys carried out from 2005 to 2010, the objectives and the methodology used and some results achieved du- ring the years in spite of the recent civil war. La razón de 5 años de campañas arqueológicas en Siria La República Árabe Siria está situada en el extremo oriental del Mediterrá- neo, en la región que hoy conocemos como Próximo Oriente. Su posición estratégica con respecto a las rutas comerciales que comunicaban Asia y Europa hizo de este territorio un lugar de encuentro de las más importan- tes culturas de la Antigüedad. Sumerios, asirios, babilonios, fenicios, ara- meos, persas, romanos… dejaron sus huellas en lo que hoy es la actual Siria. Desde 2005 hasta 2010 la Universitat Politècnica de València, y concre- tamente el Instituto de Restauración del Patrimonio, bajo la dirección de Fernando Vegas y Camilla Mileto, ha sido colaboradora activa de distintas campañas de excavación y estudios arqueológicos en conjunto con entida- des sirias, bajo el liderazgo de la Universidad de la Coruña (Juan Luis Mon- tero Fenollós) y de la Université Paul Valéry de Montpellier (Sylvie Blétry). -
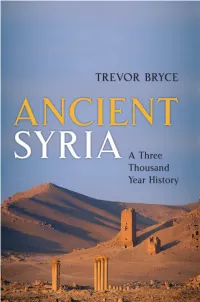
Ancient Syria: a Three Thousand Year History
OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 11/20/2013, SPi ANCIENT SYRIA OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 11/20/2013, SPi OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 11/20/2013, SPi ANCIENT SYRIA a three thousand year history TREVOR BRYCE 1 OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 11/20/2013, SPi 3 Great Clarendon Street, Oxford, ox2 6dp, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries © Trevor Bryce 2014 The moral rights of the author have been asserted First Edition published in 2014 Impression: 1 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer. Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Control Number: 2013942192 ISBN 978–0–19–964667–8 Printed in Italy by L.E.G.O. -

Roma Imparatorluğu'nun Iii. Yüzyil Krizine Etki Eden
T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ROMA İMPARATORLUĞU’NUN III. YÜZYIL KRİZİNE ETKİ EDEN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER Yüksek Lisans Tezi Ismat ABBAS Danışman: Doç. Dr. Özlem GENÇ Samsun, 2019 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ROMA İMPARATORLUĞU’NUN III. YÜZYIL KRİZİNE ETKİ EDEN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER Yüksek Lisans Tezi Ismat ABBAS Danışman: Doç. Dr. Özlem GENÇ Samsun, 2019 BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırladığım Yüksek Lisans Tezinin bütün aşamalarında bilimsel etiğe ve akademik kurallara riayet ettiğimi, çalışmada doğrudan veya dolaylı olarak kullandığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, yazımda enstitü yazım kılavuzuna uygun davranıldığını taahhüt ederim. … /… / 2019 İsmat ABBAS i TEZ KABUL VE ONAYI Ismat ABBAS tarafından hazırlanan “ROMA İMPARATORLUĞU’NUN III. YÜZYIL KRİZİNE ETKİ EDEN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER” başlıklı bu çalışma, ../../…. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oy birliğiyle/oy çokluğuyla başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi/Sanatta Yeterlik Çalışması olarak kabul edilmiştir. İmza Başkan: Üye: Üye: Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. / / Enstitü Müdürü (İmza ve Mühür) ii ÖZET ROMA İMPARATORLUĞU’NUNIII. YÜZYIL KRİZİNE ETKİ EDEN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER Ismat ABBAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalı, Yüksek Lisans, Haziran 2019 Danışman: Doç.Dr. Özlem GENÇ Roma’da üçüncü yüzyıl krizi imparator Alexander Severus’un 235’te kendi askerleri tarafından öldürülmesi ile başlayan, 284 yılında Diocletianus’un tahta çıkması ile sona eren karmaşık bir dönemdir. Bu dönemde imparatorluk işgal, iç savaş, veba ve ekonomik çöküntü baskısıyla neredeyse çökme aşamasına gelmiştir. -

Wesentlichen Sehenswürdigkeiten
Syrien Tipps 2008 – www.mobiltom.de/syria Syrien Tipps 2008 – www.mobiltom.de/syria Damascus 1. Wenn ihr in Städte fahrt dann am besten zwischen 18 und 19 Uhr, da sind alle zum Gebet. Das Café Noufara, ein altes Teehaus hinter der Umayydenmoschee, in dem ein Geschichtenerzähler 2. Abends wird es in den größeren Städten bis 22 Uhr noch mal sehr geschäftig. Geschichten aus Tausend und einer Nacht erzählt. 3. Kein Leitungswasser, keine Eiswürfel, kein ungeschältes Obst! Haupt-Bazar Suq al-Hamediyeh zur Omayyaden-Moschee, im 8. Jh. auf dem Heiligen Bezirk des Jupiter- 4. Mindestens 3 besser 4 Wochen vor Abreise gegen Diphterie und Cholera impfen. Tempels und der christlichen Täuferbasilika erbaut. 5. Das National Payment Netz, an dem fast alle Banken & Geldautomaten angeschlossen sind, gibt weder EC- noch Mastercards Geld. Wenige ATMs hängen an einem anderen Netz und helfen Damascus-Khadem Betriebswerk, 6 Km südlich weiter. wo sich die Ausbesserungshallen der syrischen Bahnhof Damaskus-Kanawat : Built in 1917. Der 6. Zur Orientierung am besten ein kartenfähiges Garmin GPS mitnehmen und unsere Hedjazbahn (CFH) befinden. Bahnhof in der Stadt ist noch für Jahre gleislos, da Koordinatensammlung nutzen. die Strecke unterirdisch verlegt werden soll. 7. 6km südlich vom Stadtzentrum von Damascus ist der Bahnhof Khadam. Dahinter liegt das „Die Werkstätten sind wohl die sehenswertesten im Museum/Bahnbetriebswerk der Hedjaz-Bahn. Museum hat Mo-So 10-14 Uhr auf. Dampfzüge Mittleren Osten, mit einer unglaublichen Sammlung die berühmten Basare, wie den Soukh al- fahren nur noch in seltenen Ausnahmefällen (Gruppenreservierungen). von abgestellten Dampflokomotiven und alten, Hamidiyeh, Soup Midhat Basha in der langen Straße, 8.