Autogame Epipactis-Arten in Nordhessen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Review Article Conservation Status of the Family Orchidaceae in Spain Based on European, National, and Regional Catalogues of Protected Species
Hind ile Scientific Volume 2018, Article ID 7958689, 18 pages https://doi.org/10.1155/2018/7958689 Hindawi Review Article Conservation Status of the Family Orchidaceae in Spain Based on European, National, and Regional Catalogues of Protected Species Daniel de la Torre Llorente© Biotechnology-Plant Biology Department, Higher Technical School of Agronomic, Food and Biosystems Engineering, Universidad Politecnica de Madrid, 28140 Madrid, Spain Correspondence should be addressed to Daniel de la Torre Llorente; [email protected] Received 22 June 2017; Accepted 28 December 2017; Published 30 January 2018 Academic Editor: Antonio Amorim Copyright © 2018 Daniel de la Torre Llorente. Tis is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Tis report reviews the European, National, and Regional catalogues of protected species, focusing specifcally on the Orchidaceae family to determine which species seem to be well-protected and where they are protected. Moreover, this examination highlights which species appear to be underprotected and therefore need to be included in some catalogues of protection or be catalogued under some category of protection. Te national and regional catalogues that should be implemented are shown, as well as what species should be included within them. Tis report should be a helpful guideline for environmental policies about orchids conservation in Spain, at least at the regional and national level. Around 76% of the Spanish orchid fora are listed with any fgure of protection or included in any red list, either nationally (about 12-17%) or regionally (72%). -

Actes Du 15E Colloque Sur Les Orchidées De La Société Française D’Orchidophilie
Cah. Soc. Fr. Orch., n° 7 (2010) – Actes 15e colloque de la Société Française d’Orchidophilie, Montpellier Actes du 15e colloque sur les Orchidées de la Société Française d’Orchidophilie du 30 mai au 1er juin 2009 Montpellier, Le Corum Comité d’organisation : Daniel Prat, Francis Dabonneville, Philippe Feldmann, Michel Nicole, Aline Raynal-Roques, Marc-Andre Selosse, Bertrand Schatz Coordinateurs des Actes Daniel Prat & Bertrand Schatz Affiche du Colloque : Conception : Francis Dabonneville Photographies de Francis Dabonneville & Bertrand Schatz Cahiers de la Société Française d’Orchidophilie, N° 7, Actes du 15e Colloque sur les orchidées de la Société Française d’Orchidophilie. ISSN 0750-0386 © SFO, Paris, 2010 Certificat d’inscription à la commission paritaire N° 55828 ISBN 978-2-905734-17-4 Actes du 15e colloque sur les Orchidées de la Société Française d’Orchidophilie, D. Prat et B. Schatz, Coordinateurs, SFO, Paris, 2010, 236 p. Société Française d’Orchidophilie 17 Quai de la Seine, 75019 Paris Cah. Soc. Fr. Orch., n° 7 (2010) – Actes 15e colloque de la Société Française d’Orchidophilie, Montpellier Préface Ce 15e colloque marque le 40e anniversaire de notre société, celle-ci ayant vu le jour en 1969. Notre dernier colloque se tenait il y a 10 ans à Paris en 1999, 10 ans c’est long, 10 ans c’est très loin. Il fallait que la SFO renoue avec cette traditionnelle organisation de colloques, manifestation qui a contribué à lui accorder la place prépondérante qu’elle occupe au sein des orchidophiles français et de la communauté scientifique. C’est chose faite aujourd’hui. Nombreux sont les thèmes qui font l’objet de communications par des intervenants dont les compétences dans le domaine de l’orchidologie ne sont plus à prouver. -

Die Gattung Epipactis Und Ihre Systematische Stellung Innnerhalb Der Unterfamilie Neottioideae, Im Lichte Enhvickiungsgeschichtli- Eher Untersuchungen
Jber. natnrwiss. Ver Wuppertal 51 43 - 100 Wuppertal, 15.9.1998 Die Gattung Epipactis und ihre systematische Stellung innnerhalb der Unterfamilie Neottioideae, im Lichte enhvickiungsgeschichtli- eher Untersuchungen. Kar1 Robatsch Mit Zeichnungen von L. FREIDINGER und C. A. MRKVICKA Zusammenfassung: Die systematische Stellung der Gattung Epipactis in der Subtribus Cephalantherinae wie auch die Stel- lung dieser Subtribus innerhalb der Unterfamilie Neottioideae wird an Beispielen enhvickungsgeschicht- licher Untersuchungen diskutiert. Nach den neuesten molekularen Daten, die aus DNA-Sequenzanalysen gewonnen wurden, ist ein Stammbaum erstellt worden, in dem die Neottioideae in die "epidendroids" eingereiht wurden. Das steht im Widerspruch zu dem in unserer Arbeit praktizierten Klassifikations- System, das in "Die Orcliideen" R. SCHLECHTER in der Bearbeitung von F. BMEGER und K. SENGHAS venvendet wird. Die Ableitung einer Orchideenblüte aus dem Liliiflorae-Erbe ermögliclit eine Differentialdiagnose zwi- schen den Orchidaceae und den Apostasiaceae. Die Apostasiaceae, die viele Autoren als Unterfamilie Apostasioideae zu den Orchidaceae stellen, werden durch vergleichende Blütenanalysen von dieser Familie abgetrennt. Der Entwickiungstendenz des Gynoeceums der Orchideen, durch die es zum Auf- bau eines Rostellums mit seinen Organen kommt, steht die Reduktionstendenz des Gynoeceums der Apostasiaceae, durch die es zu einer Verminderung des ursprünglich trimeren Stigmas kommt, gegen- über. Die Autogamie der Gattung Epipactis (Sektion Epipactis) -
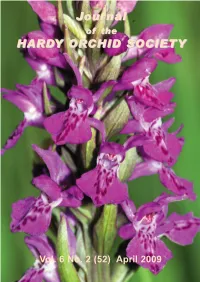
Click to View .Pdf of This Issue
JJoouurrnnaall of the HHAARRDDYY OORRCCHHIIDD SSOOCCIIEETTYY Vol. 6 No. 2 (52) April 2009 JOURNAL of the HARDY ORCHID SOCIETY Vol. 6 No. 2 (52) April 2009 The Hardy Orchid Society Our aim is to promote interest in the study of Native European Orchids and those from similar temperate climates throughout the world. We cover such varied aspects as field study, cultivation and propagation, photography, taxonomy and systematics, and practical conservation. We welcome articles relating to any of these subjects, which will be considered for publication by the editorial committee. Please send your submissions to the Editor, and please structure your text according to the “Advice to Authors” (see website, January 2004 Journal, Members’ Handbook or contact the Editor). Views expressed in journal articles are those of their author(s) and may not reflect those of HOS. The Hardy Orchid Society Committee President: Prof. Richard Bateman, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens Kew, Richmond, Surrey, TW9 3DS Chairman & Field Meeting Co-ordinator: David Hughes, Linmoor Cottage, Highwood, Ringwood, Hants., BH24 3LE [email protected] Vice-Chairman: Celia Wright, The Windmill, Vennington, Westbury, Shrewsbury, Shropshire, SY5 9RG [email protected] Secretary (Acting): Alan Leck, 61 Fraser Close, Deeping St. James, Peterborough, PE6 8QL [email protected] Treasurer: Iain Wright, The Windmill, Vennington, Westbury, Shrewsbury, Shropshire, SY5 9RG [email protected] Membership Secretary: Celia Wright, The Windmill, Vennington, Westbury, -

Biogeographic History and Mating System of Rhodendron Ferrugineum in the French Pyrenees Olivia Charrier
Biogeographic history and mating system of Rhodendron ferrugineum in the French Pyrenees Olivia Charrier To cite this version: Olivia Charrier. Biogeographic history and mating system of Rhodendron ferrugineum in the French Pyrenees. Global Changes. INSA de Toulouse, 2014. English. NNT : 2014ISAT0034. tel-01204667 HAL Id: tel-01204667 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01204667 Submitted on 24 Sep 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 5)µ4& &OWVFEFMPCUFOUJPOEV %0$503"5%&-6/*7&34*5²%&506-064& %ÏMJWSÏQBS Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA de Toulouse) 1SÏTFOUÏFFUTPVUFOVFQBS Olivia Charrier -F 3 Octobre 2014 5Jtre : Histoire biogéographique et système de reproduction de Rhododendron ferrugineum dans les Pyrénées ED SEVAB : Écologie, biodiversité et évolution 6OJUÏEFSFDIFSDIF Laboratoire EDB (Evolution et Diversité Biologique) %JSFDUFVS T EFʾÒTF Dr Nathalie Escaravage et Dr André Pornon 3BQQPSUFVST M. Bertrand Schatz (DR CNRS Montpellier) Rapporteur M. Denis Michez (MCF UMH Mons - Belgique) Rapporteur "VUSF T NFNCSF T EVKVSZ Mme Myriam Gaudeul (MCF Museum Paris) Examinatrice Mme Sergine Ponsard (PR. UT3 Paul Sabatier) Présidente du jury Mme Nathalie Escaravage (MCF UT3 Paul Sabatier) Directrice de thèse REMERCIEMENTS -------------- Faire une thèse c’est un peu comme emprunter une route sinueuse de montagne, avec ses virages, ses cols à gravir et sa météo changeante. -

THE IRISH RED DATA BOOK 1 Vascular Plants
THE IRISH RED DATA BOOK 1 Vascular Plants T.G.F.Curtis & H.N. McGough Wildlife Service Ireland DUBLIN PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE 1988 ISBN 0 7076 0032 4 This version of the Red Data Book was scanned from the original book. The original book is A5-format, with 168 pages. Some changes have been made as follows: NOMENCLATURE has been updated, with the name used in the 1988 edition in brackets. Irish Names and family names have also been added. STATUS: There have been three Flora Protection Orders (1980, 1987, 1999) to date. If a species is currently protected (i.e. 1999) this is stated as PROTECTED, if it was previously protected, the year(s) of the relevant orders are given. IUCN categories have been updated as follows: EN to CR, V to EN, R to V. The original (1988) rating is given in brackets thus: “CR (EN)”. This takes account of the fact that a rare plant is not necessarily threatened. The European IUCN rating was given in the original book, here it is changed to the UK IUCN category as given in the 2005 Red Data Book listing. MAPS and APPENDIX have not been reproduced here. ACKNOWLEDGEMENTS We are most grateful to the following for their help in the preparation of the Irish Red Data Book:- Christine Leon, CMC, Kew for writing the Preface to this Red Data Book and for helpful discussions on the European aspects of rare plant conservation; Edwin Wymer, who designed the cover and who, as part of his contract duties in the Wildlife Service, organised the computer applications to the data in an efficient and thorough manner. -

BSBI News 120
BSBI News April 2012 No. 120 Edited by Trevor James & Gwynn Ellis ISSN 0309-930X Epipactis dunensis under pines in National Trust woodland, Sefton Coast. Photo P.H. Smith © 2008 (see p. 6) Chris Boon, v.c. recorder for Bedfordshire, signing copies of his ‘Flora’ on 4.12.2011, with Floral reversion in Sambucus nigra, Newbridge Alan Outen, contributor on Bryophytes. Demesne, Co. Dublin. Photo T.J.J. Photo L. Farrell © 2011 McCloughlin © 2011 (see p. 45) Fig. 1: Ophrys apifera var. badensis, Mendip Fig. 2: Ophrys apifera var. friburgensis Hills (v.c.6), 20 June 2008 Freyhold (syn. O. apifera var. botteronii), Mendip Hills (v.c.6), 2 July 2009 Fig. 3: Ophrys apifera var. friburgensis Fig. 4: Ophrys apifera var. saraepontana, Freyhold (syn. O. apifera var. botteronii), Mendip Hills (v.c.6), 28 June 2008 Mendip Hills (v.c.6), 3 July 2011 Fig. 5: Ophrys apifera ssp. jurana Ruppert, Fig. 6: Ophrys apifera var. badensis, near Mendip Hills (v.c.6), 19 June 2011 Portishead (v.c.6), 11 June 2007 Photos 1, 4, 5, 6 © R. Mielcarek; photos 2, 3 © S. Mackie (see page 48) Arachis hypogaea – whole plant Arachis hypogaea – showing descending Arachis hypogaea – showing developed peduncles ‘Peanut’ on exhumed peduncle All Arachis hypogaea photos taken at Porlock Street, Southwark, by G. Hounsome © 2006 (see p. 57) CONTENTS Important Notices Small Project Grant Reports From The President.....................I. Bonner 2 Using BSBI data for plant distribution BSBI AGM – Corporate Structure change studies: what influences plant ................................................I. Bonner 2 distribution changes and what changes Notes from the EditorsT. -

Flora Montiberica 74 (VII-2019) ISSN 1138-5952 – Eissn 1988-799X
FLORA MONTIBERICA Publicación periódica especializada en trabajos sobre la flora del Sistema Ibérico Vol. 74 Valencia, VII-2019 FLORA MONTIBERICA Publicación independiente sobre temas relacionados con la flora y la vegetación (plantas vasculares) de la Península Ibérica, especialmente de la Cordillera Ibérica y tierras vecinas. Fundada en diciembre de 1995, se publican tres volúmenes al año con una periodicidad cuatrimestral. Editor y redactor general: Gonzalo Mateo Sanz. Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/ Quart, 80. E-46008 Valencia. C.e.: [email protected] Redactor adjunto: Javier Fabado Alós (Jardín Botánico, Universidad de Valencia) Redactor página web y editor adjunto: José Luis Benito Alonso (Jolube Consultor Botánico y Editor, Jaca. www.jolube.es). Edición en Internet: www.floramontiberica.org, donde están las normas de publicación. Flora Montiberica.org es la primera revista de botánica en español que ofrece de forma gratuita todos sus contenidos a través de la red. Consejo editorial: Antoni Aguilella Palasí (Universidad de Valencia) Juan A. Alejandre Sáenz (Herbarium Alejandre, Vitoria) Vicente J. Arán Redó (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid) Manuel Benito Crespo Villalba (Universidad de Alicante) Fermín del Egido Mazuelas (Universidad de León) José María de Jaime Lorén (Universidad Cardenal Herrera−CEU, Moncada) Emilio Laguna Lumbreras (Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de la Comunidad Valenciana) M. Felisa Puche Pinazo (Universidad de Valencia) Editan: Flora Montiberica (Valencia) y Jolube Consultor Botánico y Editor (Jaca) ISSN papel: 1138–5952 — ISSN edición internet: 1988–799X Depósito Legal: V-5097-1995 Impreso en España por Quares Los contenidos de Flora Montiberica están indexados en: Desde 2014 los contenidos de Flora Montiberica están indexados en base de datos de resúmenes Scopus de la editorial Elsevier. -

JHOS October 2010.Qxp
JJourournalnal of the HARDHARDYY ORORCHIDCHID SOCIETYSOCIETY Vol. 7 No. 4 (58) October 2010 JOURNAL of the HARDY ORCHID SOCIETY Vol. 7 No. 4 (58) October 2010 The Hardy Orchid Society Our aim is to promote interest in the study of Native European Orchids and those from similar temperate climates throughout the world. We cover such varied aspects as field study, cultivation and propagation, photography, taxonomy and systematics, and practical conservation. We welcome articles relating to any of these subjects, which will be considered for publication by the editorial committee. Please send your submissions to the Editor, and please structure your text according to the “Advice to Authors” (see website www.hardyorchidsociety.org.uk, January 2004 Journal, Members’ Handbook or contact the Editor). Views expressed in journal arti- cles are those of their author(s) and may not reflect those of HOS. The Hardy Orchid Society Committee President: Prof. Richard Bateman, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens Kew, Richmond, Surrey, TW9 3DS Chairman: Celia Wright, The Windmill, Vennington, Westbury, Shrewsbury, Shropshire, SY5 9RG [email protected] Vice-Chairman: David Hughes, Linmoor Cottage, Highwood, Ringwood, Hants., BH24 3LE [email protected] Secretary: Alan Leck, 61 Fraser Close, Deeping St. James, Peterborough, PE6 8QL [email protected] Treasurer: John Wallington, 17, Springbank, Eversley Park Road, London, N21 1JH [email protected] Membership Secretary: Moira Tarrant, Bumbys, Fox Road, Mashbury, Chelmsford, -

The Epipactis Helleborine Group (Orchidaceae): an Overview of Recent Taxonomic Changes, with an Updated List of Currently Accepted Taxa
plants Review The Epipactis helleborine Group (Orchidaceae): An Overview of Recent Taxonomic Changes, with an Updated List of Currently Accepted Taxa Zbigniew Łobas 1,* , Anatoliy Khapugin 2,3 , Elzbieta˙ Zołubak˙ 1 and Anna Jakubska-Busse 1,* 1 Department of Botany, Faculty of Biological Sciences, University of Wroclaw, 50-328 Wroclaw, Poland; [email protected] 2 Institute of Environmental and Agricultural Biology (X-BIO), Tyumen State University, 625003 Tyumen, Russia; [email protected] 3 Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park “Smolny”, 430005 Saransk, Russia * Correspondence: [email protected] (Z.Ł.); [email protected] (A.J.-B.) Abstract: The Epipactis helleborine (L.) Crantz group is one of the most taxonomically challenging species complexes within the genus Epipactis. Because of the exceptionally high levels of morpho- logical variability and the ability to readily cross with other species, ninety different taxa at various taxonomic ranks have already been described within its nominative subspecies, but the taxonomic status of most of them is uncertain, widely disputed, and sometimes even irrelevant. The present review is based on results of the most recent research devoted to the E. helleborine group taxonomy. In addition, we analysed data about taxa belonging to this group presented in some research articles and monographs devoted directly to the genus Epipactis or to orchids in certain area(s). Based on the reviewed literature and data collected in four taxonomic databases Available Online, we propose an Citation: Łobas, Z.; Khapugin, A.; updated list of the 10 currently accepted taxa in the E. -

Changes in the Abundance of Danish Orchids Over the Past
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.01.019455; this version posted April 2, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-ND 4.0 International license. 1 Changes in the abundance of Danish 2 orchids over the past 30 years 3 Christian Damgaard, Jesper Erenskjold Moeslund, Peter Wind 4 Department of Bioscience, Aarhus University, Denmark 5 Abstract 6 Orchid abundance data collected during the past 30 years from 440 sites within the National Orchid 7 Monitoring Program were analysed to quantify the population trends of orchids in Denmark, and the 8 underlying reasons for the observed population trends were analysed and discussed. Twenty of the 45 9 monitored Danish orchids showed a significant decrease in abundance over the past 30 years (16, if only 10 orchids with at least 50 observations each are selected), thus corroborating the previous observations of 11 declining orchid abundances at European scale. Generally, there was a significant negative effect of 12 overgrowing with tall-growing herbs and shrubs on the abundance of Danish orchids. 13 14 Keywords: Danish orchid species, Danish Red List, National Orchid Monitoring Program, Danish Orchid 15 Database, citizen science, monitoring, vegetation, population size, population trend, plant abundance, 16 plant diversity, pressures on orchid sites 1 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.01.019455; this version posted April 2, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. -
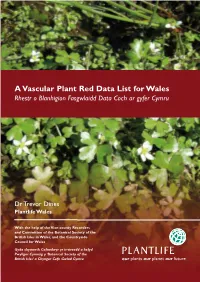
A Vascular Plant Red Data List for Wales
A Vascular Plant Red Data List for Wales A Vascular Plant Red Data List for Wales Rhestr o Blanhigion Fasgwlaidd Data Coch ar gyfer Cymru Rhestr o Blanhigion Fasgwlaidd Data Coch ar gyfer Cymru Dr Trevor Dines Plantlife Wales With the help of the Vice-county Recorders Plantlife International - The Wild Plant Conservation Charity and Committee of the Botanical Society of the 14 Rollestone Street, Salisbury Wiltshire SP1 1DX UK. British Isles in Wales, and the Countryside Telephone +44 (0)1722 342730 Fax +44 (01722 329 035 Council for Wales [email protected] www.plantlife.org.uk Plantlife International – The Wild Plant Conservation Charity is a charitable company limited by guarantee. Gyda chymorth Cofnodwyr yr is-siroedd a hefyd Registered Charity Number: 1059559 Registered Company Number: 3166339. Registered in England and Wales. Pwyllgor Cymreig y ‘Botanical Society of the Charity registered in Scotland no. SC038951. British Isles’ a Chyngor Cefn Gwlad Cymru © Plantlife International, June 2008 1 1 ISBN 1-904749-92-5 DESIGN BY RJPDESIGN.CO.UK RHESTROBLANHIGIONFASGWLAIDDDATACOCHARGYFERCYMRU AVASCULARPLANTREDDATALISTFORWALES SUMMARY Featured Species In this report, the threats facing the entire vascular plant flora of Wales have Two species have been selected to illustrate the value of producing a Vascular Plant been assessed using international criteria for the first time. Using data supplied Red Data List for Wales. by the Botanical Society of the British Isles and others, the rate at which species are declining and the size of remaining populations have been quantified in detail to provide an accurate and up-to-date picture of the state of vascular Bog Orchid (Hammarbya paludosa) plants in Wales.The production of a similar list (using identical criteria) for Least Concern in Great Britain but Endangered in Wales Great Britain in 2005 allows comparisons to be made between the GB and Welsh floras.