Moritz Daniel Oppenheim Und Heinrich Heine1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Frankfurt A.M
The Frankfurt a.M. Memorbuch: Gender Roles in the Jewish Community Institutions 1 The Frankfurt a.M. Memorbuch: Gender Roles in the Jewish Community Institutions1 Tzvia Koren-Loeb, Duisburg-Essen University, Germany Abstract This paper, based on a chapter in the author’s Ph.D. dissertation, brings to the forefront information that can be discerned from the Frankfurt Memorbuch [FM] with regard to gender roles in Jewish community institutions, such as the synagogue, house of study, burial societies, and cemeteries. Research of the Memorbücher literature, viable historical sources of daily life in different Jewish communities, has generally been neglected. Here for the first time, the author explores the literature of the Frankfurt a.M community. Introduction2 Pertaining to German Jewry, Memorbücher are handwritten manuscripts that include lists of deceased community members from the 13th century untill the end of World War II. Memorbücher usually comprise the following three main sections: (1) Memorial Prayers: These were traditionally recited by the cantor at the ‘al-memor’ stage in the synagogue. Examples are: Yizkor, Av Harachamim, Yiqom Purqan and different versions of Misheberakh prayer. Other prayers included in this section are Lekhah Dodi, special prayers for sicks, several prayers for special cases, rules for shofar blower and for the reading of the Megillat Esther, and bans against various members of the community. (2) Private Memorial Prayers: This part includes lists of late prominent members of the local Jewish community. It mentions only names of rabbis and scholars, who were active in Ashkenaz. The names listed in this section were usually read aloud twice a year, on the Sabbath before Shavuot, when the massacre of the First Crusade against the Jews occurred in 1096, and on the Sabbath before the Ninth of Av, the fast commemorating the destruction of the two temples in Jerusalem – by the Babylonians in 586 BCE and the Romans in 70 CE. -

The Jew in the Modern World- a Documentary History
Jews facing the Modern World “ My blood is Jewish, my skin is Hungarian, I am a Human being” Komlós Aladár (1892-1980) Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882) Presenting Dr. Chava Baruch Yad Vashem Maurycy Gottlieb(1856-1879) What is the Image of Judaism? What do Traditional Jews learn? Mitzvot:248 Positive Commandments,365 Prohibitions 2 part of the Torah: Written: Pentateuch Oral ( written down 200-700 CE) Mishna, Talmud Trinity: People, Land and Teachings What about you? How do you combine your Religious, Cultural and National Heritage with Modernity in your Everyday life? Who is the‖ real‖ Jew? Who is the ―real ― Jew? Questions and dilemmas How to be a Jew in a Modern State, in a Modern Society? What is the price of Emancipation? Does Assimilation stop Anti- Semitism? Is Judaism a Religion a Nationality, a Culture, or a Civilization? What is the impact of Zionism on Jewish life? Impact of Modernity on Jewish life Haskala- Religious tradition-Rituals Juristical Status- Emancipation Education Culture Loyalty to State New Secular Ideologies ( Liberalism, Socialism, Nationalism) Zionism What is the meaning of Enlightenment? European Enlightenment- 18. Century Enlightenment according to Emanuel.Kant: “Liberation of man from his self-incurred Immaturity” In: Amos Elon: The Pity of it all: A Portrait of the German- Jewish Epoch 1743-1933. p.37 1724-1804 How did Enlightenment challenge Judaism and Jewish life? Are the Jews going to abandon their Tradition? Is it possible to combine Jewish Tradition with Modernity? Were all the Jews interested in changing their tradition? What is the main message of Moses Mendelssohn for Jews and non Jews? European Enlightenment- Jewish Haskala 18. -
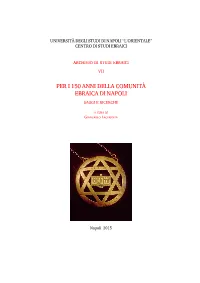
1-4 Frontespizio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” CENTRO DI STUDI EBRAICI ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI VII PER I 150 ANNI DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI NAPOLI SAGGI E RICERCHE A CURA DI GIANCARLO LACERENZA Napoli 2015 AdSE VII ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI DIRETTO DA GIANCARLO LACERENZA CENTRO DI STUDI EBRAICI DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” PIAZZA S. DOMENICO MAGGIORE 12, 80134 NAPOLI TEL+39 0816909675 - FAX+39 0815517852 [email protected] In copertina: Magen David in ottone, dono di Giuseppe Terracini (1947) Per gentile concessione della Comunità Ebraica di Napoli ISBN 978-88-6719-105-5 Prodotto da IL TORCOLIERE – Officine Grafico-Editoriali di Ateneo Finito di stampare nel mese di novembre 2015 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” CENTRO DI STUDI EBRAICI ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI VII PER I 150 ANNI DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI NAPOLI SAGGI E RICERCHE A CURA DI GIANCARLO LACERENZA NAPOLI 2015 © Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” SOMMARIO 7 ELDA MORLICCHIO Premessa 9 MARIA CARMELA SCHISANI La Banca “C.M. Rothschild e figli” di Napoli 33 ROBERTA ASCARELLI Ritratto di famiglia con pittore: Moritz Oppenheim e i Rothschild di Napoli 43 BRUNO DI PORTO Momenti e figure nel rapporto fra ebrei e Mezzogiorno 53 ROSARIA SAVIO Mario Recanati, un pioniere della cinematografia napoletana 59 GIANCARLO LACERENZA I libri e i manoscritti ebraici della Comunità 79 GIACOMO SABAN Da Salonicco a Napoli 101 MIRIAM REBHUN La Comunità vissuta: memorie da metà Novecento 107 PIERPAOLO PINHAS PUNTURELLO Il rinnovamento ebraico a Napoli 121 PIERANGELA DI LUCCHIO La Comunità ebraica di Napoli oggi Premessa In occasione del centocinquantenario della Comunità Ebraica di Na- poli, al Centro di Studi Ebraici dell’Università degli studi di Napoli “L’O- rientale” è stata affidata l’organizzazione delle due mostre ospitate a Na- poli presso la Biblioteca Nazionale (12 novembre - 12 dicembre 2014) e l’Archivio di Stato (14 gennaio - 26 marzo 2015). -

A Sprig of the Mendelssohn Family Tree
A Sprig of the Mendelssohn Family Tree Edward Gelles The progeny of Moses Mendelssohn, the 18th century German philosopher and pillar of Jewish Enlightenment, possess an illustrious ancestry. Moses Mendelssohn’s mother .was a direct descendant of the 16th century Jewish community leader and Polish statesman Saul Wahl, a scion of the Katzenellenbogen Chief Rabbis of Padua and Venice. More widely known than his famous grandfather Moses Mendelssohn is the composer Felix Mendelssohn-Bartholdy. The latter’s sister Fanny was also a highly gifted musician, who was overshadowd by her renowned brother. The early generations of the Mendelssohns were connected by marriage to distinguished families of their time, such as the Guggenheim, Oppenheimer, Wertheimer, Salomon, and Jaffe (Itzig), from whose ranks prominent Court Jews and other notables had emerged in Germany and Austria.. In a study of some descendants of my ancestor Saul Wahl I used DNA tests to show that my own lineage exhibited some significant matches with latter day members of the above mentioned old Ashkenazi families. While the genealogy of the Mendelssohn main line is well documented there has hitherto been a lack of relevant genetic data. Sheila Hayman, who is a descendant of Fanny Mendelssohn, agreed to take a “Family Finder” autosomal DNA test, the results of which are outlined below in so far they shed light on our family connections © EDWARD GELLES 2015 Ancestry of Sheila Hayman As may be seen from the appended family tree of Sheila Hayman, she is the daughter of a Jewish Professor of German extraction and an English Quaker mother. -

Die Jüdische Genremalerei Der Voremanzipatorischen Zeit Als Motivquelle Für Moritz Daniel Oppenheims Zyklus Zum Altjüdischen Familienleben
Die jüdische Genremalerei der voremanzipatorischen Zeit als Motivquelle für Moritz Daniel Oppenheims Zyklus zum altjüdischen Familienleben Eine gattungs- und motivgeschichtliche Untersuchung Inaugural – Dissertation zur Erlangung eines Doktors der Philosophie der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg im Fach Jüdische Kunst vorgelegt von: Esther Graf M. A. Mannheim 2004 Erstgutachterin: Dr. Felicitas Heimann-Jelinek Zweitgutachter: Prof. Dr. Michael Hesse Inhaltsverzeichnis Vorwort III Verwendete Bibelübersetzungen und abgekürzte Literatur IV 1. Einleitung 1 2. Der Begriff der Genremalerei. Phänomen und Gattung 11 2.1. Etymologie und historische Vorbemerkung 11 2.2. Das Phänomen Genremalerei in Mittelalter und Renaissance 12 2.3. Das 17. Jahrhundert. Auf dem Weg vom Phänomen zur Gattung 14 2.4. Das 18. und 19. Jahrhundert. Begriffsbestimmung für eine neue Gattung 14 2.5. Festlegung des Gattungsbegriffs im 20. Jahrhundert und heute 22 3. Begriffsbestimmung für die jüdische Genremalerei 26 4. Geschichte der jüdischen Genremalerei 32 4.1. Versuch der Rekonstruktion einer Genese bis etwa 1800 32 4.1.1. Die Buchmalerei des Mittelalters 37 4.1.2. Der Buchdruck und seine Auswirkungen auf die jüdische Genremalerei 54 4.1.3. Die Renaissance der Buchmalerei im 18. Jahrhundert 59 4.1.4. Jüdische Genreszenen nichtjüdischer Künstler im 18. Jahrhundert 71 4.2. Von der Buchillustration zum Tafelbild. Die jüdische Genremalerei im 19. Jahrhundert 75 4.2.1. Veränderungsmerkmale der jüdischen Gesellschaft durch die Aufklärung und die Emanzipation 75 4.2.2. Die Entwicklung und Etablierung der Gattung jüdische Genremalerei im 19. Jahrhundert 86 5. Die jüdische Genremalerei und ihre unterschiedlichen Funktionen 90 5.1. Genremalerei im Dienste des Emanzipationskampfes 90 5.2. -

JEWISH STUDIES at the University of Pennsylvania
2015 ANNUAL NEWSLETTER FALL/WINTER JEWISH STUDIES at the University of Pennsylvania THROUGH ITS JEWISH STUDIES PROGRAM AND THE HERBERT D. KATZ CENTER FOR ADVANCED JUDAIC STUDIES, THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA OFFERS AN UNPARALLELED ARRAY OF INTELLECTUAL AND EDUCATIONAL RESOURCES. ALONG WITH TEACHER- SCHOLARS, THE UNIVERSITY IS HOME TO SOME OF AMERICA’S GREATEST RESEARCH LIBRARIES IN JUDAICA AND HEBRAICA. left: ""Irgun", first Hebrew version of "Monopoly". Lithographic printing "A. Koffman", Haifa. 48X48 cm. Purchased thanks to the Albert and Ele Wood Judaica Library Endowment at the Kedem auction in Jerusalem, June 2015. CONTENTS pp. 2-3 Directors’ Letters pp. 4-13 Jewish Studies Program pp.14-17 Faculty pp. 18-20 Katz Center The Jewish Studies Program pp. 21-23 Libraries pp. 24 Gifts Undergraduates: The decision of Jewish into the humanities and social sciences. Studies faculty members to create a Faculty members associated with the Jewish Studies Program, rather than a Program teach an average of 400 department, reflects the conviction that undergraduate students per year. groups of their own design, assisted by the Jewish Studies Program. the riches and riddles of Jewish culture Graduate students in different across space and time ought not be departments and schools at Penn The Community: Over thirty events per marginalized, but rather, fully integrated convene conferences and reading year are open to the public. The Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies This post-doctoral research institute in Israel, Europe, and Latin America. The of various Penn Departments and the heart of historic Philadelphia weekly seminars in which Katz Center Programs, Katz Center Fellows broaden enables eighteen to thirty selected Fellows present their research are also awareness of Jewish culture’s integral scholars, at different stages in their attended by Penn faculty members and place in the Liberal Arts curriculum. -

Diskurs Religion
Internal Outsiders – Imagined Orientals? Edited by Ulrike Brunotte – Jürgen Mohn – Christina Späti DISKURS RELIGION BEITRÄGE ZUR RELIGIONSGESCHICHTE UND RELIGIÖSEN ZEITGESCHICHTE Herausgegeben von Ulrike Brunotte und Jürgen Mohn BAND 13 ERGON VERLAG Internal Outsiders – Imagined Orientals? Antisemitism, Colonialism and Modern Constructions of Jewish Identity Edited by Ulrike Brunotte – Jürgen Mohn – Christina Späti ERGON VERLAG Umschlagabbildung: © Wylius <http://www.istockphoto.com/de/portfolio/Wylius?mediatype=photography> – iStock by Getty Images Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. 2017 Ergon-Verlag GmbH · 97074 Würzburg Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für Einspeicherungen in elektronische Systeme. Umschlaggestaltung: Jan von Hugo Satz: Thomas Breier, Ergon-Verlag GmbH www.ergon-verlag.de ISSN 2198-2414 ISBN 978-3-95650-241-5 Table of Contents Ulrike Brunotte / Jürgen Mohn / Christina Späti Preliminary Remarks................................................................................................ 7 Colonialism, Orientalism and the Jews Steven E. Aschheim The Modern Jewish Experience and the Entangled -

Heinrich Frauberger and the Society for the Research of Jewish Art Monuments
Heinrich Frauberger and the Society for the Research of Jewish Art Monuments By Felicitas Heimann-Jelinek In the spring of 1897, the Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler (Society for the Research of Jewish Art Monuments) was founded in Frankfurt/Main. The foundation stone was laid by the non-Jewish director of the Museum of Decorative Arts in Düsseldorf, Heinrich Frauberger (1845–1920). Frauberger was prompted to become active in 1895 when he was asked to help with the design of an enclosure grid for a Jewish grave and had to realize that Jewish cult and art monuments were missing from the rich collection of cultic-religious models in the Kunstgewerbemuseum /Museum of Decorative Arts Düsseldorf: “In the central educational association in Düsseldorf there is a collection of role models that has been my pride and joy so far; well over 150,000 examples have been awarded during this time. So I was not surprised that a Jewish banker came and asked to get him a drawing for the enclosure of his parents' grave. I did not know any symbol, not even the architect. Then I remembered the sign of David. When I explained it to the architect, he exclaimed: That's an inn sign here in southern Germany! and set to work joyfully. It worked very well, but I was not left alone, especially since I have nothing at all to show for my work. All I heard from the rabbi was that there had been a Jewish exhibition in London and that a Jewish museum was to be built in Vienna. -
Ankunft in Der Moderne: Aufklärung Und Reformjudentum
Wolff, E (2008). Ankunft in der Moderne: Aufklärung und Reformjudentum. In: Herzig, A; Rademacher, C. Die Geschichte der Juden in Deutschland. Bonn, 114-121. Postprint available at: http://www.zora.uzh.ch University of Zurich Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich. Zurich Open Repository and Archive http://www.zora.uzh.ch Originally published at: Herzig, A; Rademacher, C 2008. Die Geschichte der Juden in Deutschland. Bonn, 114-121. Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2008 Ankunft in der Moderne: Aufklärung und Reformjudentum Wolff, E Wolff, E (2008). Ankunft in der Moderne: Aufklärung und Reformjudentum. In: Herzig, A; Rademacher, C. Die Geschichte der Juden in Deutschland. Bonn, 114-121. Postprint available at: http://www.zora.uzh.ch Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich. http://www.zora.uzh.ch Originally published at: Herzig, A; Rademacher, C 2008. Die Geschichte der Juden in Deutschland. Bonn, 114-121. Ankunft in der Moderne: Aufklärung und Reformjudentum Abstract Die Geschichte der Juden in Deutschland rührt an Grundfragen der Geschichte. Sie ist nicht vorstellbar ohne das Bewusstsein um den Völkermord an den Juden, begangen durch Deutsche in Deutschland und Europa. Dennoch - oder gerade deswegen - wäre es fatal, die Geschichte der Juden in Deutschland auf den Holocaust zu beschränken. Der Weg der Juden bis in die Mitte des politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im deutschen Kaiserreich war lang und wechselvoll. Er führte von der Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung im Mittelalter über eine Zeit der Duldung bis zur allmählichen Emanzipation der Juden seit der Aufklärung. -

Download Catalogue
K e s t e n b au m & c om pa n y . one hundred and FiFty years oF JeWish art Wednesday, december 16th, 2015 K est e n bau m & C o m pa ny . Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art A Lot 26 Catalogue of F i n e J u d a i C a . ONE HUNDRED AND FIFTY YEARS of JEWISH A RT FEATURING: MORITZ OPPENHEIM’S FREITAG A BEND (1867) ——— To be Offered for Sale by Auction, Wednesday, 16th December, 2015 at 6:00 pm precisely ——— Viewing Beforehand: Sunday, 13th December - 10:00 am - 2:00 pm Monday, 14th December - 10:00 am - 7:00 pm Tuesday, 15th December - 10:00 am - 7:00 pm No Viewing on the Day of Sale This Sale may be referred to as: “Keller” Sale Number Sixty Seven Illustrated Catalogues: $38 (US) * $45 (Overseas) KestenbauM & CoMpAny Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art . 242 West 30th street, 12th Floor, new york, NY 10001 • tel: 212 366-1197 • Fax: 212 366-1368 e-mail: [email protected] • World Wide Web site: www.Kestenbaum.net K est e n bau m & C o m pa ny . Chairman: Daniel E. Kestenbaum Operations Manager: Jackie S. Insel Client Relations: Sandra E. Rapoport, Esq. Printed Books & Manuscripts: Rabbi Eliezer Katzman Ceremonial & Graphic Art: Abigail H. Meyer Catalogue Art Director and Photographer: Anthony Leonardo Auctioneer: Mark O. Howald (NYCDCA License no: 1460490) For all inquiries relating to this sale please contact: Daniel E. Kestenbaum Front Cover Illustration: See lot 4 Back Cover Illustration: See lot 7 List of prices realized will be posted on our Web site, www.kestenbaum.net, following the sale. -

Philosophical Vignettes from the Political Life of Moses Mendelssohn
Click here for Full Issue of Fidelio Volume 8, Number 2, Summer 1999 Philosophical Vignettes from the Political Life of Moses Mendelssohn by David Shavin To think the true, to love the good, [T]o you, immortal Leibniz, I set to do the best. up an eternal memorial in my Moses Mendelssohn, July 6, 1776 heart! Without your help I would have been lost for ever. I never met The happiness of the human race was you in the flesh, yet your imperish- Socrates’ sole study. able writings . .. have guided me to the firm path of the true philoso- Moses Mendelssohn, 1769 phy, to the knowledge of myself and of my origin. They have ow can the “temple of lib- engraved upon my soul the sacred erty, and beacon of hope” truths on which my felicity is for the world be in mortal founded . [I]s there any slavery H harder to bear than the one in jeopardy of ending its days as a dumb, blind giant for the same which reason and heart are at log- gerheads with one another? British Empire families that we defeated? The methods by which The individual to whom evil has insinuated itself upon, and Moses Mendelssohn gave his heart- confounded, the good, are not unknowable. Moses felt gratitude for his emancipation was Gottfried Wil- Mendelssohn’s life, in thought and action, uniquely con- helm Leibniz. Mendelssohn, a short, hunch-backed Jew, veyed “the pursuit of happiness” in the two decades by mastering the higher unity of his heart and his mind, before, and one decade after, the Declaration of Indepen- became the powerful, towering intellect of Western civi- dence, when that evil was defeated. -

Encyclopedia of Jewish History and Culture
PREVIEW Encyclopedia of Jewish History and Culture Editor-in-Chief: Dan Diner, on behalf of the Saxonian Academy of Sciences and Humanities in Leipzig Editorial Staff: Markus Kirchhoff (Head), Philipp Graf, Stefan Hofmann, Ulrike Kramme, Regina Randhofer, Frauke von Rohden, Philipp von Wussow Consulting Editors of the English Edition: Cornelia Aust, Philipp Lenhard, Daniel Mahla Print Edition (7 vol. Set) • ISBN 9789004309401 • First volume, of 7 total, published in October 2017 • Complete set planned to be published by June 2021 From Europe to America to the Middle East, North topics like autonomy, exile, emancipation, literature, Africa and other non-European Jewish settlement liturgy, music or the science of Judaism. The seventh areas the Encyclopedia of Jewish History and volume index offers a detailed list of persons, places Culture covers the recent history of the Jews from and subjects that creates a reliable reference for 1750 until the 1950s. working with the encyclopedia. The encyclopedia Translated from German into English, approximately provides knowledge in an overall context and offers 800 keywords present the current state of academics and other interested readers new insights international research and depict a complex portrait into Jewish history and culture. It is an outstanding of Jewish life - illustrated by many maps and images. contribution to the understanding of Judaism and About 40 key articles convey central themes on modernity. Online Edition • ISSN 2468-8894 • More information and purchase options: brill.com/ejhc This booklet is a preview of Encyclopedia of Jewish History and Culture. The format and paper used for this preview are not indicative of the final printed version of the Encyclopedia.