Masterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
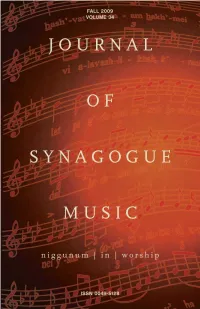
Transdenominational MA in Jewish Music Program, Preparing
THIS IS THE INSIDE FRONT COVER EDITOR: Joseph A. Levine ASSOCIATE EDITOR: Richard Berlin EDITORIAL BOARD Rona Black, Shoshana Brown, Geoffrey Goldberg, Charles Heller, Kimberly Komrad, Sheldon Levin, Laurence Loeb, Judy Meyersberg, Ruth Ross, Neil Schwartz, Anita Schubert, Sam Weiss, Yossi Zucker TheJournal of Synagogue Music is published annually by the Cantors As- sembly. It offers articles and music of broad interest to theh azzan and other Jewish professionals. Submissions of any length from 1,000 to 10,000 words will be consid ered. GUIDELINES FOR SUBMITTING MATERIAL All contributions and communications should be sent to the Editor, Dr. Joseph A. Levine—[email protected]—as a Word docu- ment, with a brief biography of the author appended. Musical and/or graphic material should be formatted and inserted within the Word document. Footnotes are used rather than endnotes, and should conform to the fol- lowing style: A - Abraham Idelsohn, Jewish Liturgy (New York: Henry Holt), 1932: 244. B - Samuel Rosenbaum, “Congregational Singing”; Proceedings of the Cantors Assembly Convention (New York: Jewish Theological Seminary), February 22, 1949: 9-11. Layout by Prose & Con Spirito, Inc., Cover design and Printing by Replica. © Copyright 2009 by the Cantors Assembly. ISSN 0449-5128 ii FROM THE EDITOR: The Issue of Niggunim in Worship: Too Much of a Good Thing? ..................................................4 THE NEO-HASIDIC REVIVAL AT 50 Music as a Spiritual Process in the Teachings of Rav Nahman of Bratslav Chani Haran Smith. 8 The Hasidic Niggun: Ethos and Melos of a Folk Liturgy Hanoch Avenary . 48 Carlebach, Neo-Hasidic Music and Liturgical Practice Sam Weiss. -

Download Catalogue
F i n e Ju d a i C a . pr i n t e d bo o K s , ma n u s C r i p t s , au t o g r a p h Le t t e r s , gr a p h i C & Ce r e m o n i a L ar t K e s t e n b a u m & Co m p a n y We d n e s d a y , ma r C h 21s t , 2012 K e s t e n b a u m & Co m p a n y . Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art A Lot 275 Catalogue of F i n e Ju d a i C a . PRINTED BOOKS , MANUSCRI P TS , AUTOGRA P H LETTERS , GRA P HIC & CERE M ONIA L ART Featuring: Property from the Library of a New England Scholar ——— To be Offered for Sale by Auction, Wednesday, 21st March, 2012 at 3:00 pm precisely ——— Viewing Beforehand: Sunday, 18th March - 12:00 pm - 6:00 pm Monday, 19th March - 10:00 am - 6:00 pm Tuesday, 20th March - 10:00 am - 6:00 pm No Viewing on the Day of Sale This Sale may be referred to as: “Maymyo” Sale Number Fifty Four Illustrated Catalogues: $38 (US) * $45 (Overseas) KestenbauM & CoMpAny Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art . 242 West 30th street, 12th Floor, new york, NY 10001 • tel: 212 366-1197 • Fax: 212 366-1368 e-mail: [email protected] • World Wide Web site: www.Kestenbaum.net K e s t e n b a u m & Co m p a n y . -

Fine Judaica
t K ESTENBAUM FINE JUDAICA . & C PRINTED BOOKS, MANUSCRIPTS, GRAPHIC & CEREMONIAL ART OMPANY F INE J UDAICA : P RINTED B OOKS , M ANUSCRIPTS , G RAPHIC & C & EREMONIAL A RT • T HURSDAY , N OVEMBER 12 TH , 2020 K ESTENBAUM & C OMPANY THURSDAY, NOV EMBER 12TH 2020 K ESTENBAUM & C OMPANY . Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art Lot 115 Catalogue of FINE JUDAICA . Printed Books, Manuscripts, Graphic & Ceremonial Art Featuring Distinguished Chassidic & Rabbinic Autograph Letters ❧ Significant Americana from the Collection of a Gentleman, including Colonial-era Manuscripts ❧ To be Offered for Sale by Auction, Thursday, 12th November, 2020 at 1:00 pm precisely This auction will be conducted only via online bidding through Bidspirit or Live Auctioneers, and by pre-arranged telephone or absentee bids. See our website to register (mandatory). Exhibition is by Appointment ONLY. This Sale may be referred to as: “Shinov” Sale Number Ninety-One . KESTENBAUM & COMPANY The Brooklyn Navy Yard Building 77, Suite 1108 141 Flushing Avenue Brooklyn, NY 11205 Tel: 212 366-1197 • Fax: 212 366-1368 www.Kestenbaum.net K ESTENBAUM & C OMPANY . Chairman: Daniel E. Kestenbaum Operations Manager: Zushye L.J. Kestenbaum Client Relations: Sandra E. Rapoport, Esq. Judaica & Hebraica: Rabbi Eliezer Katzman Shimon Steinmetz (consultant) Fine Musical Instruments (Specialist): David Bonsey Israel Office: Massye H. Kestenbaum ❧ Order of Sale Manuscripts: Lot 1-17 Autograph Letters: Lot 18 - 112 American-Judaica: Lot 113 - 143 Printed Books: Lot 144 - 194 Graphic Art: Lot 195-210 Ceremonial Objects: Lot 211 - End of Sale Front Cover Illustration: See Lot 96 Back Cover Illustration: See Lot 4 List of prices realized will be posted on our website following the sale www.kestenbaum.net — M ANUSCRIPTS — 1 (BIBLE). -

Price List for Books
Author Title Retail Interiors 1973-1974, Ltd. Edition of 24 loose plates, in Adams, Robert $550 folio and clothbound case, #14/100 Portfolio Latinoamericano 1974-1996. Throckmorton Algaze, Mario $35 Gallery exhibit catalogue Jessie Tarbox Beals: First Woman News Photographer - Alland, Alexander $35 HB, DJ, 1978 Anrakuji, Emi e hagaki, HB with photo, signed, Ed. 34/500 $125 ARAKI, Nobuyoshi Viaggio Sentimentale - 1st, SB with stiff wrapper, 2000 $300 Araki, Nobuyoshi Kaori (HB, Reflex Gallery) $125 Arbus, Amy On the Street - 1st, HB, illustrated boards, 2006, signed $100 Arndt, Thomas Frederick Thomas Frederick Arndt: Men in America: Photographs $60 & David Travis 1973-1987 - softcover, 1988 Attie, Shimon The Writing on the Wall, HB with DJ $120 Barns, Lawrence The Male Nude In Photography - softcover, 1980 $60 Ilse Bing: Three Decades of Photography - 1st, softcover, Barrett, Nancy C. $70 1985, New Orleans Museum of Art Basilico, Gabriele L'esperienza dei luoghi (first edition, DJ, signed) $125 Marian Drew: Photographs and Video Works - 1st, HB, Batchen, Geoffrey $50 2006 Jardins Do Paraiso: Exposição , Galeria Do Museu Bauret, Gabriel Antropologico Da Universidade de Coimbra, Novembro $40 de 1993, softcover Fotografia Latinoamericana desde 1860 Hasta nuestros Belliter, Erika (intro) $60 dias - HB, Spanish text, 1982 Biermann, Aenne Fotografien 1925-33 - softcover, 1987 $80 Malerei und Photographie im Dialog - 1st, soft cover, Billeter, Erika $100 1979, Benteli Verlag David Wojnarowicz: Tongues Of Flame - sofcover, 1990, Blinderman, Barry $60 1st Boltanski, Christian Night In August, 1998 $125 Borhan, Pierre Andre Kertesz: His Life and Work - 1st, HB, DJ,1994 $150 Boucher, Pierre Boucher, Photo Graphiste - 1st, HB, DJ, 1988 $70 Brandt, Nick On This Earth (first edition, first printing) $125 Brassai The Artists of My Life - HB with DJ, 1982 $75 Brassai Brassai - 1st soft cover - Fundacio Antoni Tapies, 1993 $60 Marianne Breslauer., Retrospektive Fotografie- 1979, SB, Breslauer, Marianne $100 Edition Marzona RUHR - Ltd. -
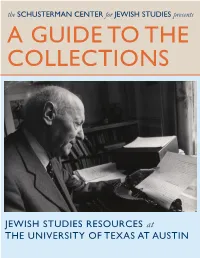
Guide to Jewish Studies Resources at UT Austin
the SCHUSTERMAN CENTER for JEWISH STUDIES presents A GUIDE TO THE COLLECTIONS JEWISH STUDIES RESOURCES at THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN table of CONTENTS I. A Message from the Director ............................................... 2 II. The Architecture and Planning Library ..................................... 4 III. The Fine Arts Library ........................,............................... 5 IV. The Perry-Castañeda Library .............................................. 6 V. The Tarlton Law Library ..................................................... 7 VI. The Nettie Lee Benson Latin American Collection . 8 VII. The Harry Ransom Center ............................................... 10 VIII. The Dolph Briscoe Center for American History . 20 a message from THE DIRECTOR ONE OF THE founding goals of the Schusterman Center for Jewish Studies at The University of Texas at Austin was to become a crossroads for the study of Jews and Jewish culture in all its aspects, with particular focus on Jewish life in the Americas. A crucial piece of this vision has been to make more visible to an international audience the rich research collections concerning Jews in the vari- ous archives and libraries on the Austin campus. We have prepared this guide to promote the use of these resources by both students and scholars based not only in Austin, but also elsewhere in the United States and around the world. Someone not familiar with the University of Texas may find astonishing the depth, breadth, and importance of these materials. Available for research are resources like the papers of Jewish writers, including Isaac Bashevis Singer, Arthur Miller, and Nor- man Mailer, local history collections of the Texas Jewish Historical Society, exten- ROBERT H. ABZUG, DIRECTOR sive holdings in Yiddish and Hebrew, and rare and unusual examples of Judaica. -
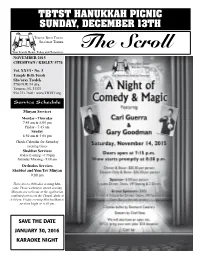
The Scroll NOVEMBER 2015 CHESHVAN / KISLEV 5776
TBTST HANUKKAH PICNIC SUNDAY, DECEMBER 13TH The Scroll NOVEMBER 2015 CHESHVAN / KISLEV 5776 Vol. XXVI • No. 3 Temple Beth Torah Sha'aray Tzedek 5700 N.W. 94 Ave. Tamarac, FL 33321 954.721.7660 • www.TBTST.org Service Schedule Minyan Services Monday - Thursday 7:45 am & 6:00 pm Friday - 7:45 am Sunday 8:30 am & 5:00 pm Check Calendar for Saturday evening times Shabbat Services Friday Evening - 6:30 pm Saturday Morning - 9:00 am Orthodox Services Shabbat and Yom Tov Minyan 9:00 am There are no Orthodox evening Min- yans. Those wishing to attend evening Minyans are welcome at the egalitarian combined service in the Chapel, daily at 6:00 pm. Friday evening Mincha/Maariv services begin at 6:30 pm. SAVE THE DATE JANUARY 30, 2016 KARAOKE NIGHT NOVEMBER 2015 TEMPLE BETH TORAH SHA'ARAY TZEDEK CHESHVAN / KISLEV 5776 Shabbat Services RABBI'S MESSAGE Saturday Morning - 9:00 am By Rabbi Michael Gold November 7 Birkat Hachodesh Dear Friends, November 14 On Yom Kippur at Kol Nidre services I spoke about creating Toledot a relational synagogue. How do we create a place where people November 21 can relate to each other, to the greater Jewish community, to Is- Vayetze rael, to Torah, and to God? Here is a selection from that sermon: November 28 A synagogue is a Beit Tefilah – literally a “House of Prayer.” Vayishlach Jews want to talk to God, to relate to God. I am well aware that many Jews who come to synagogue do not come to talk to God. -

Achim Von Arnim. Sämtliche Romane Und Erzählungen. Albert Giraud
Achim von Arnim. Sämtliche Romane und Erzählungen. Auf Grund der Erstdrucke hrsg. von Walther Migge. 3 Bände. Carl Hanser, München 1962-1965. 19 x 11,5 cm. 2.700 S. Original-Lederbände mit vergoldeten Rückentiteln und Kopfgoldschnitt (Kapital berieben. Vorderschnitt etwas gebräunt). Dünndruckausgabe. »Zuverlässig gearbeitete, vollständigste Ausagbe des epischen Werks ...« (Hagen). 1. Gräfin Dolores. Die Kronenwächter. 2. Erzählungen. 3. Landhausleben. Der Pfalzgraf, ein Goldwäscher. Erzählungen. In der Lederausgabe selten! Gut erhalten. Hagen 8. 170,00 € (36951) Albert Giraud und Otto Erich Hartleben. Pierrot Lunaire. Mit vier Musikstücken von Otto Vrieslander. (Herausgegeben von Franz Blei). Georg Müller, München 1911. 27 x 22 cm. (8), 50, 36 S., 1 Blatt Kollophon. Grauer Original-Pappband mit Rückenvergoldung und Kopfgoldschnitt (Einband geringfügig fleckig). Erste Ausgabe. Nr. 373 von 400 nummerierten Exemplaren der einmaligen Auflage. Einband entworfen und hergestellt von P. A. Demeter. Der erste Teil des Buches enthält die Gedichte von Albert Giraud in der Übersetzung von O. E. Hartleben. Im zweiten Teil sind die Gedichte (mit Noten) »Rot und Weiss«, »Spleen«, »Landschaft« und »Die Harfe« von A. Giraud in den Vertonungen von Otto Vrieslander abgedruckt. Gut erhalten. 220,00 € (37084) Alberto Sangorski. The Sermon on the Mount. Designed, written and illuminated by Alberto Sangorski. Mit drei Farbtafeln (incl. Titel) und illuminiertem Buchschmuck auf jeder Seite. Basil Blackwell, Oxford (1937). 26 x 21 cm. [4], 21 S., 2 Blatt. Handgebundener weinroter geglätteter Kalblederband auf fünf Bünden (Franzband) mit reicher Rückenvergoldung und vergoldetem Rückenschild. Deckelvergoldung, Innenkantenfileten und Kopfgoldschnitt (sign. Sangorski & Sutcliffe, London). »The Sermon on the Mount« as disigned, written out, and illuminated by Alberto Sangorski, and including by kind permission of The Right Hon. -

The Chronicle North Central Florida’S Jewish Community Newspaper Published and Supported by the Jewish Council of North Central Florida
the chrOnicle North Central Florida’s Jewish Community Newspaper Published and Supported by The Jewish Council of North Central Florida September 2014 Elul, 5774 - Tishrei, 5775 Welcome To A Brand New Year Of Programs And Exciting Activities By Dawn Burgess- Krop year, and be grateful that your name You support Jewish activities and JCNCF President remained in the Book of Life for one culture. You come to learn, celebrate, If you have noticed the crazy traf- more year. And you get to eat! commemorate, and are the essence of fic and lines in stores and restaurants, When I consider gratitude, I think our Jewish community. We truly can- you know that the fall season has ar- of all the truly wonderful people sur- not fulfill our commitment as Jews rived in Gainesville (maybe someone rounding me. Family, friends, and the without your support and participa- could alert the weather!). Fall in a col- wonderful circle of people, who, every tion. lege town means fresh faces, football, day, do the best they can to be good As we welcome our New Year, and crowds. Fall also means our High and decent. we cannot forget all our brothers and Holidays are on their way. I am grateful to my JCNCF sisters around the world who are fac- Of all the holidays in the Jewish Board, who offer sage advice, care ing profound struggle and danger. Is- calendar, I love Rosh Hashanah the about their Jewish community, and rael's threats are our burden to share, most. You take stock of your life over perform important service. -

The Jewish Cantor in History Moshe Koussevitzky's Early Career Byron's
September 2019 Volume 44 Number 1 The Jewish Cantor in History Moshe Koussevitzky’s Early Career Byron’s “She Walks in Beauty,” a New Setting Odessa’s Unsung Composer — Pinchas Minkowsky Congregational Song in American Conservative Synagogues and Much More... September 2019 Volume 44 Number 1 The Journal is optimized to be read using Adobe Acrobat Reader (click here for a free download). The Bookmark feature, which allows readers to directly access and then jump between articles, may not otherwise function. Front Cover: Jubilee Synagogue, Jerusalem Street, Prague. LOOKING BACK The Jewish Cantor in History—or—Music in Medieval Judaism Israel Goldschmidt ......................................................................................................... 4 A New Setting by Charles Heller of Byron’s “She Walks in Beauty,” Gleaned from several sources (Click where indicated to access the audio file) ........ 14 A Moment in Time: Odessa and Its Unsung Composer— Pinchas Minkowsky (1859-1924) Marsha Bryan Edelman.................................................................................................. 16 Portrait of the Artist as a Young Cantor—Moshe Koussevitzky’s Early Career (1918-1928)—on the 120th Anniversary of His Birth Mark Friedlander ........................................................................................................... 26 The Development of Congregational Song in the American Conservative Synagogue 1900-1955 Geoffrey Goldberg ........................................................................................................ -

Bagel Shop Newsletter
No. 1 2019 • No. 2 5779 DISCOVER – GET TO KNOW – ACCEPT Anti-Semitic Stereotypes in Periodicals 8 The House of Prayer Taharot HaKodesh 14 Guidelines for Commemoration of Great Synagogue 17 Švėkšna Shtetl 18 Bagel Shop Café Celebrates Third Birthday 21 Jewish Scouts Hike 22 ISSN 2424-4759 Editor’s Corner Dear reader, Here we stand again before the gates of spring. Torrential showers will come, the gardens will bloom again and again we will fall into a languid torpor, although this time it's that of summer rather than winter. But that will come later. Right now it's time to wake up. Let's get happy! The latest issue of the Bagel Shop contains an interview with Dr. Linas Venclaus- kas about anti-Semitism in the Lithuanian press. Geršonas Taicas tells us about the cantors at the Choral Synagogue in Vilnius. We will also make an excursion to the shtetl of Shveksna. Also for your consideration: some brief news items, re- flecting important activities and events in the community. Read the Bagel Shop and come enjoy some Jewish treats at the Bagel Shop Café located at Pylimo street no. 4 in Vilnius. As always, we look forward to your ideas, comments and suggestions. Write us at [email protected] Radvilė NEWS ROUND-UP 2018 September 10 The Kaunas Regional Public Library hosted sary of the destruction of the Vilnius ghetto held at the the launch of the book “Žydai Pakaunėje” [Jews of the Kau- Lithuanian Jewish Community, accompanied on piano by nas Region]. The book was compiled by Dr. -

Brief Glimpses of Beauty. Thinking About the History of Lithuanian Photography
342 Brief Glimpses of Beauty. Thinking about the History of Lithuanian Photography Adam Mazur University of Arts in Poznań Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, Poland [email protected] The article proposes a critical re-thinking of the multi-layered phenomenon of Lithuanian photography. From the beginning, in the 19th century Lithuanian photography cherished an exceptional status within a cultural landscape, being considered a vehicle of lofty, patriotic emotions. The article is reassessing the social and cultural role of Lithuanian photo- graphers and is looking into a symptomatic lack of synchronicity with the medium’s grand narratives. The Lithuanian history of photography seems to be a consistent and exceptional narrative developed within a relative- ly small milieu of artists based in their homeland as well as Lithuanian émigrés. According to the author, indexical and documentary qualities of photography constitute the core of the phenomenon. The text is advocating inclusivity for non-Lithuanian authors, be it Polish Lithuanians, Russians, Jews, Germans, or Lithuanian Americans. Looking at photographs from the perspectives of literature (quoting Marcelijus Martinaitis and Tomas Venclova) and contemporary art (Jonas Mekas and Fluxus) may be also useful in reshaping and opening up the discourse of the discipline. Keywords: Lithuanian Photography, Lithuanian Art, Lithuanian History, documentary photography, art photography, Balys Buračas, Jan Bułhak, Antanas Sutkus, Jonas Mekas. 343 Lithuania is a land of photographers, says Balys Buračas.1 This claim of the Lithuanian artist is surprising, given that Lithuania does not have a history of a photo industry, or factories of photosensitive materials, cameras, lenses, and matrices. Neither does it have any inventors or pione- ers of photography of textbook fame. -

An Annotated Translation of Pinchas Szerman's Poilishe Khazones In
SCRIPTA JUDAICA CRACOVIENSIA Vol. 14 (2016) pp. 99–109 doi: 10.4467/20843925SJ.16.007.5666 A A T P S’ Pਏਉਉਓਈਅ Kਈਁਚਏਅਓ ਉ Fਁਇਁਇਅਈਅਉਔ ਕ Tਚਕਕਆਔ [T P C P F], 19241 Benjamin Matis (University of Kansas) Key words: Hazzanut, Poland, Cantor, Jewish Ministers Cantors Association, Pinchas Szerman, Moshe Koussvitsky, Gerson Sirota, Great Synagogue of Warsaw Abstract: A translation of a Polemic essay by Cantor Pinchas Szerman, second cantor at the Great synagogue of Warsaw. The essay discusses the many difficulties experienced by cantors in his time, especially the ones who had not be educated. In Szerman’s opinion, the only way to ease the burden – especially the financial burden – was to create a class of educated and professional cantors. The many customs of Polish Jewry that are forgotten today have been annotated as well as basic biographical data on highly influential earlier cantorial masters. Introduction The role of the cantor, or khazan in Hebrew and khazn in Yiddish, is to recite the often very lengthy and rather wordy liturgy. The cantor essentially prays on behalf of the congregation (the Hebrew title Shliach Tzibbur means exactly that), many of whom cannot read Hebrew, and before the printing press even fewer had a prayer books at all. The worshiper needed only to respond “Amen,” to the blessing recited by the cantor to have fulfilled the mitzvah (commandment) of prayer. Unlike a Catholic priest, a cantor or rabbi need not be of some special category: anyone with a decent moral character, Jewishly literate, and had a pleasant voice can serve as khazan.