Frosch Und Frankenstein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Desire, Disease, Death, and David Cronenberg: the Operatic Anxieties of the Fly
Desire, Disease, Death, and David Cronenberg: The Operatic Anxieties of The Fly Yves Saint-Cyr 451 University of Toronto Introduction In 1996, Linda and Michael Hutcheon released their groundbreaking book, Opera: Desire, Disease, Death, a work that analyses operatic representations of tuberculosis, syphilis, cholera, and AIDS. They followed this up in 2000 with Bodily Charm, a discussion of the corporeal in opera; and, in 2004, they published Opera: The Art of Dying, in which they argue that opera has historically provided a metaphorical space for the ritualistic contemplation of mortality, whether the effect is cathartic, medita- tive, spiritual, or therapeutic. This paper is based on a Hutcheonite reading of the Fly saga, which to date is made up of seven distinct incarnations: George Langelaan published the original short story in 1957; Neumann and Clavell’s 1958 film adaptation was followed by two sequels in 1959 and 1965; David Cronenberg re-made the Neumann film in 1986, which gener- ated yet another sequel in 1989; and, most recently in 2008, Howard Shore and David Henry Hwang adapted Cronenberg’s film into an opera. If the Hutcheons are correct that opera engenders a ritualistic contemplation of mortality by sexualising disease, how does this practice influence composers and librettists’ choice of source material? Historically, opera has drawn on the anxieties of its time and, congruently, The Fly: Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée CRCL DECEMBER 2011 DÉCEMBRE RCLC 0319–051x/11/38.4/451 © Canadian Comparative Literature Association CRCL DECEMBER 2011 DÉCEMBRE RCLC The Opera draws on distinctly 21st-century fears. -

The Hollywood Cinema Industry's Coming of Digital Age: The
The Hollywood Cinema Industry’s Coming of Digital Age: the Digitisation of Visual Effects, 1977-1999 Volume I Rama Venkatasawmy BA (Hons) Murdoch This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy of Murdoch University 2010 I declare that this thesis is my own account of my research and contains as its main content work which has not previously been submitted for a degree at any tertiary education institution. -------------------------------- Rama Venkatasawmy Abstract By 1902, Georges Méliès’s Le Voyage Dans La Lune had already articulated a pivotal function for visual effects or VFX in the cinema. It enabled the visual realisation of concepts and ideas that would otherwise have been, in practical and logistical terms, too risky, expensive or plain impossible to capture, re-present and reproduce on film according to so-called “conventional” motion-picture recording techniques and devices. Since then, VFX – in conjunction with their respective techno-visual means of re-production – have gradually become utterly indispensable to the array of practices, techniques and tools commonly used in filmmaking as such. For the Hollywood cinema industry, comprehensive VFX applications have not only motivated the expansion of commercial filmmaking praxis. They have also influenced the evolution of viewing pleasures and spectatorship experiences. Following the digitisation of their associated technologies, VFX have been responsible for multiplying the strategies of re-presentation and story-telling as well as extending the range of stories that can potentially be told on screen. By the same token, the visual standards of the Hollywood film’s production and exhibition have been growing in sophistication. -

Banos.10.3.P2alfinal Maquetación 3
RMC Original JMM Ingeniería genética en el cine: el caso de las quimeras Gemma Rodríguez, Josep-E Baños Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona (España). Correspondencia: Josep-E Baños. Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud. Universitat Pompeu Fabra. Dr. Aiguader 88. 08003 Barcelona (España). e-mail: [email protected] Recibido el 9 de enero de 2014; aceptado el 29 de enero de 2014 Resumen El desarrollo de la genética molecular durante la segunda mitad del siglo XX ha permitido plantear situa- ciones que hasta entonces se mantenían dentro de la biociencia ficción. Entre ellas se encuentra la posi- bilidad de realizar quimeras mediante la combinación de material genético. El cine ha reflejado repetida- mente esta posibilidad a partir de obras literarias o directamente de guiones cinematográficos. El pre- sente artículo analiza algunas películas que ayudan a comprender las creencias sociales sobre las quimeras a lo largo del último siglo. Se consideran La isla de las almas perdidas/Island of lost souls (1932) de Erle C. Kenton, La isla del Doctor Moreau/ The island of doctor Moreau (1977) de Don Taylor, La mosca/ The fly en las versions de Kurt Neumann (1958) y de David Cronenberg (1986), Mimic (1997) de Guillermo del Toro y Splice. Experimento mortal/ Splice (2009) de Vincenzo Natali. Las principales conclu- siones del análisis son la presencia de una visión negativa a la posibilidad de construir quimeras con argu- mentos similares en la crítica de Frankenstein, así como una aproximación prácticamente ausente a la posible utilidad de seres de tales características. -

A Look Into the Cockpit of the Fly: Visual Orientation, Algorithms, and Identified Neurons
The Journal of Neuroscience, November 1993, 13(11): 4563-%574 Feature Article A Look into the Cockpit of the Fly: Visual Orientation, Algorithms, and Identified Neurons Martin Egelhaaf and Alexander Borst Max-Planck-lnstitut fijr biologische Kybernetik, 72076 Tiibingen, Germany The top-down approach to understanding brain function seeks starting point for a behavioral analysis (Fig. 1A) (e.g., Land and to account for the behavior of an animal in terms of biophysical Collett, 1974; Wehrhahn et al., 1982; Wagner, 1986a,b; Zeil, properties of nerve cells and synaptic interactions via a series 1986). Free-flight behavior, however, is usually too complex for of progressively reductive levels of explanation. Using the fly a sufficiently detailed visual input-motor output analysis in- as a model system, this approach was pioneered by Werner tended to elucidate the underlying computational processes. Such Reichardt and his colleagues in the late 1950s. Quantitative detailed analyses became possible with the development of a input-output analyses led them to formal algorithms that related flight simulator (Fig. 1B) (Fermi and Reichardt, 1963; GBtz, the input of the fly’s eye to the orientation behavior of the 1964). This device measures the torque exerted by the fly in animal. But it has been possible only recently to track down the tethered flight, while the visual environment can be manipulated implementation of part of these algorithms to the computations in an arbitrary way. Under these restrictive conditions, the fly performed by individual neurons and small neuronal ensembles. still exhibits its basic orientation behavior, thus allowing de- Thus, the visually guided flight maneuvers of the fly have turned termination of quantitative stimulus-response relationships for out to be one of the few cases in which it has been feasible to the analysis of compensatory course stabilization and orienta- reach an understanding of the mechanisms underlying a com- tion behavior. -
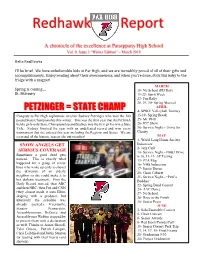
Redhawk Report
Redh awk Report A chronicle of the excellence at Parsippany High School Vol. 9, Issue 3 “Winter Edition” – March 2019 Hello RedHawks I’ll be brief. We have unbelievable kids at Par High, and we are incredibly proud of all of their gifts and accomplishments. Enjoy reading about their awesomeness, and when you’re done, stick this baby to the fridge with a magnet! MARCH Spring is coming…. 18- No School (PD Day) Dr. Mulroony 19-22- Spirit Week 22- Pep Rally 28, 29, 30- Spring Musical APRIL PETZINGER = STATE CHAMP 4- SPIKE Volleyball Tourney Congrats to Par High sophomore wrestler Sydney Petzinger who won the 100 15-19- Spring Break pound State Championship this winter. This was the first year that the NJSIAA 25- Mr. PHS held a girls-only State Championship and Sydney was the first girl to win a State 26- ICC Show Title. Sydney finished the year with an undefeated record and won every 30- Service Night – Trivia for tournament that she entered this year including the Regions and States. We are Charity so proud of the historic season she put together! MAY 1- World Lang Honor Society SNOW ANGELS GET Inductions 2- Jazz Café SERIOUS COVERAGE 10- Service Night – PB&J Drive Sometimes a good deed gets 6-10, 13-17- AP Testing noticed. This is exactly what 13- PTA Mtg happened for a group of senior 16- NHS Inductions boys who woke up early to shovel 17- Junior Dinner the driveway of an elderly 20- Choir Cabaret neighbor so she could make it to 21- Service Night – “Pete’s her dialysis treatment. -

The Alledger Volume 09, Number 07 the Alledger
Boston College Law School Digital Commons @ Boston College Law School The Alledger Law School Archive 2-23-1989 The Alledger volume 09, number 07 The Alledger Follow this and additional works at: https://lawdigitalcommons.bc.edu/alledger Part of the Legal Education Commons, and the Legal History Commons Recommended Citation The Alledger, "The Alledger volume 09, number 07" (1989). The Alledger. 147. https://lawdigitalcommons.bc.edu/alledger/147 This Book is brought to you for free and open access by the Law School Archive at Digital Commons @ Boston College Law School. It has been accepted for inclusion in The Alledger by an authorized administrator of Digital Commons @ Boston College Law School. For more information, please contact [email protected]. Client Co_unciling ChaIDpions: Tan and Well Rested by Jan McNitt on that for the next round and -"simulcast" of the competition fi to recognize those who are good On a sunny Sunday afternoon really try to wow the judges nals broadcast to room 411. at it, and promote the view that while the rest of us were study although, we sometimes ended After being declared the win a balance between analytical and ing, four 1-L's were vying for the up doing worse on techniques we ners, Waxman commented, "Say other lawyering skills is impor championship in the 12th BCLS had done well on before.'' we were tan and well-rested. tant to being an effective practi Client Counseling Competition. The techniques of Waxman [David] Letterman says that's tioner," Smith said. Winners Michael Waxman and BCLS's record at Regional Lawrence Jacobson, who said competitions has been strong, they originally entered the con and the team usually gets to the test "on a goof," will represent regional finals, Smith said. -

Youtube Action/Horror/Sci-Fi Movies
YOUTUBE ACTION/HORROR/SCI-FI MOVIES 2OCT2014, edited by PEARSCH, IAeSR. v3.4 This document (remember to clear cookies to see the latest vs. of this page.) Fast Search (cut-n-paste into Cntrl-F) ACTION, ACTORS, ADVENTURE, ANIMATED, APOCALYPTIC & POST APOCALYPTIC, BIBLE, COMEDY, CONSPIRACY, CRIME, DOCUMENTARY, DRAMA, END OF THE WORLD / ARMAGEDDON, FAMILY, FANTASY, HORROR, KUNG FU / MARTIAL ARTS, MISC., MONSTERS, MUSICAL / MUSIC, MYSTERY, ROMANCE, SCI-FI, Sound Tracks, SPORTS, SURVIVAL, THRILLER, TIME TRAVEL, WAR / WORLD WAR, WAR SURVIVAL, WESTERNS Watch MOVIES: Making your video library obsolete one link at a time. Note: Some links are inactive due to copyright issues. Hard copy; Soft copy; Great for kids Anime Good movies… TOOLS: AdBlock PLUS; Ghostery; SITES: HULU; Megashare; Netflix; Putlocker; Xfinity; YouTube; ABC; CBS; FOX; NBC; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- 3D clips ONE PIECE 3D FULL MOVIE 7 anaglyph 3d movies R/B PlRANHA 3D 23 3D ANAGLYPH videos R/B Plan 9 From Outer Space (1959) R/B 55 3D MOVIES R/B Robinson Crusoe 3D Animation Short 200 Popular Anaglyph 3D Videos R/B Roller Coaster - Dominator R/B Aatma (Haunted) 3D | Horror Movie Rollercoaster: Falcon (3D Glasses ANAGLYPH 3D ANIMATION MOVIE - needed) HIGH QUALITY-BLENDER R/B Ryse Son of Rome 3D Anaglyph Movies R/B Sadako 3D - 貞子 3D Horror, School, Awesome 3D Animation Movie R/B Teen, Japanese Creature 3d StreetDance 3D Dementia 13 (1963) R/B THE CHASE 3D ANIMATION SHORT Dora The Explorer 3D The Devil Bat (1940) R/B Dracula (3D) (2012) Hindi The Hobbit 3D Finding Nemo 2003 1080p Blueray 3D The Screaming Skull R/B Full Moon 3D anaglyph go around R/B The Nutcracker in 3D (2010) HORROR MOVIES - CLINIC The Portal (2013) How to Watch 3D Movies on Any The Shroud of Turin (True 3D) R/B PC,LAPTOP,DESKTOP The Universe in 3D R/B Kung fu Panda 2 - 3D Walking With Dinosaurs 3D Official Most See 3d Real Michael Jackson Hd. -
0 HC 46.Indd
Historia Contemporánea 46: 333-373 ISSN: 1130-2402 AMÉRICA ANTE EL ESPEJO: UN ANÁLISIS TRANSVERSAL DE THE MAJESTIC (Frank Darabont, 2001) AMERICA IN FRONT OF THE MIRROR: A CROSS-SECTIONAL STUDY OF THE MAJESTIC (Frank Darabont, 2001) Rodrigo González Martín y José-Vidal Pelaz López Universidad de Valladolid Entregado el 20-2-2012 y aceptado el 24-4-2012 Resumen: Frank Darabont pretendía que The Majestic fuese un homenaje al cine y a los valores tradicionales de la sociedad americana. El film, que aborda la caza de brujas en el Hollywood de la segunda posguerra mundial, es anali- zado en el presente artículo desde una perspectiva fundamentalmente histórica pero atendiendo también a la amplia gama de referencias cruzadas, connotacio- nes y dobles sentidos presentes en la cinta, a las diferentes interpretaciones que admite y a las reflexiones que suscita. También se ha prestado atención a su en- caje en los contextos históricos, sociales, políticos y culturales en los que tuvo lugar su rodaje y su estreno, profundamente marcado por los acontecimientos que siguieron al 11 de septiembre de 2001 que, a su vez, plantean nuevas for- mas de acercarse a la película de Darabont. Palabras clave: Macartismo, Caza de Brujas, Listas Negras, Hollywood, Comunismo, Democracia. Abstract: Frank Darabont expected that The Majestic would be a tribute to the cinema and to the traditional values of the American society. The film, which deals with the witch-hunt in the Hollywood of the post-World War II era, is analyzed in this paper from a historical perspective but considering also the wide range of cross references, double meanings and connotations present in 334 Rodrigo González Martín y José-Vidal Pelaz López the film, the different interpretations it admits and the reflections it provokes. -

TITLE CALL NUMBER for Film Information, Follow This Link: Www
For film information, follow this link: www.imdb.com TITLE FORMAT CALL NUMBER (500) days of Summer DVD PN 1997.2 .F58 2009 (Un)qualified: how God uses broken people to do big things AB CD BV 4598.2 .F87 2016 *Batteries not included DVD PN 1997 .B377 B377 1999 21 DVD PN 1997.2 .A149 A149 2008 300 DVD PN 1997.2 .E79 T4744 2007 1408 DVD PN 1995.9 .H6 F6878446 2007 2012 DVD PN 1997.2 .T835 2010 2 fast 2 furious DVD PN 1997 .F377 F377 2003 2 guns BLU-RAY PN 1997.2 .A12 2013 2 guns DVD PN 1997.2 .A12 2013 2nd chance AB CD PS 3566 .A822 A614 2002 3:10 to Yuma DVD PN 1997.2 .A138 A138 2007 3 comedy film favorites. Dodgeball DVD PN 1995.9 .C55 V38 2014 V.3 3 comedy film favorites. The internship DVD PN 1995.9 .C55 V38 2014 V.1 3 comedy film favorites. The watch DVD PN 1995.9 .C55 V38 2014 V.2 3 days to kill DVD PN 1997.2 .A15 2014 4 classic film favorites : Affair to remember DVD PN 1997 .A1 F68 2014 V.1 4 classic film favorites : Laura DVD PN 1997 .A1 F68 2014 V.2 4 classic film favorites : A letter to three wives DVD PN 1997 .A1 F68 2014 V.3 4 classic film favorites : The three faces of Eve DVD PN 1997 .A1 F68 2014 V.4 4 film favorites. Western collective DVD PN 1997 .Y68 2010 4 Film favorites: Girl's night collection: Chasing liberty DVD PN 1997 .E88 2010 V.4 4 Film favorites: Girl's night collection: Cinderella story DVD PN 1997 .E88 2010 V.1 4 Film favorites: Girl's night collection: Sisterhood of the traveling pants DVD PN 1997 .E88 2010 V.3 4 Film favorites: Girl's night collection: What a girl wants DVD PN 1997 .E88 2010 V.2 4 for Texas DVD PN 1995.9 .W4 F62 2005 The 5th wave DVD PN 1997.2 .A15 2016 The 6th day DVD PN 1997 .S597 S597 2001 9-1-1. -

Cops Hunt for Weapon in Murder
Soldier No Rose garden Violence Army ‘enlists’ White gang kills Local fans think Pete Rose dying boy /5 got what he deserved /II black teen-ager /6 miattrljPBtpr Mpralb Friday, Aug. 25, 1989 Manchester, Conn. — A City of Village Charm Newsstand Price: 35 Cents LaPointe Cops hunt innocent, says kin for weapon ‘He didn’t do It,’ says brother of accused killer in murder By Nancy Concelman By Rick Santos herself as Giacomo’s Manchester Herald Manchester Herald sister-in-law had telephoned the Manchester Police Department HARTFORD — Rosair LaPoint A 27-year-old Manchester man at 7:48 p.m. warning them that Jr. said he almost had a heart who said he stabbed a boarding Giacom o had phoned her attack when he heard his brother house tenant in self-defense has husband. Giacomo’s brother had been accused of sexually been charged with murder, police Anthony, telling him he had assaulting and strangling 88- said. stabbed someone to death that year-old Bernice Martin. The charges against the only afternoon, according to the In an interview at Hartford suspect, 27-year-old John affidavit. Superior Court Thursday, La Giacomo of 166-G Homestead St., When Manchester police Point described his brother Ri were increased Thursday questioned Giacomo at the chard LaPointe as a loving, afternoon from first-degree Vernon station, he denied any giving man who frequently ran assault to murder. Giacomo is scuffle with Paul, and said he errands for Martin. charged with the slaying of created the story about the killing Martin was the grandmother of 49-year-old James Paul, whose to get attention and love from his Richard LaPointe’s wife. -

The Fly: Outbreak #5
Years ago, scientist Seth Brundle had a horrific accident when he tried to use his newly invented teleportation device and became a human- fly hybrid. His almost-human son, Martin, has continued the search for a cure, but those efforts have led to several dozen lab workers being exposed to the diseased blood of a hybrid. After weeks of quarantine in an abandoned hospital, each person has transformed into a hybrid seeking to escape and loose vengeance on the world… “The Book of Revelation” Written by Brandon Seifert & Denton J. Tipton Art by menton3 & David Stoupakis Lettered by Shawn Lee • Edited by Denton J. Tipton REGULAR COVER SUBSCRIPTION COVER art by art by menton3 Alberto Ponticelli colors by Andrew Elder Special thanks to Joshua Izzo and Nicole Spiegel at Twentieth Century Fox and Lauriel Earley for genetic engineering consultation. Based on characters created by George Langelaan. Ted Adams, CEO & Publisher Greg Goldstein, President & COO Facebook: facebook.com/idwpublishing Robbie Robbins, EVP/Sr. Graphic Artist Twitter: @idwpublishing Chris Ryall, Chief Creative Officer/Editor-in-Chief Matthew Ruzicka, CPA, Chief Financial Officer YouTube: youtube.com/idwpublishing Alan Payne, VP of Sales Dirk Wood, VP of Marketing Tumblr: tumblr.idwpublishing.com www.IDWPUBLISHING.com Lorelei Bunjes, VP of Digital Services Instagram: instagram.com/idwpublishing IDW founded by Ted Adams, Alex Garner, Kris Oprisko, and Robbie Robbins Jeff Webber, VP of Digital Publishing & Business Development THE FLY: OUTBREAK #5. JULY 2015. FIRST PRINTING. The Fly II © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. © 2015 Idea and Design Works, LLC. IDW Publishing, a division of Idea and Design Works, LLC. -

The Carroll News
John Carroll University Carroll Collected The aC rroll News Student 3-2-1989 The aC rroll News- Vol. 76, No. 5 John Carroll University Follow this and additional works at: http://collected.jcu.edu/carrollnews Recommended Citation John Carroll University, "The aC rroll News- Vol. 76, No. 5" (1989). The Carroll News. 928. http://collected.jcu.edu/carrollnews/928 This Newspaper is brought to you for free and open access by the Student at Carroll Collected. It has been accepted for inclusion in The aC rroll News by an authorized administrator of Carroll Collected. For more information, please contact [email protected]. The Carroll News Vol. 76, No. 5 John Carroll University, University Heights, Ohio 44118 Thursday, March 2, 1989 Ritter gains top office i b Ch . 0 . pends on finances. unue things hke Club Coca-Cola, Y ns ro1em Ritter said that two concerts the Chnstmas formal, comedians Copy Editor next year arc not out of the scope in the Wolf and POL and Jello Gary Ritter, a finance major ofthe Union'sability ,even though wrestling," Lynch said. "It will be from Brooklyn, Ohio and the jun- this year's officers found a con- a constant challenge to get stu ior class president, was elected cert financially impossible. One dents interested in alternative, non Student Un1on prcsiclem in school- reason lhat there was no concert alcoholic events." wide general elections held Feb. this year was because it was a year Riuer said that one change in 20 and 21. ofLransiuonandconsequenlly few the planning stages concerns the Ritter defeated Bob Kasunic, risks were taken, he sa1d.