Hansische Umschau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Antler Combs from the Salme Ship Burials: Find Context, Origin, Dating and Manufacture
Estonian Journal of Archaeology, 2020, 24, 1, 3–44 https://doi.org/10.3176/arch.2020.1.01 Heidi Luik, Jüri Peets, John Ljungkvist, Liina Maldre, Reet Maldre, Raili Allmäe, Mariana MuñozRodríguez, Krista McGrath, Camilla Speller and Steven Ashby ANTLER COMBS FROM THE SALME SHIP BURIALS: FIND CONTEXT, ORIGIN, DATING AND MANUFACTURE In 2008 and 2010, two partly destroyed ship burials were discovered near Salme on the island of Saaremaa. During the archaeological excavations, at least 41 wholly or partially preserved skeletons were discovered, and a large number of artefacts were found, including a dozen singlesided antler combs. On the basis of the finds, as well as radiocarbon dating, the ship burials were dated to the PreViking Period, while both the isotopic and archaeological evidence point towards central Sweden as the most probable origin of the buried individuals. The combs from Salme have features that are generally consistent with the 8th century, with the closest parallels coming from the Mälar region of central Sweden. According to ZooMS and aDNA analyses, they are made of elk (Alces alces) and reindeer (Rangifer tarandus) antler. Elk inhabited the Mälar region, but reindeer antler had its origin in more northern regions. Most combs were clearly manufactured with great skill, and finished with care, though some details indicate differences in the skills of comb makers. Heidi Luik, Archaeological research collection, Tallinn University, 10 Rüütli St., 10130 Tallinn, Estonia; [email protected] Jüri Peets, Archaeological research -

Estonia Estonia
Estonia A cool country with a warm heart www.visitestonia.com ESTONIA Official name: Republic of Estonia (in Estonian: Eesti Vabariik) Area: 45,227 km2 (ca 0% of Estonia’s territory is made up of 520 islands, 5% are inland waterbodies, 48% is forest, 7% is marshland and moor, and 37% is agricultural land) 1.36 million inhabitants (68% Estonians, 26% Russians, 2% Ukrainians, % Byelorussians and % Finns), of whom 68% live in cities Capital Tallinn (397 thousand inhabitants) Official language: Estonian, system of government: parliamen- tary democracy. The proclamation of the country’s independ- ence is a national holiday celebrated on the 24th of February (Independence Day). The Republic of Estonia is a member of the European Union and NATO USEFUL INFORMATION Estonia is on Eastern European time (GMT +02:00) The currency is the Estonian kroon (EEK) ( EUR =5.6466 EEK) Telephone: the country code for Estonia is +372 Estonian Internet catalogue www.ee, information: www.1182.ee and www.1188.ee Map of public Internet access points: regio.delfi.ee/ipunktid, and wireless Internet areas: www.wifi.ee Emergency numbers in Estonia: police 110, ambulance and fire department 112 Distance from Tallinn: Helsinki 85 km, Riga 307 km, St. Petersburg 395 km, Stockholm 405 km Estonia. A cool country with a warm heart hat is the best expression of Estonia’s character? Is an extraordinary building of its own – in the 6th century Wit the grey limestone, used in the walls of medieval Oleviste Church, whose tower is 59 metres high, was houses and churches, that pushes its way through the the highest in the world. -
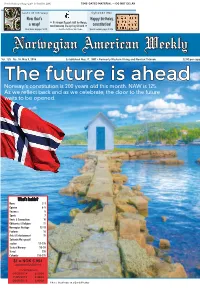
05-09-14Two Sections.Indd
(Periodicals postage paid in Seattle, WA) TIME-DATED MATERIAL — DO NOT DELAY Taste of Norway Syttende Mai Now that’s Happy birthday, « Vi svinger flagget stolt for Norge, a wrap! med hurrarop ifra syd og til nord. » constitution! Read more on pages S8-S9 – Grethe Myhre Skottene Special section: pages S1-S16 Norwegian American Weekly Vol. 125 No. 18 May 9, 2014 Established May 17, 1889 • Formerly Western Viking and Nordisk Tidende $2.00 per copy The future is ahead Norway’s constitution is 200 years old this month. NAW is 125. As we reflect back and as we celebrate, the door to the future waits to be opened. What’s inside? News 2-3 Opinion 4-5 Business 6 Sports 7 Roots & Connections 10 Obituaries & Religion 11 Norwegian Heritage 12-13 Features 14 Arts & Entertainment 15 Syttende Mai special section S1-S16 Taste of Norway S8-S9 Travel S10 Calendar S14-S15 $1 = NOK 5.954 updated 05/05/2014 In comparison 04/05/2014 6.0034 11/05/2013 5.9854 05/05/2013 5.8008 Photo: (boathouse on a fjord) Pixabay 2 • May 9, 2014 norwegian aMerican weekly NyhETEr Fra NorgE Nyheter Støtte for Syria-milliard Lo mener Fremskrittspartiet vil ha poker-NM og kasino på øya Munkholmen Stortinget støtter Arbeiderpartiets forslag regjeringen er Frp fikk i regjeringsforhandlingene med Høyre gjennomslag for å tillate kvinnefiendtlig pokerturneringer med pengeinnsats i Norge. Nestleder Per Sandberg deltok Regjeringen vil stryke selv i poker-NM i Dublin i april og kunne etter turneringen garantere at punktet om likelønn i det blir NM hjemme i Norge allerede neste år. -

Skanfils Heureka-Auksjon 5
Skanfils Heureka-auksjon 5 Lørdag 10. mars 2018 kl. 10.00 Auksjonen avholdes på Stølsmyr 10, 5542 Karmsund (Posten- / Bringterminalen) Velkommen til Skanfils Heureka-auksjon 5 ! Endelig er ventetiden over! Nytt år og nye muligheter. La skattejakten starte med Skanfils første Heureka-auksjon for 2018. Vi har igjen fått samlet inn et rikholdig utvalg av antikviteter, samlerobjekter og interiør, så her skal det være noe for enhver samler og lommebok. Også denne gang er det lagt ut ca. 1000 objekter uten noen minstepris, og vi starter på 1 krone. I tillegg har vi også et utvalg med objekter på vår aveling for Heureka+, med utropspris fra 5000 kr og oppover (se side 20-23). Budgivningen er allerede i gang på nett, og det er mulig å by helt frem til auksjonsstart lørdag 10. mars. Ønsker du hjelp til å legge inn bud? Kontakt oss, og vi hjelper deg gjerne. Har du ting du ønsker å selge på en av våre mange auksjoner? Da vil vi gjerne høre fra deg. Til slutt vil vi i Heureka teamet si lykke til med budgivningen og vel møtt til visning i våre lokaler på Stølsmyr 10 i Haugesund. Heureka-auksjon nr. 5. starter 10. mars kl 10.00. Hilsen Heureka-teamet. AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE HEUREKA-LOKALER; STØLSMYR 10, 5542 KARMSUND Starttidspunkt: The auction starts: Lørdag 10. mars: kl. 10.00 Saturday March 10: 10.00 Forhåndsbud bør være oss i hende: Bids should be received by: Skriftlig/telefonisk: Fredag 9. mars kl. 15.30 Mail-bid/phone/fax: Friday March 9 at 15.30. -

Ager Library Author List -- September, 2016
Ager House Resource Library Ager Library Author List -- September, 2016 Personal name Title Statement Call Number "Fram" Expedition : Nansen i den frosne G 700.N22 F7 verden; Reise over Nord Grønland med Løitnant R. E. Peary. 52 Søndagsmiddager. TX 722.N6 Bente's gammaldansorkester [Sound CD 103 recording (CD)]. Beretning am Hauges Synodes 72de Aarsmøde, BX 8054.A29 den Norske Synodes 32te : Ordentige Synode møde....Organisations-mødet for den Norsk Lutherske Kirke i Amerika. Beretning om det 18de ordentligesynodemøde BX 8052.A3 i østlige distrikt af synoden for den norsk-evangelisk-lutheriske kirke i Amerika av holdt i Chicago, Ill fra 26de mai til 1ste juni, 1904. Beretning om det ekstraordinære synodemøde BX 8052.A3 af synoden for den norsk-evangelisk-lutheriske kirke i Amerika av holdt i San Francisco, Cal. fra 30te mai til 6the juni, 1915. Charming Oslo. DL 581.C5 De hjem vi forlod og de hjem vi fandt : To DL 449.H67 c2 bøger i et royal octavbind. De hjem vi forlod og de hjem vi fandt : to DL 449.H67 bøger i et royal oktavcbind. Den Norske Farmakopø. R 85.N4 Den norske studentersangsforenings Koncert E 168.N76 tourne gjennem det norske Amerika, i Mai or Juni 1905. Den syungende mand paa sjø og land. PT 8619.S63 Evangelisk Læsebok for Børn. BS 556.N8 Folkets Almanak for det aar efter Kristi AY 974.A65 Fødsel 1956 : Som er skudaar beregnet til Kobenhavns Observatoriums Horisont. Freia bakepulver : godt, drøit og billig. TX 722.N6 Freia opskriftbok. TX 722.N6 Gjærbakst. TX 722.N6 Grundtvigs sangbog for det danske folk i M 2132.N5 Amerika. -

Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation Vol
VOL. 1 2005–2012 ESTONIAN CULTURAL HERITAGE PRESERVATION AND CONSERVATION CITYSCAPE / PUBLIC AND RESIDENTIAL BUILDINGS / CHURCHES / MANORS INDUSTRIAL HERITAGE / TECHNOLOGY / ARCHAEOLOGY INTERNATIONAL COOPERATION1 / MISCELLANY VOL. 1 2005–2012 ESTONIAN CULTURAL HERITAGE. PRESERVATION AND CONSERVATION AND CONSERVATION PRESERVATION HERITAGE. CULTURAL 1 ESTONIAN VOL. 2005–2012 Editors-in-chief: MARI LOIT, KAIS MATTEUS, ANNELI RANDLA ESTONIAN Editorial Board: BORIS DUBOVIK, LILIAN HANSAR, HILKKA HIIOP, MART KESKKÜLA, JUHAN KILUMETS, ILME MÄESALU, MARGIT PULK, CULTURAL HERITAGE TÕNU SEPP, OLEV SUUDER, KALEV UUSTALU, LEELE VÄLJA PRESERVATION AND CONSERVATION Translated by SYNTAX GROUP OÜ Graphic design and layout by TUULI AULE Published by NATIONAL HERITAGE BOARD, TALLINN CULTURE AND HERITAGE DEPARTMENT, DEPARTMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION AT THE ESTONIAN ACADEMY OF ARTS Supported by THE COUNCIL OF GAMBLING TAX Front cover: The main stairway of the former Estländische adelige Credit-Kasse. Photo by Peeter Säre Fragment of the land use plan of the comprehensive plan of the old town of Narva 15 Seaplane hangars. Photo by Martin Siplane 29 Detail from a coat-of-arms epitaph in Tallinn Cathedral. Photo by the workshop for conserving the coats-of-arms collection of Tallinn Cathedral 65 Laupa Manor. Photo by Martin Siplane 93 Carpentry workshop of the Rotermann Quarter. 7 Rosen Str, Tallinn. Photo by Andrus Kõresaar 117 Lead sheet on the lantern at the façade of the Tallinn Great Guild Hall. Photo by Martin Siplane 133 13th c. merchant’s -

Isotopic Provenancing of the Salme Ship Burials in Pre-Viking Age Estonia T
Isotopic provenancing of the Salme ship burials in Pre-Viking Age Estonia T. Douglas Price1,Juri¨ Peets2, Raili Allmae¨ 2, Liina Maldre2 &EsterOras3 Ship burials are a well-known feature of Scandinavian Viking Age archaeology, but N the discovery of 41 individuals buried in two ships in Estonia belongs to the Pre-Viking period and is the first of its kind in Europe. Tallinn The two crews met a violent end around AD 750, and were buried with a variety Salme of richly decorated weapons, tools, gaming pieces and animal bones. The rich grave goods suggest that this was a diplomatic delegation protected by a cohort of elite warriors. They were armed with swords of Scandinavian design, possibly from the Stockholm-Malaren¨ 0 km 500 region, and stable isotope analysis is consistent with that being the probable homeland of the crew. Keywords: Estonia, Pre-Viking Age, isotopic analysis, ship burial, grave goods Introduction Salme is a small coastal village on the island of Saaremaa in western Estonia, on the eastern side of the Baltic Sea (Figure 1). In the summer of 2008, workmen exposed extraordinary archaeological finds, including human skeletal remains, iron swords and rivets, and bone gaming pieces. The objects were dated to around AD 750, the end of what is known in Estonia as the Pre-Viking Age, and in Sweden as the Vendel Period and the beginning of the Viking Age. None of the artefacts was of local origin, and a number of them exhibited a style associated with archaeological materials from Scandinavia, across the Baltic Sea (Konsa et al. -

Okręty Wojenne Nr
Dwumiesięcznik W NUMERZE Vol. XIX, Nr 1/2012 (111) ISSN‑1231‑014X, Indeks 386138 Redaktor naczelny Michał Jarczyk Jarosław Malinowski Cesarskie „fabryki cementu”, część II 2 Kolegium redakcyjne Rafał Ciechanowski, Michał Jarczyk, Maciej S. Sobański Aleksiej Pastuchow, Siergiej Patianin Współpracownicy w kraju 8 Chińskie krążowniki pancernopokladowe Andrzej S. Bartelski, Jan Bartelski, typu „Zhiyuan” Stanisław Biela, Jarosław Cichy, Andrzej Danilewicz, Józef Wiesław Dyskant, Maciej K. Franz, Przemysław Federowicz, Jarosław Jastrzębski, Rafał Mariusz Kaczmarek, Krzysztof Dąbrowski Jerzy Lewandowski, Oskar Myszor, Andrzej Nitka, Piotr Nykiel, Japońskie krążowniki pancerne 18 Grzegorz Ochmiński, Jarosław Palasek, typów „Tsukuba” i „Ibuki”, część II Jan Radziemski, Marek Supłat, Tomasz Walczyk, Kazimierz Zygadło Współpracownicy zagraniczni Maciej S. Sobański BELGIA 24 Zapomniane krążowniki Royal Navy, część II Leo van Ginderen CZECHY Ota Janeček FRANCJA Gérard Garier, Jean Guiglini Jarosław Jastrzębski, Jakub Polit HISZPANIA 34 Alejandro Anca Alamillo Konferencja Waszyngtońska LITWA 12 XII 1921 – 6 II 1922, część I Aleksandr Mitrofanov NIEMCY Richard Dybko, Hartmut Ehlers, Jürgen Eichardt, Christoph Fatz, Hartmut Ehlers Zvonimir Freivogel, Reinhard Kramer 43 Marynarka Wojenna i Paramilitarne ROSJA Siły Morskie Estonii 1918-1940, część I Siergiej Bałakin, Nikołaj Mitiuckow, Siergiej Patianin, Konstantin Strielbickij STANY ZJEDNOCZONE. A.P. Arthur D. Baker III Roman Kochnowski UKRAINA Anatolij Odajnik, Władimir Zabłockij Niezwykłe pojedynki 55 WŁOCHY Maurizio Brescia, Achille Rastelli Andrij Kharuk 65 Brytyjskie niszczyciele typu „Battle”, Adres redakcji Wydawnictwo „Okręty Wojenne” część IV Krzywoustego 16, 42‑605 Tarnowskie Góry Polska/Poland tel: +48 32 384‑48‑61 www.okretywojenne.pl e‑mail: [email protected] Ireneusz Bieniecki Uprowadzenia jednostek pływających na 72 Skład, druk i oprawa: DRUKPOL sp. j. -

Sword Parts and Their Depositional Contexts - Symbols in Migration and Merovingian Period Martial Society Fischer, Svante Et Al
Sword parts and their depositional contexts - Symbols in Migration and Merovingian Period martial society Fischer, Svante et al. Fornvännen 2013, s. 109-122 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2013_109 Ingår i: samla.raa.se Artikel Fischer et al s 109-122:Layout 1 13-05-31 09.54 Sida 109 Sword parts and their depositional contexts – Symbols in Migration and Merovingian Period martial society By Svante Fischer, Jean Soulat and Teodora Linton Fischer Fischer, S.; Soulat, J. & Linton Fischer, T., 2013. Sword parts and their deposition- al contexts – symbols in Migration and Merovingian Period martial society. Forn- vännen 108. Stockholm. A key feature of swords from the Migration and Merovingian Periods is that they consist of many different parts, as recently highlighted by the discovery of the Staffordshire hoard. This paper seeks to understand sword parts and their deposi- tional contexts by interpreting them as symbols of kleptocracy, animated by their object biographies in a martial society. This is done by evaluating four important finds from Sweden: a stray intact sword from Scania, a cremation grav e from He- berg in Halland, a wetland deposit from Snösbäck in Västergötland, and the settle- ment finds from Uppåkra in Scania. The presence of the various different parts varies substantially in the different kinds of contexts. In particular, the Uppåkra settlement is missing hundreds of sword parts that ought to have been there given the professional excavations and systematic metal-detecting over many years there. This allows for the interpreta- tion of the Uppåkra sword parts as the remains of a battlefield of about AD 600 where most of the sword parts were removed from the site shortly after the battle. -

Physical Anthropology and Bioarchaeology at the Institute of History in the Last 20 Years R
Papers on Anthropology XXVIII/2, 2019, pp. 9–20 Physical anthropology and bioarchaeology at the Institute of History in the last 20 years R. Allmäe, J. Limbo-Simovart, L. Heapost PHYSICAL ANTHROPOLOGY AND BIOARCHAEOLOGY AT THE INSTITUTE OF HISTORY IN THE LAST 20 YEARS Raili Allmäe, Jana Limbo-Simovart, Leiu Heapost Archaeological Research Collection, Tallinn University, Tallinn, Estonia ABSTRACT Human populations and their history have been studied at the Institute of His- tory since 1952 when the young researcher Karin Mark started her career here. Later, Karin Mark became a leading researcher in palaeoanthropology and somatology of Finno-Ugric peoples, and her working group grew. At the end of the 1980s, Leiu Heapost took over the position as group leader in anthropo- logical research. In 1988 Raili Allmäe and in 2004 Jana Limbo-Simovart joined the group. Since 1998, Estonian research has been project-based; in the present paper we give a brief overview of our anthropological research at the Institute of History (and its descendants) in the last twenty years. Keywords: Institute of History; physical anthropology; Estonia; bioarchaeology; human populations INTRODUCTION Past and modern human populations have been studied at the Institute of His- tory since 1952 when young researcher Karin Mark started her career here. Later, Karin Mark became a leading researcher in palaeoanthropology and somatology of Finno-Ugric peoples [42], and her working group grew. In pre- sent paper, we give an overview of the research conducted by the group of anthropologists who have worked at the Institute of History (at Tallinn Uni- versity) during the last two decades. -

Årbog 2007 December 2007
Årbog 2007 December 2007. Årgang 36 nr. 5 ISSN 0905 - 1635 Vikingeskibsmuseets Áttamannafar TROLLE for fuld maskine i 20 sekundmeter. Foto: Werner Karrasch REDAKTIONEN: Redaktør Per Hjort, St.Karlsmindevej 143, 3390 Hundested 4777 2311 [email protected] Grafiker Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 [email protected] Jollestof Ulf Brammer, Møllehaven 44, 4300 Holbæk 5945 1015 / 2589 1080 [email protected] Kalender Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 [email protected] Annoncer Se under sekretariatet næste side TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGENS BESTYRELSE: Formand Poul-Erik Clausen, Karetmagerstien 3, 8400 Ebeltoft 8634 2688 / 2339 3123 [email protected] Næstformand Charsten Karger, Skattergade 30, 5700 Svendborg 6252 2866 [email protected] Kasserer Egon Hansen, Høje Gladsaxe 26, 2.tv, 2860 Søborg 3969 1290 / 2148 7159 [email protected] Best.medlem Jørn Hansen, Kirkevej 14, Strynø, 5900 Rudkøbing 2140 0374 [email protected] Best.medlem Gert Iversen, Havebyen Mozart 34, 2450 SV 3646 7406 / 2016 1089 Best.medlem Ole Brauner, Eskjærsvej 10, 7800 Skive 9753 1331 [email protected] Best.medlem Mogens Høirup, Lucienhøj 16 a, 5600 Faaborg 6261 2776 [email protected] 1.suppleant Alexander Feirup, Sundsdahlvej 41, 7620 Lemvig 2484 2646 [email protected] 2.suppleant Nis-Edwin List-Petersen, Møllevænget 19, Hostrupskov, 6200 Aabenraa, 40173132 [email protected] Revisor Kirsten Hjort, Løjtoftevej 189, 4900 Nakskov 4156 9013 [email protected] Revisor.supp.Sv. Erik Haase, Hvidtjørnen -

Human Remains, Context, and Place of Origin for the Salme, Estonia, Boat Burials T
Journal of Anthropological Archaeology 58 (2020) 101149 Contents lists available at ScienceDirect Journal of Anthropological Archaeology journal homepage: www.elsevier.com/locate/jaa Human remains, context, and place of origin for the Salme, Estonia, boat burials T T. Douglas Pricea, Jüri Peetsb, Raili Allmäeb, Liina Maldreb, Neil Pricec a Laboratory for Archaeological Chemistry, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, USA b Archaeological Research Collection, Tallinn University, Rüütli 6, 10130 Tallinn, Estonia c Department of Archaeology and Ancient History, University of Uppsala, Box 626, 75126 Uppsala, Sweden ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Isotopic proveniencing of all individuals from the ship and boat burials at Salme, Estonia, is the subject of this Viking study of the interred human remains from around AD 750, at the beginning of the Viking period. The isotopic Isotopic proveniencing results indicate that the majority of these individuals came from a region with higher strontium isotopic ratios Strontium than those found in Estonia. There were five individuals, buried in Salme II—the ship burial with 34 in- Ship burial dividuals—who exhibited lower strontium isotope ratios that might have come from the Swedish island of Archaeology Gotland or several other possible places. The combination of isotopic signals and archaeological information suggests that the majority of buried individuals (those with higher strontium isotope ratios) came from the Mälaren Valley in east-central Sweden. 1. Introduction 550–950 (Bill, 2019). The custom of ship burial spread in Northern Europe during the Vendel Period and became common in the Viking Boat and ship burial are well-known features of Viking-Age funerary Age (750–1050 CE).