Die Küste, 22 (1972), 29-74
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ausflugsfahrten 2021
RegelnCOVID-19 im Innenteil Fahrkarten Online unter wattenmeerfahrten.de oder im Vorverkauf: Föhr-Amrumer Reisebüro (Wyk), Tourist-Informationen (Wyk, Nieblum, Utersum) List Sie können Ihre Fahrkarte auch am Schiff vor der Abfahrt erwerben, solange Plätze frei sind. Ausflugsfahrten Hallig Hooge Große Halligmeer-Kreuzfahrt Seetierfang MS Hauke Haien stellt sich vor Alle Schiffsabfahrts- und Ankunftszeiten gelten nur bei normalen Wind-, Wasser- und Sichtverhältnissen sowie genügender Beteiligung. Irrtum und Änderungen vorbehal- ten. Ankunftszeiten können auf Grund der Tide variieren. Es gelten die Beförderungs- Erwachsene Kinder (4-14 J) Familien* Erwachsene Kinder (4-14 J) Familien* Erwachsene Kinder (4-14 J) Familien* bedingungen der Halligreederei MS Hauke Haien. Wir, die Familie Diedrichsen, betreiben das Schiff seit 1988 2021 35 € 15 € 95 € 35 € 15 € 95 € 30 € 15 € 80 € und unser Heimathafen ist Hallig Hooge. Den Namen „Hau- ke Haien“ erhielt das Schiff nach der Hauptfigur aus Theodor Inkl. Seetierfang & Seehundsbänke (tideabhängig) Auf Hallig Gröde (1 Std. Landgang) · Seehundsbänke (tideabh.) Auf diesen Touren zeigen wir Ihnen die Unterwasserwelt. In der Für besondere Anlässe können Sie unser Schiff Wir wollen Sie auf Seereise zur Hallig Hooge mitnehmen. Am An- Unser Kurs geht ins östliche Wattenmeer vorbei an den Halligen Nähe der Wyker Küste wird ein Schleppnetz ausgeworfen und Storms Novelle „Der Schimmelreiter“. Unser Schiff wurde 1960 ab Wyk auf Föhr (alte Mole) leger können Fahrräder oder Kutschen gebucht werden, oder Sie Langeneß , Hooge, Oland, Gröde, Habel, Hamburger Hallig, Nord- der Seetierfang an Bord vom Kapitän oder der gebürtigen Nord- als erste Halligfähre von „Kapitän August Jakobs“ mit dem Na- auch chartern. Sprechen Sie uns gerneNiebüll an. -

Herzlich Willkommen!
HERZLICH WILLKOMMEN! Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie sich jetzt von uns verwöhnen und genießen Sie die einmalige Atmosphäre im Café Steigleder. Wir wünschen Ihnen eine genussreiche Zeit. Ob beim Frühstück, zur kleinen Mittagspause, zur Kaff eestunde oder zum Abendbrot. Seit 1919 verschreibt sich unser Familienbetrieb, mit viel Leidenschaft und einer ordentlichen Portion Hingabe, dem Echten Genuss. Unsere hauseigene Konditorei stellt eine verführerische Auswahl an Torten und Gebäck-Kreationen für Sie her. Bestellen Sie gleich am Kuchentresen – natürlich gibt es alles auch zum Mitnehmen. Sollten Sie von Allergien und/oder Unverträglichkeiten betroff en sein, können Sie sämtliche Information zu den in unseren Speisen und Getränken verwendeten Allergenen erhalten. Sprechen Sie uns einfach an! Da wir ein Handwerksbetrieb sind und alles bis auf wenige Ausnahmen selber herstellen ,weisen wir vorsichtshalber darauf hin, dass unsere Backwaren Spuren von Weizen oder Schalenfrüchte enthalten können. UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN Täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr nur von November bis April ist Mittwoch unser Ruhetag. Please ask our Service Kontakt venligst vores for the english menu. service til en dansk menu. FRÜHSTÜCK – AB 9:00 UHR – Gourmet Frühstück (für zwei) 24,90 4 Brötchen, Brot, Toast, Butter, Auswahl an Wurst- 5 und Käsespezialitäten , Rührei, geräucheter Lachs, Fleischsalat, hausgemachte Marmelade und Heiß- getränke einer Sorte satt. mit 2 Gläsern O-Saft (0,2l) 28,90 oder mit 2 Gläsern Sekt (0,1l) 31,40 Großes Kapitäns-Frühstück 14,60 2 Brötchen, Brot, Butter, Auswahl an Wurst- und 5 Käsespezialitäten ,geräucheter Lachs, 1 gekochtes Ei, hausgemachte Marmelade, 1 Glas O-Saft (0,1l) und 1 Heißgetränk (Kännchen) Wyker Frühstück 9,50 2 Brötchen, Brot, Butter, Auswahl an Wurst- 5 und Käsespezialitäten , hausgemachte Marmelade und 1 Heißgetränk (Kännchen) Alle Frühstücke werden liebevoll garniert. -

»Wattenmeer« Informationen Für Mitglieder Und Freunde Der Schutzstation Wattenmeer Ausgabe 2 | 2014
»wattenmeer« Informationen für Mitglieder und Freunde der Schutzstation Wattenmeer Ausgabe 2 | 2014 Missklang – Legale Meeresverschmutzung durch Paraffine Anklang – Neue Pellwormer Schutzstation Wohlklang – KüstenTon-Konzert mit hochkarätiger Besetzung Editorial 2 EDITORIAL Inhalt Liebe Paraffinverschmutzung Wattenmeerfreunde, im Nationalpark Wattenmeer 3 in diesen Tagen ist „unser Kleines“ fünf Naturschutzverwaltung. Küstenton – Benefizkonzerte für die Schutzstation 4 geworden. Kommt der Bürgermeister bei Die Auszeichnung ist eine große Verant- Die Stiftung zu Gast normalen menschlichen Geburtstagen am wortung für alle beteiligten Staaten. Sie ist in der Arche Wattenmeer 7 90sten zum Gratulieren, haben sich zur Symbol einer gemeinsamen Idee, die nur Gemeinsam für das Weltnaturerbe 7 Feier der halben Dekade „Weltnaturerbe ihren Wert behält, wenn Bevölkerung und Nationalparkstation Friedrichskoog Wattenmeer“ Landesministerin und evange- politische Entscheidungsträger dahinter renoviert 7 lischer Bischof angesagt. stehen. Wie schnell solche Prozesse kippen Stranddistel 8 Und sie haben einen besonderen Grund können, zeigt die bedenkliche Entwicklung Nachruf Gerd Kühnast 9 zur Freude: Seit dem 23. Juni ist nun das in Australien. Hier will die Regierung einen Zählung auf dem Blauort-Sand 10 gesamte internationale Wattenmeer Welt- milliardenteuren Hafen mitten im Weltnatur- naturerbe. Vom dänischen Esbjerg bis erbe „Great Barrier-Reef“ errichten. Eines Nationalparkstationen Büsum und Pellworm 11 zum niederländischen Den Helder hat die der größten Naturwunder dieser Erde, das Mischwatt 12 UNESCO eines der größten küstennahen auch wir gern und oft als Referenz für die Feuchtgebiete der Erde durchgängig als erreichte Bedeutung des Wattenmeeres in Titelbild: Erbe der Menschheit ausgezeichnet. der öffentlichen Wahrnehmung nennen. Ein fast zwei Kilometer langer Dünen- und Salzwiesen- Als letzte Bausteine kamen jetzt das dä- Beharrlichkeit ist angesagt. -

Bachelorarbeit Im Studiengang Naturschutz Und Landnutzungsplanung
Bachelorarbeit im Studiengang Naturschutz und Landnutzungsplanung. Zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) Im Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik An der Hochschule Neubrandenburg HALLIG NORDEROOG – KINDERSTUBE DER BRANDSEESCHWALBE- EINE BESTANDSAUFNAHME ZU DEN VEGETATIONSVERÄNDERUNGEN UND DEN DAMIT VERBUNDENEN AUSWIRKUNGEN AUF DAS BRUTVERHALTEN DER BRANDSEESCHWALBE Von: Stefanie Hansen betreut durch: Prof. Dr. Helmut Lührs Dipl.–Ing.(FH) Christel Grave Abgabetermin: 06.10.2016 urn:nbn:de:gbv:519-thesis2016-0232-0 Danksagung Ich möchte allen Menschen danken, die meinen Weg zu diesem Abschluss durch ihre Begleitung bereichert haben. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Helmut Lührs, der im dritten Semester meine Begeisterung für Vegetationskunde und Pflan- zensoziologie geweckt und seither gefördert hat. Für die intensive und sehr persönli- che Betreuung zu dieser Arbeit, danke ich Herrn Lührs sehr. Ganz besonders danke ich auch Frau Christel Grave für die kompetente und engagierte Betreuung und die freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich möchte mich bei den Mittarbeitern des Verein Jordsand im Haus der Natur für die nette Hilfe bei der Archivrecherche bedanken. Den Herren Bernd Sauerwein und Eberhard Klauck danke ich für die sehr nette und schnelle Hilfe bei der Nachbestimmung der rätselhaften Norderooger Quecken. Mein Dank geht auch an alle Vogelwarte/innen der vergangenen Jahrzehnte, ohne deren Einsatz der Seevogelschutz auf Norderoog und ohne deren Dokumentations- arbeit diese Bachelorarbeit nicht möglich gewesen wäre. Gleiches gilt für Hunderte von freiwilligen Workcampteilnehmer/innen, die mit ihrem selbst- und grenzenlosen Einsatz den Erhalt der Hallig sichern. Ich danke Christian dafür, dass er mir im Schreibprozess zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite stand. Allen Korrekturlesern gilt mein Dank ebenso. -

The Cultural Heritage of the Wadden Sea
The Cultural Heritage of the Wadden Sea 1. Overview Name: Wadden Sea Delimitation: Between the Zeegat van Texel (i.e. Marsdiep, 52° 59´N, 4° 44´E) in the west, and Blåvands Huk in the north-east. On its seaward side it is bordered by the West, East and North Frisian Islands, the Danish Islands of Fanø, Rømø and Mandø and the North Sea. Its landward border is formed by embankments along the Dutch provinces of North- Holland, Friesland and Groningen, the German state of Lower Saxony and southern Denmark and Schleswig-Holstein. Size: Approx. 12,500 square km. Location-map: Borders from west to east the southern mainland-shore of the North Sea in Western Europe. Origin of name: ‘Wad’, ‘watt’ or ‘vad’ meaning a ford or shallow place. This is presumably derives from the fact that it is possible to cross by foot large areas of this sea during the ebb-tides (comparable to Latin vadum, vado, a fordable sea or lake). Relationship/similarities with other cultural entities: Has a direct relationship with the Frisian Islands and the western Danish islands and the coast of the Netherlands, Lower Saxony, Schleswig-Holstein and south Denmark. Characteristic elements and ensembles: The Wadden Sea is a tidal-flat area and as such the largest of its kind in Europe. A tidal-flat area is a relatively wide area (for the most part separated from the open sea – North Sea ̶ by a chain of barrier- islands, the Frisian Islands) which is for the greater part covered by seawater at high tides but uncovered at low tides. -

Status, Threats and Conservation of Birds in the German Wadden Sea
Status, threats and conservation of birds in the German Wadden Sea Technical Report Impressum – Legal notice © 2010, NABU-Bundesverband Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. www.NABU.de Charitéstraße 3 D-10117 Berlin Tel. +49 (0)30.28 49 84-0 Fax +49 (0)30.28 49 84-20 00 [email protected] Text: Hermann Hötker, Stefan Schrader, Phillip Schwemmer, Nadine Oberdiek, Jan Blew Language editing: Richard Evans, Solveigh Lass-Evans Edited by: Stefan Schrader, Melanie Ossenkop Design: Christine Kuchem (www.ck-grafik-design.de) Printed by: Druckhaus Berlin-Mitte, Berlin, Germany EMAS certified, printed on 100 % recycled paper, certified environmentally friendly under the German „Blue Angel“ scheme. First edition 03/2010 Available from: NABU Natur Shop, Am Eisenwerk 13, 30519 Hannover, Germany, Tel. +49 (0)5 11.2 15 71 11, Fax +49 (0)5 11.1 23 83 14, [email protected] or at www.NABU.de/Shop Cost: 2.50 Euro per copy plus postage and packing payable by invoice. Item number 5215 Picture credits: Cover picture: M. Stock; small pictures from left to right: F. Derer, S. Schrader, M. Schäf. Status, threats and conservation of birds in the German Wadden Sea 1 Introduction .................................................................................................................................. 4 Technical Report 2 The German Wadden Sea as habitat for birds .......................................................................... 5 2.1 General description of the German Wadden Sea area .....................................................................................5 -

Reassessment of Long-Period Constituents for Tidal Predictions Along the German North Sea Coast and Its Tidally Influenced River
https://doi.org/10.5194/os-2019-71 Preprint. Discussion started: 18 June 2019 c Author(s) 2019. CC BY 4.0 License. Reassessment of long-period constituents for tidal predictions along the German North Sea coast and its tidally influenced rivers Andreas Boesch1 and Sylvin Müller-Navarra1 1Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg, Germany Correspondence: Andreas Boesch ([email protected]) Abstract. The Harmonic Representation of Inequalities is a method for tidal analysis and prediction. With this technique, the deviations of heights and lunitidal intervals, especially of high and low waters, from their respective mean values are represented by superpositions of long-period tidal constituents. This study documents the preparation of a constituents list for the operational application of the Harmonic Representation of Inequalities. Frequency analyses of observed heights and 5 lunitidal intervals of high and low water from 111 tide gauges along the German North Sea coast and its tidally influenced rivers have been carried out using the generalized Lomb-Scargle periodogram. One comprehensive list of partial tides is realized by combining the separate frequency analyses and by applying subsequent improvements, e.g. through manual inspections of long-time data. The new set of 39 partial tides largely confirms the previously used set with 43 partial tides. Nine constituents are added and 13 partial tides, mostly in close neighbourhood of strong spectral components, are removed. The effect of these 10 changes has been studied by comparing predictions with observations from 98 tide gauges. Using the new set of constituents, the standard deviations of the residuals are reduced by 2.41% (times) and 2.30% (heights) for the year 2016. -

Atlas Der Säugetiere Schleswig-Holsteins
Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins von Peter Borkenhagen Kiel 1993 Herausgeber: Landesamt für rledrhhalitzspu fndl eg e Schleswig-Holstein Hansaring 1 24145 Kiel Verfasser: Dr. Peter Borkenhagen Titelfotos, thrkee/ ar'rhzag ,Herstellung:If Druckerei Fotosatz Nord Mtland 8a 24109 Kiel November 1993 ISBN 3-923339-30-5 e‘l-Y 3 Der Umschlag dieser Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem, der Innenteil auf Recycling- papier gedruckt. Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung heraus- gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Personen, die Wahlwer- bung oder Wahlhilfe betreiben, im Wahlkampf zum Zweckeerwder V2fil- Werr2? "nd Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorste- henden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugun- sten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu ver- wenden. Vorwort Mit dem "Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins" gibt das Landesamt für Naturschutz und Landschafts- pflege nach dem "Atlas der Land- und Süßwassermollusken" einen weiteren ökologischen Atlas heraus, der Grundlage für ein modernes Biomonitoring wichtiger Tiergruppen sein kann. In diesem Biomonitoring werden vor allem biologische, ökologische und verbreitungsbezogene Daten über Organismen-Arten ein- gebracht. Ein solcher moderner Typ regionaler ökologischer Atlanten für möglichst alle Arten einer Orga- nismengruppe stellt eine wichtige und unverzichtbare Grundlage für den Artenschutz und die Methodik des Biotopschutzes dar. Hinzu kommt die Schaffung von Bewertungsmöglichkeiten bei der Effektivitätskontrol- le von umfassenden Naturschutzmaßnahmen und von Naturschutzprojekten. Das Kartenmaterial für jede Art zeigt auf, wo bestimmte Ansiedlungsräume aufgegeben oder wieder in Be- sitz genommen wurden. -
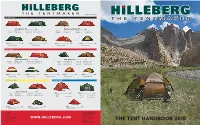
2015 Hilleberg Tent Handbook
All weights are packed weight BLACK LABEL Keron & Keron GT . Nammatj & Nammatj GT. Keron . kg/ lbs oz Keron GT . kg/ lbs oz Nammatj . kg/ lbs oz Nammatj GT . kg/ lbs oz Keron . kg/ lbs oz Keron GT . kg/ lbs oz Nammatj . kg/ lbs oz Nammatj GT . kg/ lbs oz Saitaris . Saivo . Tarra . Staika . . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz RED LABEL Kaitum & Kaitum GT . Nallo & Nallo GT . Kaitum . kg/ lbs oz Kaitum GT . kg/ lbs oz Nallo . kg/ lbs oz Nallo GT . kg/ lbs oz Kaitum . kg/ lbs oz Kaitum GT . kg/ lbs oz Nallo . kg/ lbs oz Nallo GT . kg/ lbs oz Nallo . kg/ lbs oz Nallo GT . kg/ lbs oz Allak . Jannu. Akto . Soulo. Unna . . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz YELLOW LABEL BLUE LABEL Anjan & Anjan GT. Anjan . kg/ lbs Anjan GT . kg/ lbs oz Atlas . Altai. Anjan . kg/ lbs oz Anjan GT . kg/ lbs oz Atlas Altai UL . kg/ lbs oz Basic . kg/ lbs Altai XP . kg/ lbs oz Rogen . Enan . Rajd . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz . kg/ lbs oz EUROPE OUTSIDE OF EUROPE Hilleberg the Tentmaker AB Hilleberg the Tentmaker, Inc. Önevägen NE th Street S- Frösön, Sweden Redmond, WA USA : + WWW.HILLEBERG.COM : + () - : + : + () - THE TENT HANDBOOK [email protected] : -.. [email protected] General information Welcome!. About us. Hilleberg principles . Design & manufacturing. Materials . Welcome to the Hilleberg Tent Handbook 2015! The Importance of tear strength . Fabric specifications. 2014 was a busy year for us, and we are excited about the results. -
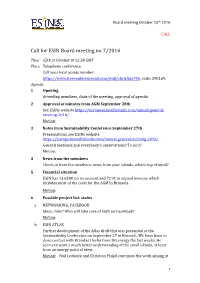
Call for Board Meeting Oct 25
Board meeting October 25th 2016 CALL Call for ESIN Board meeting no 7/2016 Time 25th of October at 12:30 GMT Place Telephone conference Call your local access number: https://www.freeconferencecall.com/wall/christian706, code: 590169. Agenda 1 Opening Attending members, chair of the meeting, approval of agenda. 2 Approval of minutes from AGM September 28th See ESINs website https://europeansmallislands.com/annual-general- meeting-2016/ Motion: 3 Notes from Sustainability Conference September 27th Presentations, see ESINs website https://europeansmallislands.com/annual-general-meeting-2016/ General feedback and everybody’s observations? To do’s? Motion: 4 News from the members Check-in from the members: news from your islands, what’s top of mind? 5 Financial situation ESIN has 13.658€ on its account and 721€ in unpaid invoices which includes most of the costs for the AGM in Brussels. Motion: 6 Possible project list: status a NETWORKING, FACEBOOK Ideas, links? Who will take care of ESIN on FaceBook? Motion: b ESIN ATLAS Further development of the Atlas draft that was presented at the Sustainability Conference on September 27 in Brussels. We have been in close contact with Brendan Devlin from DG energy the last weeks. He seems to want a much better understanding of the small islands, at least from an energy point of view. Motion: Neil Lodwick and Christian Pleijel continues the work aiming at 1 Board meeting October 25th 2016 CALL defining a set of sustainability indicators through a study involving us as a partner and, hopefully, financed by DG Energy. c ENTREPRENEURSHIP A project addressing that small islands lack economies of scale and their businesses are under pressure of high costs regarding transports, distribution and production (see CPMR paper “Off the Coast of Europe”, 2002). -

6 the North Frisians and the Wadden Sea
6 The North Frisians and the Wadden Sea Thomas Steensen Abstract The Wadden Sea is not the edge of North Frisia, it is not a marginal part, but an integral and central element. The district of North Frisia (Kreis Nordfriesland), founded in 1970, covers an area of 2,083 square kilometres. To that must be added the Wadden region between the Eider River and the Lister Tief, covering an area of about 1,750 square kilometres. North Frisia consists of 55 percent land and no less than 45 percent mudflats. The Wadden Sea, especially the North Frisian part of it, has been shaped by an interplay over centuries between man and his natural surroundings, a phenomenon that it difficult to find elsewhere in the world. Large parts of the Wadden Sea form a ‘cemetery of the marshlands’. Kulturspuren (traces of culture) such as remains of terps and dikesdike, bricks, pottery shards, tidal gates, ditch systems, furrows, entire farming fields, and places of early salt peat extraction are a testament to the interdependence between man and nature. Archaeologist Hans Joachim Kühn considers this ‘an inexhaustible archive of remembrance and research, sometimes even of shudder’. Throughout the centuries, there has been a special relationship between the North Frisians and the Wadden Sea. This is reflected by the intense discussions on the establishment of a national park. It really would have been appropriate if in 2009 the Wadden Sea had been recognised not only as a World Natural Heritage Site but also as a World Cultural Heritage Site. So far, this cultural landscape has not been sufficiently put into focus. -

Die Küste, Heft 78 (2011) 1-294
Die Küste, 78 (2011), 259-292 Die Schäden der Weihnachtsflut von 1717 an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins Von DIRK MEIER Zusammenfassung Die Weihnachtsflut von 1717 gehört zu den größten Naturkatastrophen der frühen Neuzeit an der südlichen Nordseeküste von den Niederlanden bis nach Schleswig-Holstein. An der gesamten Nordsee- küste dürften über 11.000 Menschen, 10.000 Pferde, 40.000 Rinder, 10.000 Schweine und 35.000 Schafe ertrunken und über 4.000 Häuser vom stürmischen Meer weggerissen worden sein. Entsprechend der Lü- ckenhaftigkeit der historischen Quellen ist eine Gesamtschadenbilanz schwierig zu erstellen, doch kann man in Schleswig-Holstein von mindestens 558 Toten, 10.996 ertrunkenen Rindern und 1.692 ertrunke- nen Schafen ausgehen. Mindestens 390 Häuser waren weggerissen und weitere 1185 beschädigt worden. Der folgende Artikel fasst anhand einer Auswertung der schriftlichen und geoarchäologischen Überliefe- rung sowie rekonstruierter Überflutungskarten die Schäden für die schleswig-holsteinische Nordseeküste zusammen.1 Schlagwörter Weihnachtsflut 1717, Eisflut 1718, historische Sturmfluten, Deiche, Naturkatastrophen, Nordfries- land, Nordfriesische Inseln, Halligen, Eiderstedt, Dithmarschen, Elbmarschen Summary This article describes the storm surge disaster of 1717–1718 of the North-Sea coast of Schleswig-Holstein. The Christmasflood from 1717 and the Ice Flood of 1718 were one of the heaviest disasters in the early younger period and caused a large damage at the German North-Sea coast. Most of the dikes were damaged or destroyed and the marsh lands were over flooded by the salt water. More than 11,000 humans, 10,000 horses, 40,000 cows, 10,000 pigs and 35,000 sheep were drowned and over 4,000 houses have been destroyed by the stormy sea.